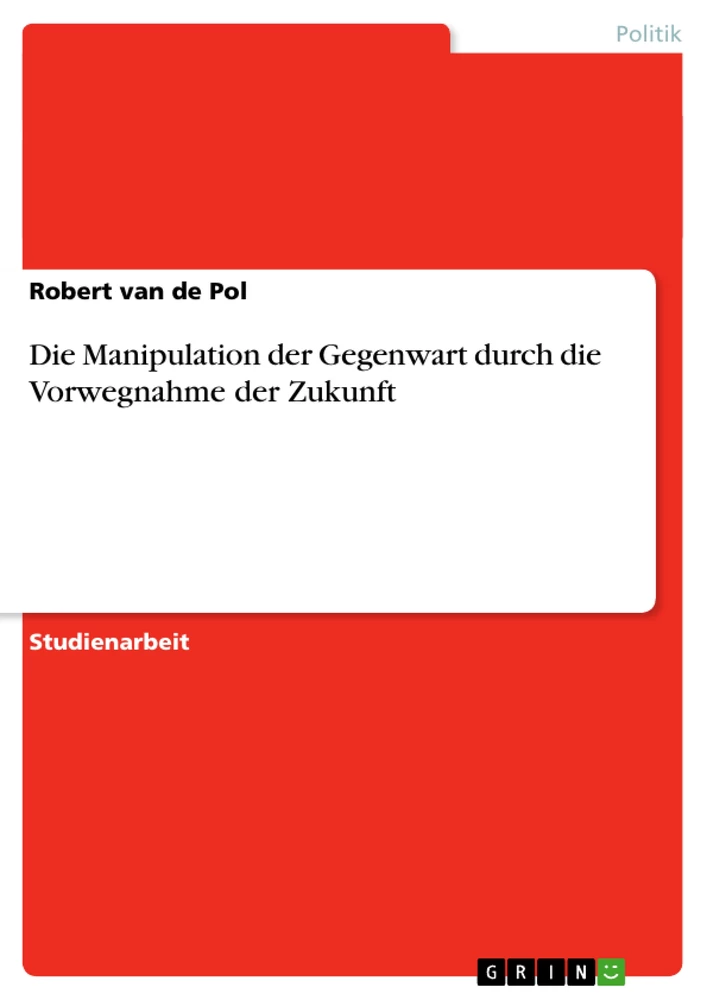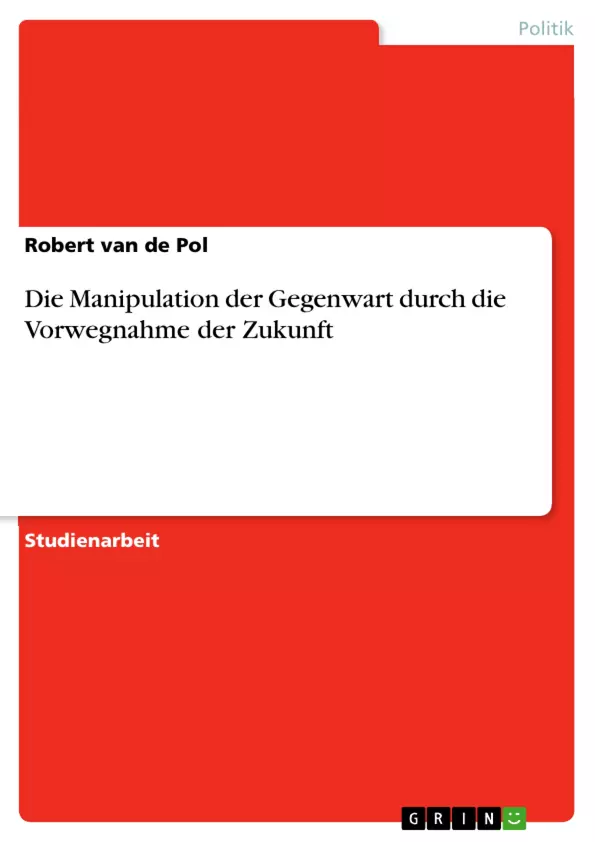Nicht nur aus völkerrechtlicher Perspektive ist der von der Bush-Regierung angewandten Strategie der präventiven Selbstverteidigung mit Skepsis zu begegnen. Subjektive Wahrnehmungsverzerrungen der politischen Akteure, heterogene Handlungsmotivationen, offene Zeithorizonte, unintendierte Folgen und potenzielle Nachahmungseffekte stellen eine ganze Reihe von unkalkulierbaren Risiken dar, die eine Anwendung des präventiven Verteidigungskrieges in der amerikanischen Fassung für das internationale politische System untragbar machen.
Ziel dieser Arbeit ist die normative, politisch-philosophische Auseinandersetzung mit der Doktrin der präventiven Selbstverteidigung. Ein besonderes Augenmerk wird jedoch auf die oftmals vernachlässigte Dimension “Zeit” gerichtet, der im Lichte handlungstheoretischer Überlegungen eine spezielle Bedeutung zukommt.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung und Aufbau der Arbeit
2. Fragestellung
3. Die langen Wellen der Staatsbildung und des Staatszerfalls
4. Völkerrecht und/oder Präventivkrieg?
5. Die Auswirkungen des 11. September 2001 auf das Völkerrecht
6. Präventivkrieg und die Gefahren der Antizipation
1) Problem der subjektiven Wahrnehmung
2) Problem der heterogenen Handlungsmotivation
3) Problem der offenen Zukunft
4) Problem der unintendierten Folgen
5) Problem der Nachahmung
7. Schlussfolgerungen und Ausblick
8. Literaturverzeichnis
8.1 Monographien
8.2 Zeitschriften- und Zeitungsartikel
8.3 Dokumente
1.Einleitung und Aufbau der Arbeit
Die terroristischen Attacken vom 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington haben der medial vernetzten Welt nicht nur das gewaltige zerstörerische Potenzial einiger gut organisierter religiöser Fundamentalisten vor Augen geführt, sondern zeitgleich auch auf die Verletzlich- und Verwundbarkeit des globalen, interdependenten politischen und ökonomischen Systems aufmerksam gemacht. Die nach dem Ende des Ost-West-Gegensatzes gehegte Hoffnung auf einen dauerhaften kantischen Frieden, der durch den Wegfall der ideologischen Machtkämpfe auf dem fruchtbaren Boden transnationaler ökonomischer Beziehungen und wechselseitiger Abhängigkeiten gedeihen sollte, mutierte auf einen Schlag zur illusorischen Fata Morgana, die der brutalen Realität (vorerst) weichen musste.
Veränderte Weltlagen verlangen nach neuen politischen Lösungen, dachten sich die Militärstrategen in Washington und präsentierten einige Monate später jenes (in der Schublade bereits vorhandene) Konzept, das der neuen Weltordnung angeblich gerecht werden würde. Gemäss den Vorstellungen der gegenwärtig amtierenden US-Administration stellt der Präventivkrieg[1] das geeignete politische und militärische Mittel dazu dar, globale Gefahren antizipatorisch vorwegzunehmen und direkt zu bekämpfen. Gleichzeitig werden dadurch die Ordnungsstrukturen des internationalen politischen Systems aktiv umgestaltet und verändert (Fitschen, 2003). Spätestens seit dem Ausbruch des dritten Golfkrieges und der gewaltsamen Entmachtung des vermeintlichen Nebukadnezzar-Nachfolgers Saddam Hussein wissen wir, was der politische Begriff des Präventivkrieges militärisch beinhaltet und was mit “antizipatorischer Selbstverteidigung” gemeint ist.
Nicht nur bei besorgten Völkerrechtlern, weitsichtigen Militärstrategen und skeptischen Politikern stiess das schwammige Konzept der präventiven Selbstverteidigung auf massive Kritik, sondern auch unter Politikwissenschaftern, namhaften Intellektuellen und politischen Philosophen wurde vor und nach dem Irakfeldzug eine rege und lebhafte Diskussion entfacht.[2] Die politisch-philosophische Debatte kreiste mehrheitliche um die Frage der Vor- und Nachteile des amerikanischen Unilateralismus im Gegensatz zum alt-europäischen, multilateralen Verhandlungsweg; der Gefahr eines hegemonialen Machtanspruchs in Zeiten der globalen Interdependenz; der zukünftigen Aufgabe des kollektiven Sicherheitssystems und der politischen Notwendigkeit beziehungsweise der moralischen Pflicht einer Demokratie- und Menschenrechtsverbreitung über die Grenzen des westlichen Abendlandes hinweg.[3] Vielfach wurde in der Diskussion die traumatische Wirkung des 11. September auf die Psyche der selbstbewussten Amerikaner hervorgehoben (Kind, 2003) und auf die unterschiedliche europäische und amerikanische Problemwahrnehmung hingewiesen, die einerseits auf der politischen Komplexität Europas beruht und andererseits vor dem Hintergrund zweier verheerender Weltkriege mit dem Resultat eines - positiv traumatisierten - Anti-Kriegs-Bewusstseins zu verstehen ist. Meines Erachtens zu wenig wurde/wird dabei auf die Funktionslogik der Doktrin der präventiven Selbstverteidigung und der Implikationen einer solchen Praxis auf die Stabilität des internationalen politischen Systems eingegangen. Aus politisch-philosophischer Perspektive, die mitunter zur Aufgabe hat, politische Konzepte zu hinterfragen, zu kritisieren, normativ aufzuladen und deren praktische Brauchbarkeit im realpolitisch-faktischen Kontext zu prüfen, ist eine solche Analyse unbedingt notwendig, damit eine argumentative Basis für weitere Diskussionen entwickelt werden kann. Dementsprechend ist das Ziel dieser Arbeit eine normativ-kritische Auseinandersetzung mit dem politischen und militärischen Konzept des präventiven Selbstverteidigungskrieges unter Berücksichtigung breiter gesellschaftlicher Entwicklungen wie die der Globalisierung und der wachsenden ökonomischen und politischen Interdependenz. Dabei werde ich auf die veränderte Weltlage nach dem Ende des Ost-West-Konflikts und dem damit zusammenhängenden Aufkommen der “neuen Kriege” eingehen, sowie völkerrechtliche Fragen hinsichtlich der Legitimation des Präventivkrieges behandeln. Ein besonderes Augenmerk möchte ich auf die oftmals vernachlässigte Dimension “Zeit” richten, der im Lichte handlungstheoretischer Überlegungen eine spezielle Bedeutung zukommt (siehe z.B. Oeter, 1998: 44).
2. Fragestellung
Die Fragestellungen, die ich in dieser Arbeit behandeln möchte, lauten wie folgt:
- Inwiefern kann und soll die Praxis des präventiven Handelns im Sinne der “antizipierenden Selbstverteidigung” als legitimes politisches Mittel angesehen werden, um den globalen Herausforderungen in einem zunehmend komplexen Weltsystem entgegenzutreten?
- Welche Konsequenzen hätte eine solche Praxis auf die Stabilität des internationalen politischen Systems?
Folgende Themenkomplexe sind mit diesen Fragestellungen unmittelbar verknüpft:
- Das Sollen akzentuiert den normativen Charakter der ersten Fragestellung. Kantianisch formuliert würde die Frage folgendermassen lauten: Kann ich wollen, dass das Recht auf antizipatorische Selbstverteidigung ein allgemeingültiges Gesetz werden soll? Interessant ist diese Reformulierung aus dem Grund, weil das Recht auf präventive Selbstverteidigung unter dem Aspekt der Allgemeingültigkeit und der Universalisierbarkeit seine ganze politische Tragweite offenbart und die destabilisierende Wirkung auf das internationale politische System erahnen lässt.
- Der Ausdruck des legitimen politischen Mittels verweist auf den wichtigen Aspekt der Legitimation und der völkerrechtlich abgestützten politischen Entscheidung. Eine thematisch anschliessende Frage könnte lauten: Soll die präventive Selbstverteidigung explizit völkerrechtlich verankert werden?
- Die “Mittel-Zweck-Relation” widerspiegelt eine temporale Beziehungen. Damit verknüpft ist auch die Frage, auf welcher Informationsgrundlage antizipatorisch gehandelt wird und wie allfällige Gefahrenprognosen überhaupt zustande kommen beziehungsweise was für politische Auswirkungen solche subjektive Prognosetätigkeiten und der daraus abgeleiteten Handlungen haben können.
- Unter globalen Herausforderungen verstehe ich sowohl den regional begrenzten als auch international operierenden Terrorismus, jegliche Art von Fundamentalismus, die unkontrollierte Verbreitung von Massenvernichtungswaffen chemischer, biologischer und atomarer Art, das ständig wachsende Nord-Süd-Gefälle, implodierende staatliche Strukturen, die international organisierte Kriminalität, Menschenrechtsverletzungen, globale Epidemien, die Gefahr eines kollabierenden globalen Ökosystems u.v.m. (Hobsbawm, 2000: 688-710; Solana, 2003; Fitschen, 2003).
3. Die langen Wellen der Staatsbildung und des Staatszerfalls
Herfried Münkler untersucht in seinem Buch “Die neuen Kriege” die politischen und militärischen Veränderungen, die sich in bezug auf die Führung, Hegung und Verrechtlichung des Krieges in den letzten 400 Jahren ereignet haben. Angefangen beim Dreissigjährigen Krieg, den er als Analyserahmen zur Erklärung der heutigen Weltsituation herbeizieht, zeichnet er die verschiedenen Entwicklungsstadien und -stufen der Kriegsführung vor dem Hintergrund der Kriegsökonomie und des historisch-politischen Kontextes nach (Münkler, 2003: 59-130). Münkler betont, dass für die Art und Weise der Kriegsführung, der Kriegsentwicklung und der Kriegsverrechtlichung die gefestigte territoriale Grenzziehung und der damit verknüpften Entstehung von autonomen Nationalstaaten mit eigenständigen Souveränitätsansprüchen von entscheidender Bedeutung war (ebd.: 68). Dadurch konnten sich dichotome Unterscheidungsmuster wie die zwischen Innen- und Aussenpolitik, Krieg und Frieden, Freund und Feind, Kombattant und Nonkombattant herausbilden, wodurch die verschiedenen Facetten und Dimensionen des Krieges rechtlich definier- und konkretisierbar wurden (ebd.: 68-72). Zudem war der souveräne Nationalstaat nun eigenständig “in der Lage, zwischen zulässiger Gewalt im Rahmen von Kriegshandlungen und Gewaltkriminalität eine klare Trennlinie zu ziehen. Dies betrifft sowohl die Unterscheidung zwischen Krieg und Frieden selbst als auch die Begrenzung zulässiger Gewalt im Krieg” (ebd.: 72).[4] Diese Unterscheidungsfähigkeit zwischen legitimer und illegitimer Gewaltausübung bildete auch die politisch-normative Grundlage für die Ausarbeitung der Hager Verträge (1907), den vier Genfer Konventionen (1949) und den Zusatzprotokollen (1977), sowie der modernen Völkerrechtsordnung basierend auf der Charta der Vereinten Nationen von 1945 (ebd.: 72f; Kimminich/Hobe, 2000: 442-450).
Für Münkler, der sich vor allem für das realpolitische Segment der Kriegsökonomie interessiert, stellt aber die wichtigste Grenzziehung “die zwischen Gewaltanwendung und Erwerbsleben” dar, weil sich infolgedessen “offene Gewaltmärkte” zu schliessen begannen und “an die Stelle des von Fall zu Fall angeworbenen Kriegsvolks” (Münkler, 2003: 73) bezahlte und ausgebildete, daher kontrollierbare, stehende Heere traten. Erst die Kombination aus diesen parallel erfolgten Prozessen der graduellen Staatsformierung[5], der Machtzentralisierung und der Monopolisierung der Gewalt in den Händen ebendieser Nationalstaaten ermöglichte geregelte, d.h. auf der Grundlage von formellen und informellen Regeln und Verträgen basierende Kriege. Dadurch war zugleich das politisch-rechtliche Fundament für symmetrische Konfliktaustragungen geschaffen worden, weil sich nun einerseits Nationalstaaten mit einigermassen geordneten Militärorganisationen gegenüber standen und andererseits diese Nationalstaaten den gleichen Kriegsregeln und Kodizes unterstellt waren (ebd.: 120f). Die politische Folge dieser militärisch-faktischen und rechtlich-normativen Symmetrisierung war ein System der wechselseitigen Kontrolle und das Einpendeln einer gewissen Gleichgewichtsordnung, die noch während der Periode des Kalten Krieges, jedoch auf der Prämisse der gegenseitigen Abschreckung aufbauend, Bestand hatte (Kohler, 1994: 12ff).
Aus politisch-philosophischer Perspektive befass(t)en sich insbesondere die Kontraktualisten mit der Frage der normativen Notwendigkeit eines staatlichen Gewaltmonopols respektive einer staatlichen Sanktionsgewalt. So heben die Vertragstheoretiker der (frühen) Neuzeit gleichermassen hervor, dass es zur Überwindung der im Naturzustand vorherrschenden individuellen Handlungsfreiheit eine Sanktionsgewalt geben muss, die sich um die Durchsetzung von Recht und Ordnung kümmert (Braun/Heine/Opolka, 2000: 119). Dieser Schritt aus dem fiktiven Naturzustand ist ein Gebot der menschlichen Vernunft und basiert auf der Logik der individuellen Freiheitseinschränkung zugunsten der kollektiven Sicherheit, was mittels wechselseitiger vertraglicher Selbstverpflichtung erreicht wird (ebd.: 118). Resultat des kontraktualistischen Gedankenexperiments ist ein gesellschaftliches Kollektiv, das in einem abgeschlossenen Territorium nach eigens definierten Regeln und Gesetzen (z.T. auch Verfassung) funktioniert, die vom Staat notfalls mit Zwangsmassnahmen durchgesetzt werden. Der souveräne Staat besitzt somit das alleinige und ungeteilte Gewaltmonopol; er entscheidet letztinstanzlich auch über Krieg und Frieden.[6]
Im Lichte dieser politisch-philosophischen Tradition und unter Berücksichtigung des politischen Kontextes muss auch der viel zitierte Satz des Kriegstheoretikers Carl von Clausewitz aus dem Jahr 1832 gelesen und interpretiert werden, der besagt, dass der Krieg nichts anderes sei als die Fortsetzung des politischen Verkehrs mit Einmischung anderer Mittel (Clausewitz, 1832: 990). Die Clausewitz’sche Argumentationslogik ist klar und einfach: Der Krieg ist das Macht- und Zwangsinstrument der Politik. Der politische Verkehr bleibt aber dem Krieg vorangestellt und dadurch prioritär (Herberg-Rothe, 2002). Damit überhaupt (geordnete und symmetrische) Kriege geführt werden können, braucht es jedoch einen starken souveränen Staat, der das Gewaltmonopol besitzt, für die innere Ordnung sorgt und sich gegenüber feindlichen Angriffen verteidigt.[7] Dieses Konzept der Souveränität beziehungsweise der unabhängigen Selbstbestimmung und der territorialen Unversehrtheit ist zum eigentlichen Wesens- und Definitionsmerkmal des Staates geworden (Nohlen, 1998: 675f). Es hat seit der Entstehung des modernen Nationalstaates nicht nur den Charakter des Krieges geprägt, sondern auch die Entwicklung des Völkerrechts wesentlich beeinflusst. So ist das moderne Völkerrecht - trotz bestimmter Aufweichungen - im Wesentlichen auf dem Fundament der staatlichen Souveränität aufgebaut (Kimminich/Hobe, 2000: 40).
Doch dieses Fundament hat seit dem Ende des Ost-West-Gegensatzes heftige Risse abbekommen (Münkler, 2003: 47f). Das Spannungsfeld des Kalten Krieges, das während gut 40 Jahren für das Klima in der internationalen Politik verantwortlich war und taktische Entscheidungen sowie strategische Handlungen gleichermassen zu beeinflussen vermochte, fiel auf einen Schlag weg und hinterliess ein militärisches, ideologisches und politisches Machtvakuum. Viele Staaten, die während des Kalten Krieges von der einen oder anderen Partei finanziell und militärisch unterstützt worden waren, wurden von der politischen und ökonomischen Last geradezu erdrückt.[8] Das globale Mächtegleichgewicht, das im 19. und in weiten Teilen des 20. Jahrhunderts auf dem Vorhandensein von ungeteilten nationalstaatlichen Gewaltmonopolen beruhte und in den Jahren des Kalten Krieges auf dem hypothetischen Schreckensszenario eines verheerenden nuklearen Weltkrieges fusste (Tugendhat, 1986: 46; Kohler, 1994: 13f), hatte einer neuen politischen Orientierungsdynamik Platz gemacht. Der britische Historiker Hobsbawm beschreibt diesen Zerfalls- und Neuordnungsprozess folgendermassen:
“Zum erstenmal seit zwei Jahrhunderten besass die Welt in den neunziger Jahren kein internationales System und keine Struktur. Die Tatsache, dass nach 1989 Dutzende von neuen Territorialstaaten auftauchten, die über keinerlei unabhängige Mechanismen zur Bestimmung ihrer Grenzen verfügten, spricht für sich selbst - es gab ja nicht einmal dritte Parteien, deren Unparteilichkeit soweit akzeptiert worden wäre, um als Vermittler auftreten zu können” (Hobsbawm, 2000: 688f).
Diese internationale Struktur- und Orientierungslosigkeit bedeutete aber auch, dass “ein dritter Weltkrieg der alten Art zu den am wenigsten wahrscheinlichen Aussichten gehörte” (ebd.: 690).[9] Die klassischen symmetrischen Staatenkriege mit dem Clausewitz’schen “Primat der Politik über die Kriegführung” (Herberg-Roth, 2002) waren somit (vorerst) zum Auslaufmodell geworden und an ihre Stelle traten in zunehmendem Masse asymmetrische “globalisierte Kriege” (Kaldor, 2000: 144; sowie Münkler, 2003: 7). Charakteristisch für diese Kriegsform ist der Umstand, dass sie mit der Fragmentierung und Dezentralisierung des Staates einhergeht und sich über längere Zeitperioden ohne eine explizite Verfolgung bestimmter politischer Ziele erstreckt, was Münkler auf die veränderte Kriegsökonomie zurückführt (Münkler, 2003: 26). Die hauptsächlichen Akteure dieser low intensity wars sind nicht mehr souveräne Nationalstaaten mit ungeteilten Gewaltmonopolen, sondern “immer häufiger parastaatliche, teilweise sogar private Akteure - von lokalen Warlords und Guerillagruppen über weltweit operierende Söldnerfirmen bis zu internationalen Terrornetzwerken -, für die der Krieg zu einem dauerhaften Betätigungsfeld geworden ist” (Kaldor, 2000: 144). Im Kontext dieser veränderten politischen Weltlage müssen sich die - noch intakten - Staaten zwei sicherheitspolitisch signifikante Fragen stellen: Wie können die neuen Kriege verhindert bzw. deren Transnationalisierung aufgehalten werden? Welche Mittel sollen dafür eingesetzt werden?
Seit dem Ende des Ost-West-Gegensatzes wird über diese beiden Fragen heftigst debattiert. Es prallen im Wesentlichen zwei in vielerlei Hinsichten diametral entgegengesetzte politisch-philosophische Lager aufeinander: Auf der einen Seite stehen die politischen Idealisten bzw. die Kosmopolitisten, die auf die Einhaltung und Weiterentwicklung des kollektiven, auf dem Völkerrecht basierenden Sicherheitssystems beharren und militärische Gewaltmassnahmen nur in äussersten Notsituationen billigen möchten (z.B. Kaldor, Barber, Nye). Auf der anderen Seite argumentieren die politischen Realisten, die eine Parallelität zwischen der hobbistischen Naturzustandskonzeption und der gegenwärtigen Weltlage sehen und die mit (unilateralen) militärischen Massnahmen auf die neuen Bedrohungen reagieren möchten (z.B. Kagan und Pollack).[10] Die amerikanische Doktrin des Präventivkrieges respektive der präventiven Selbstverteidigung ist eine Zwitterform zwischen diesen politisch-philosophischen Positionen, da sie sich einerseits auf das geltende Recht auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung im Rahmen der völkerrechtlichen Prinzipien beruft, auf der anderen Seite aber auch unilaterales militärisches Vorgehen ohne vorherige Konsensfindung in Erwägung zieht. Im Folgenden soll auf die Frage der prinzipiellen Vertäglichkeit zwischen Präventivkrieg und Völkerrecht eingegangen werden.
4. Völkerrecht und/oder Präventivkrieg?
Das moderne Völkerrecht kann wohl mit Fug und Recht als die normative Grundlage der internationalen Politik bezeichnet werden. Michael Byers jedenfalls vertritt diese Ansicht und schreibt dazu: “Die Verabschiedung der UN-Charta bedeutete für die internationalen Beziehungen so etwas wie eine konstitutionelle Stunde null: Eine anarchische, vom Prinzip der Selbsthilfe und von Ad-hoc-Bündnissen geprägte Welt entwickelte die Keimform einer Art Weltregierung” (Byers, 2002). So sollen international verbindliche Rechtsnormen und Rechtsgrundsätze, völkerrechtliche Vereinbarungen und Gewohnheiten dafür sorgen, dass Interessenunterschiede und Meinungsdifferenzen nicht in Form militärischer Konfliktaustragung, sondern auf der stabilen Plattform des Rechts friedlich gelöst werden können (Paech, 2003a). Dementsprechend stellt der wichtigste normative Pfeiler des Völkerrechts das generelle Kriegs- und Gewaltverbot dar, wie es in der UN-Charta explizit geschrieben steht:
“Alle Mitglieder unterlassen in Ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt” (UN-Ch, Art. 2, Zif. 4)
Damit verknüpft ist auch das Verbot der Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates.[11] Dadurch wird dem staatlichen Souveränitätsanspruch für innenpolitische Angelegenheiten Rechnung getragen. Auch Artikel 51 der UN-Charta betont diesen staatlichen Souveränitätsanspruch, indem auf das natürliche Recht auf individuelle und kollektive Selbstverteidiung bei bewaffneten (staatlichen) Angriffen verwiesen wird:
“Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen keineswegs das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung, bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Massnahmen getroffen hat. Massnahmen, die ein Mitglied in Ausübung dieses Selbstverteidigungsrechts trifft, sind dem Sicherheitsrat sofort anzuzeigen; sie berühren in keiner Weise dessen auf dieser Charta beruhende Befugnis und Pflicht, jederzeit die Massnahmen zu treffen, die zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit für erforderlich hält” (UN-Ch, Art. 51)
Für die völkerrechtliche Beurteilung des Präventivkrieges sind vor allem die beiden Begriffe “Selbstverteidigung” und “bewaffneter Angriff” von entscheidender Bedeutung. Denn individuelle und kollektive Selbstverteidigung wird gemäss Artikel 51 nur dann legitimiert, wenn zuvor ein bewaffneter Angriff stattgefunden hat (Byers, 2002; Fischer, 2003). Das politisch-militärische Konzept der präventiven, antizipatorischen Selbstverteidigung löst hingegen diese temporale Verbindung zwischen Aktion und Reaktion auf bzw. kehrt sie vollends um, indem die Notwendigkeit einer der Gefahr zuvorkommenden Selbstverteidigung ins Zentrum gerückt wird. Unter diesem Aspekt muss folglich der Präventivkrieg als völkerrechtswidrig angesehen werden (Arnswald, 2003; sowie Riklin, 2003).
Nun gibt es aber bestimmte Situationen, in denen das Völkerrecht einen militärischen Erstschlag zulässt. Diejenigen Politiker, Militärstrategen und Völkerrechtler, die auf dieses Recht des präemptiven Erstschlages aufmerksam machen, stützten sich nicht auf den expliziten Wortlaut der UN-Charta, sondern verweisen auf die gewohnheitsrechtlich akzeptierten Kriterien der informellen ‘Caroline-Klausel’ (Byers, 2002; Riklin, 2003).[12] Sie legitimiert den militärischen Erstschlag bei einer unmittelbaren Kriegsgefahr nur dann, wenn es keine andere Wahl der Mittel mehr gibt und alle Verhandlungsoptionen ausgeschöpft worden sind (Arnswald, 2003). Drei Bedingungen müssen grundsätzlich erfüllt sein, damit von einer unmittelbaren Bedrohung gesprochen werden darf: Es muss erstens eine erkennbar aktive Kriegsvorbereitung stattfinden, zweitens muss sich eine klare Absicht manifestieren, einem anderen Staat Schaden zufügen zu wollen und drittens “schliesslich eine Situation existieren, in der Abwarten statt Kämpfen das Risiko erhöht, Opfer einer Aggression zu werden” (ebd.). Nur wenn alle diese Kriterien erfüllt sind, darf ein präemptiver Erstschlag ins Auge gefasst werden.[13] Alle anderen Gefahrenanalysen und die militärischen Massnahmen zur Abwendung dieser Bedrohungen obliegen einzig und allein dem Sicherheitsrat (Byers, 2002; Fischer, 2003):[14]
“Der Sicherheitsrat stellt fest, ob eine Bedrohung oder ein Bruch des Friedens oder eine Angriffshandlung vorliegt; er gibt Empfehlungen ab oder beschliesst, welche Massnahmen auf Grund der Artikel 41 und 42 zu treffen sind, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren oder wiederherzustellen” (UN-Ch, Art. 39).
Es muss also scharf zwischen einer vorbeugenden Verteidigung gegen eine unmittelbar bevorstehende Aggression und einem Präventivkrieg eines Staates oder einer Koalition ohne UNO-Mandat gegen eine nicht unmittelbar bevorstehende Aggression unterschieden werden (Riklin, 2003). Stützt sich die vorbeugende, präemptive Verteidigung auf die oben genannten, zu erfüllenden Kriterien der unmittelbaren Bedrohung ab, und basiert eine vom Sicherheitsrat abgesegnete militärische Operation auf dem legitimatorischen Fundament der kollektiven Konsensfindung (Oeter, 1998: 55), bleibt der unilateral-antizipatorische, nicht mandatierte Präventivkrieg in einem Morast von Mutmassungen und Spekulationen stecken, was der Missbrauchsgefahr und der Willkür auf gefährliche Art und Weise die Tür öffnet (Zanetti, 2002: 469). Die international Politik droht dadurch zurück in den Hobbes’schen Naturzustand geworfen zu werden, indem die asymmetrische Methode der Terroristen kopiert, das internationale Rechtssystem bewusst unterwandert und der vermeintliche Eigennutzen dem kollektiven Sicherheitssystem vorangestellt wird (Münkler, 2003: 240; Paech, 2003a und 2003b).
Angesichts der akuten Bedrohungen, die von weltweit agierenden terroristischen Organisationen, kriminellen Banden und paramilitärischen Akteuren ausgehen und die in Verbindung mit der unkontrollierten Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu einer besonders explosiven und gefährlichen Mischung verkommen, werden vermehrt auch kritische Stimmen laut, die eine Anpassung des Völkerrechts auf die veränderte Realität fordern oder zumindest eine Abkehr von der strikten Völkerrechtsauslegung verlangen. So sieht beispielsweise Karl-Heinz Kamp den Schlüssel für die Fortentwicklung des Völkerrechts darin, dass es zukünftig mehr um ein Ermessen und Beurteilen als auf das Pochen auf formale Regeln gehen müsse (Kamp, 2004). Seiner Meinung nach sollen aus der konkreten Situation heraus die unterschiedlichen völkerrechtlichen Grundwerte gegeneinander abgewogen werden, was faktisch einem prozeduralen Interpretations- und Abwägungsmechanismus gleichkommt.[15] Dass aber eine solche Praxis der situativen Abwägung und Auslegung zu unterschiedlichen Ergebnissen führen kann, ist spätestens seit dem offen ausgetragenen Disput betreffend der völkerrechtlichen Legitimation für den amerikanisch-britischen Einmarsch in Irak bekannt. So sehen sich die “alten” Europäer, die auf die Einhaltung des Systems der kollektiven Sicherheit beharren, den multilateralen Weg der argumentativen Konsensfindung politisch pflegen und einer aggressiven militärischen Verteidigungsstrategie skeptisch gegenüber stehen, mit einer offensiv ausgerichteten, gegebenenfalls eigenmächtig agierenden Politik Washingtons konfrontiert, das sich auf das natürliche Recht auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung beruft. Die Ereignisse vom 11. September können nur teilweise für diesen fundamentalen Bruch mit der amerikanischen Tradition der multilateralen Kooperation im Rahmen des kollektiven Sicherheitssystems verantwortlich gemacht werden. Der andere Teil speisst sich aus der veränderten Wahrnehmung - insbesondere der Bush-Administration - des militärischen und ökonomischen Hegemonen USA, der über die nötigen Mittel und den politischen Willen zur aktiven Weltgestaltung verfügt (Paech, 2003b; Byers, 2002). Doch inwiefern darf und soll das Recht des Stärkeren wieder in die Sphäre der internationalen Politik Eingang finden, nachdem der Pfad der wechselseitigen vertraglichen Verpflichtung und der kollektiven Sicherheit zur Überwindung ebendieses instabilen Zustandes eingeschlagen worden ist? Wird nicht gerade durch die Praxis des eigenmächtigen staatlichen Agierens in der komplexen internationalen Politikarena die Büchse der Pandora geöffnet anstatt geschlossen, da die Gefahr der nicht-kalkulierbaren Risiken und der staatlichen Nachahmungseffekte dadurch vergrössert und nicht minimiert wird? Werden durch unilaterale, auf Mutmassungen basierende Handlungen die “zivilisierenden Fesseln” (Habermas) des internationalen Rechtssystems nicht gänzlich abgelegt? Inwiefern diese Fesseln bereits Risse abbekommen haben, soll im folgenden Kapitel untersucht werden.
5. Die Auswirkungen des 11. September 2001 auf das Völkerrecht
In einem Aufsatz mit dem Titel “Nach dem 11. September: Paradigmenwechsel im Völkerrecht?” versucht Véronique Zanetti die normativen Prinzipienverschiebungen im Bereich des Völkerrechts aufzuzeigen, die nach den Terrorattacken auf die USA und mit der Rechtfertigung des Afghanistanfeldzuges aufgetreten sind. Nach einer genauen Analyse stellt sie resümierend fest, dass “de facto eine Verschiebung der Anwendung des Völkerrechts” (Zanetti, 2002: 467) stattgefunden hat und deshalb zu Recht von einem Paradigmenwechsel gesprochen werden kann. Die folgenden vier völkerrechtlich relevanten Teilaspekte hebt sie dabei hervor (ebd.):
1) Die Terrorattacken vom 11. September wurden von der US-Administration mit einer Kriegserklärung gleichgesetzt und als bewaffnete Angriffe qualifiziert. Dadurch ist der Artikel 51 der UN-Charta auf den Bereich privater Täter ausgeweitet worden, was ein Bruch mit dem bisherigen, auf souveräne staatliche Handlungssubjekte ausgerichteten völkerrechtlichen Paradigma bedeutet.
2) Die Terrorattacken haben zu einer direkten und aktiven Rechtfertigung der individuellen und kollektiven Selbstverteidigung des geschädigten Staates (USA) geführt.
3) Nicht nur die unmittelbaren Angreifer, sondern auch ein indirekt involvierter Drittstaat wurde in der Folgezeit für den bewaffneten Angriff zur Verantwortung gezogen.[16] Damit dehnt sich das Selbstverteidigungsrecht automatisch auf all jene (Schurken)-Staaten aus, die terroristische Organisationen beherbergen, wie dies das Taliban-Regime in Afghanistan im Hinblick auf die Al Qaida-Organisation getan hat (siehe auch Byers, 2002).
4) Aufgrund der späten (militärischen) Reaktion der USA beziehungsweise der Anti-Terror-Koalition und der zeitlichen Unbegrenztheit der Ausübung des Selbstverteidigungsrechts hat sich die Rechtfertigung zu einem Recht auf präventive Selbstverteidigung erweitert.[17]
Obwohl man die Art und Weise, wie die Veränderungen in der Anwendung des Völkerrechts zustande gekommen und durchgesetzt worden sind, kritisieren kann (und muss), scheint es sich aber deutlich abzuzeichnen, dass das Völkerrecht (und die UNO) in seiner jetzigen Form dem veränderten Gesicht des internationalen politischen Systems nicht mehr vollumfänglich gerecht werden kann und deshalb dringend reformiert werden muss. So ist es an der Zeit, dass schwammige und bewusst offen gehaltene Begriffe wie des Terrorismus, der für alles mögliche ge- und missbraucht wird, genau definiert und bestimmt werden (Zanetti, 2002: 457). Ferner muss darüber diskutiert werden, inwiefern auch Angriffe von Einzelakteuren, Organisationen oder losen Netzwerken, also nicht-staatlich erfolgte Angriffe, ins Völkerrecht zu integrieren sind, damit eine klare Unterscheidung zwischen staatlichem und nicht-staatlichem Angriff vollzogen werden kann. Auf diese Lücke weist Zanetti explizit hin, indem sie schreibt: “Sobald man heraustritt aus dem klassischen Rahmen des Konflikts, der von einer offiziell die Staatsgewalt repräsentierenden Instanz erklärt wird, fällt man in eine äusserst heikle Zone von Verantwortlichkeitswahrnehmungen, für die keinerlei internationales Dokument vorgesehen ist” (ebd.: 464). Es ist zu bezweifeln, dass der Hegemon USA, der zwar unfreiwillig, dennoch bewusst, die führende Rolle im Kampf gegen den globalen Terrorismus übernommen hat, diese herkulische Aufgabe im Alleingang schaffen wird. Und es ist fraglich, ob die eigenmächtige und eigenwillige Zurechtbiegung der völkerrechtlichen Prinzipien zum langfristigen Wohle und zur Sicherheit der USA beitragen wird, geschweige denn zur Stabilität der internationalen Politik bisher einen konstruktiven Beitrag geleistet hat.[18] Dass aber die politische Handlungsstrategie des Präventivkrieges nicht dazu dienen kann, den gegenwärtigen und zukünftigen politischen und sozialen Herausforderungen in der sich schnell verändernden Welt entgegen zu treten, soll im nächsten Kapitel ausführlich behandelt werden.
6. Präventivkrieg und die Gefahren der Antizipation
Nach den Anschlägen vom 11. September sah sich die US-Administration veranlasst, gegen die nun offensichtlich gewordenen neuen Bedrohungen der asymmetrischen, terroristischen Kriegsführung eine tatkräftige politisch-militärische Antwort zu formulieren.[19] Dabei herausgekommen ist ein Strategiepapier mit dem Namen “Nationale Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten” (NSS), welches gemeinhin als Bush-Doktrin bezeichnet wird. Gemäss Fitschen besteht die grundlegende Zielsetzung der NSS in der Durchsetzung einer Sicherheitspolitik, “die die Ordnungsstrukturen des internationalen Systems aktiv gestaltet” (Fitschen, 2003). Im Gegensatz zur EU-Sicherheitsstrategie (EUSS), die der Hohe Beauftragte für die Gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik (GASP), Javier Solana, ausgearbeitet hat, behält sich die USA das Recht vor, antizipatorische Selbstverteidigungsmassnahmen notfalls auch unilateral durchzuführen. Die entscheidende Passage der NSS lautet:
“Wir werden Terrororganisationen durch folgende Massnahmen zerschlagen und zerstören:
- unmittelbares und kontinuierliches Handeln, das sich aller Elemente nationaler und internationaler Macht bedient. Unser unmittelbarer Schwerpunkt werden die weltweit agierenden Terrororganisationen sowie die terroristischen und staatlichen Sponsoren sein, die versuchen, Massenvernichtungswaffen oder deren Vorstufen zu beschaffen oder anzuwenden;
- Verteidigung der Vereinigten Staaten, des amerikanischen Volkes und unserer nationalen und internationalen Interessen, indem wir Bedrohungen ausmachen und ausschalten, bevor sie unsere Grenzen erreichen. Die Vereinigten Staaten werden sich ständig um die Unterstützung der internationalen Organisationen bemühen, werden aber auch nicht zögern zu handeln, wenn es notwendig werden sollte, unser Recht auf Selbstverteidigung wahrzunehmen, indem wir präemptiv gegen solche Terroristen vorgehen und sie davon abhalten, dass sie unserem Volk und unserem Land Schaden zufügen;
- wir werden den Terroristen weitere Finanzierung, Unterstützung und Zuflucht verwehren, indem wir Staaten überzeugen oder zwingen, ihrer souveränen Verantwortung gerecht zu werden”(NSS, Hervorhebung R. van de Pol).[20]
Die EUSS ist hingegen vorsichtiger formuliert und verweist darauf, “dass die globalen Probleme zu komplex sind als dass sie von den Vereinigten Staaten oder Europa im Alleingang gelöst werden können” (Fitschen, 2003). Auf diesen wichtigen Aspekt der internationalen Zusammenarbeit und der länderübergreifenden Kooperation machte der Architekt der EUSS, nämlich Javier Solana explizit aufmerksam, als er in einer kritischen Rede an der Kennedy School of Government der Harvard University sagte: “Ebenso kann der Kampf gegen den Terrorismus nur dann erfolgreich sein, wenn er als legitim empfunden wird. Voraussetzung für Legitimität ist allerdings ein breiter internationaler Konsens” (Solana, 2003). Doch weshalb ist dieser europäische Weg der Konsensfindung der wesentlich flexibleren und schnelleren “Hau den Lukas”-Strategie der USA vorzuziehen? Die Antwort ist einfach: Mittels Dialog und Diskussion werden die Interessenunterschiede der involvierten Parteien aneinander angeglichen. Dieser Prozess der Konsensfindung, insbesondere wenn er im Rahmen der UNO stattfindet, garantiert bis zu einem gewissen Grad, dass Fehleinschätzungen und subjektive Wahrnehmungsverzerrungen minimiert werden (Oeter, 1998: 55). Angesichts der enormen Tragweite von politischen Entscheidungen auf internationalem Parkett ist eine solche Minimierung unbedingt notwendig, um subjektive Einschätzungen und Analysen zu neutralisieren und objektivierbar zu machen. Denn die Gefahr, die eine unilaterale präventive Selbstverteidigung in sich birgt, ist vor allem die subjektive, vielleicht sogar willkürliche Motivations- und Informationsgrundlage, gemäss der präventiv gehandelt wird.
Präventives Handeln, wie sie die Bush-Administration versteht, ist antizipatorisches Handeln. Antizipation ist per definitionem die Vorwegnahme von zukünftigem Geschehen bzw. eine in die Zukunft gerichtete Extrapolation auf der Basis der Gegenwart. Mit anderen Worten: Der Fokus der Handlung richtet sich auf potenzielle, künftige Bedrohungen und schwer nachweisbare Aggressionsvermutungen, die sich hinter einem dicken Nebel der Unsicherheit verbergen (Arnswald, 2003; sowie Byers, 2002). Durch eine solche Handlungspolitik werden gleich mehrere Problemfelder tangiert:
1) Problem der subjektiven Wahrnehmung
Antizipationen und Zukunftsprognosen kommen stets auf der Grundlage des momentan vorhandenen Wissensfundus zustande (Fischer, 2003). Aufgrund der Heterogenität der Informationsquellen, die von politischen Akteuren und Beratern zur Lageanalyse herangezogen werden und die von Land zu Land durchaus unterschiedlich sein können, ist eine einheitliche Meinungsbildung nur schwer zu erreichen. Dementsprechend vielfältig können die aus den Analysen abgeleiteten Handlungsanweisungen und -empfehlungen sein. Zudem werden Informationen mit Hilfe eines ideologischen Filters verarbeitet, wodurch erhebliche Verzerrungen verursacht werden (Rochefort/Cobb, 1993: 56-69).[21] Aus diesem Grund ist die vertiefte Diskussionen in einem heterogenen Umfeld unbedingt notwendig, um allfällige subjektive Wahrnehmungsverzerrung auszumerzen. Der aus diesem Angleichungsprozess resultierende Konsens ist dann in einem gewissen Sinn gegenüber diesen subjektiven Perzeptionsfehlern immunisiert (Habermas, 1996: 284ff).
2) Problem der heterogenen Handlungsmotivation
Nicht nur die subjektive Wahrnehmung stellt ein Problem für die Praxis der unilateralen, präventiven Selbstverteidigung dar, sondern auch die heterogene Handlungsmotivation (Giddens, 1995: 168-171; Schülein, 1998: 308f) beziehungsweise das unterschiedliche Agenda-Setting der jeweiligen Regierungen (siehe dazu Kingdon, 1995: 196-205). Die Bush-Administration beispielsweise räumt dem Kampf gegen den weltweiten Terrorismus offensichtlich höchste Priorität ein. Das Gleiche muss nicht zwingend für Länder wie Indien, Süd-Afrika oder Kanada gelten. Durch unilaterales politisches Handeln wird anderen Ländern die gleiche Prioritätenrangordnung aufgezwungen, was in Anbetracht der Fülle von lokalen und regionalen politischen Problemen nur schwer gerechtfertigt werden kann.[22]
3) Problem der offenen Zukunft
Der Quantenphysiker Hans-Peter Dürr hat einmal geschrieben, “dass in Zukunft das Wahrscheinliche wahrscheinlich passiert” (Dürr, 2002: 54). Was er damit ausdrücken wollte, war die Tatsache, dass zukünftige Ereignisse nur mit Hilfe von Wahrscheinlichkeitsaussagen vorhergesagt werden können und dementsprechend vorerst nur im Bereich der Potenzialität exisitieren (Seddon, 1987: 117). Ähnliches konstatiert auch O’Shaughnessy, wenn er schreibt, dass “no event, including intended act-events, can be foretold as an absolute certainty. That sense is this: the world is known to have harboured freak happenings; this is a permanent potential of the world, and of no situation can it be sait: ‘This situation bears a charmed life, it is guarenteed not to harbour such a freak’. Therefor it migth (…) Therefore the totally aberrant can never be guatanteed not to happen” (O’Shaughnessy, 1997: 54). Handlungstheoretisch ausgedrückt heisst das, dass der Mensch stets aus einer Fülle von Handlungsoptionen wählen kann, wie er das angestrebte Ziel schlussendlich erreichen möchte (Seddon, 1987: 105). In der Applikation dieser handlungstheoretischen Feststellung auf den Anwendungsbereich der präventiven Selbstverteidigung ergeben sich zwei folgenschwere Trugschlüsse: Erstens, dass Ereignis X zum Zeitpunkt Y eintreten wird (Passives Moment). Zweitens, dass die jetzige Handlung Z zum zukünftigen Resultat U führen wird (Aktives Moment). Nun kann man mir entgegenhalten und zu Recht darauf hinweisen, dass jede Handlung, absichtlich oder unbewusst, darauf aufbaut, einen hypothetischen zukünftigen Zustand zu erreichen. Gewiss stimmt dieser Einwand. Doch es müssen auch die potenziellen Konsequenzen berücksichtigt werden und diese fallen umso gravierender ins Gewicht, je komplexer das direkt involvierte System ist. So kann beispielsweise eine Handlung in meinem unmittelbaren Familienumfeld durchaus schwerwiegende persönliche Folgen haben, jedoch wird sie kaum ein globales politisches Erdbeben verursachen. Wird jedoch das irakische Staatsgebiet, das in einem der explosivsten politischen Regionen liegt, unter dem Banner der präventiven Selbstverteidigung angegriffen, so kann diese Handlung sehr wohl schwerwiegende globale Konsequenzen nach sich ziehen. Wer nun im Alleingang darüber entscheidet, ob das Risiko der negativen Auswirkungen das Hochgefühl einer positiven Entwicklung auszustechen vermag, der handelt nicht nur arrogant, sondern spielt zugleich mit der Zukunft der ganzen involvierten Region. Aus diesem Grund, so meine ich, ist eine risikoaversive Strategie der risikoreichen stets vorzuziehen.
4) Problem der unintendierten Folgen
Jegliche Handlungen bergen das Potenzial zu unbeabsichtigten Folgen und Nebenwirkungen, die auch bei der sorgfältigsten Planung nicht vollumfänglich einkalkuliert und vermieden werden können (Stanko/Ritsert, 1994 : 97).[23] Giddens unterscheidet diesbezüglich zwischen Planungs- und Bedienungsfehler, die in der globalen, komplexen politischen Welt des 21. Jahrhunderts erhebliche Auswirkungen zeitigen können (Giddens, 1995: 188-190). Präventive Selbstverteidigung ist gerade aufgrund ihrer spekulativen Basis und ihrer ideologischen Verblendungsanfälligkeit gegenüber diesen unintendierten Folgen alles andere als gefeit. Wiederum muss der Irakfeldzug als negatives Beispiel herhalten. Die amerikanisch-britischen Streitkräfte sind in den Irak einmarschiert, um dort Massenvernichtungswaffen aufzuspüren, Saddam Hussein zu stürzen und den Terrorismus zu bekämpfen. Die optimistische Vision einer auf Freiheit und Demokratie beruhenden irakischen Nation, die auf den Pfeilern der Stabilität und Ordnung aufgebaut sein würde, war mitunter der Motivationsmotor dieses Einsatzes. Scheinbar ohne Nachkriegskonzept machte man sich daran, Saddam zu stürzen und irgendwie eine Nation aus den Trümmern der Vergangenheit zusammenzuflicken (Rüesch, 2002). Die reelle Möglichkeit, dass das befreite Land im Chaos versinken könnte und dadurch als Magnet für Freischärler, Terroristen und sonstige kriminelle Banden funktionieren würde, haben wohl die verantwortlichen Architekten dieses Feldzuges bei der Planung nicht mitberücksichtigt oder zumindest verharmlost. Ein Jahr später scheinen aber genau diese unbeabsichtigten Folgen den Nachkriegston anzugeben, was einen Journalisten der NZZ zum Kommentar veranlasst hat, dass der Versuch einer rationalen Politik im Nachkriegs-Irak auf jämmerlich Art zu versagen scheint (siehe “Terror und Verfassung im Irak”).
Eine andere unintendierte Folge der aggressiven präventiven Verteidigungstrategie ist der Umstand, dass sich just diejenigen Länder, die Amerika zähmen möchte, dazu veranlasst sehen, eine Politik des Wettrüstens zu verfolgen, um auf diese Weise einer Attacke entweichen zu können. Byers konstatiert, dass eine solche Praxis die endgültige Abkehr vom UN-System bedeuten würde, “und das Abgleiten in eine anarchische Welt, die von nachtem Machtkalkül und wechselnden Allianzen geprägt wäre” (Byers, 2002).
5) Problem der Nachahmung
Die einst in bezug auf die Gefahr der horizontalen Eskalation zu Zeiten des Kalten Krieges formulierte Kritik von Ernst Tugendhat, in der er auf die irrsinnige Logik der Abschreckungspolitik aufmerksam machte, hat mit der Strategie des Präventivkrieges wieder an Aktualität gewonnen. Tugendhat schrieb damals: “Wir werden jetzt bei jeder grösseren internationalen Krise damit rechnen müssen, dass jede Seite einen Präventivschlag der anderen befürchten und gegebenenfalls versuchen wird, ihr zuvorzukommen” (Tugendhat, 1986: 30). Die USA behalten sich das Recht vor, präventive Militärschläge eigenmächtig durchzuführen, ohne sich dabei bewusst zu sein, dass dieses Recht in keinster Weise nur auf die US-Politik beschränkt bleiben muss. Diesen Hang zum Exzeptionalismus kritisiert auch der amerikanische Politologe Benjamin Barber. Er betont, dass die USA mit ihrer Doktrin des Präventivkrieges einen folgenschweren Präzedenzfall geschaffen haben, der sich ohne weiteres auf Politik anderer Länder übertragen lässt (Barber, 2003: 107).[24] Dieser Exzeptionalismus ist auch der Kant’schen Idee der Allgemeingültigkeit und der Universalisierbarkeit des Rechts diametral entgegengesetzt. So ist die Doktrin der präventiven Selbstverteidigung in der Tat mit den normativen Kriterien der Allgemeingültigkeit und Universalisierbarkeit unvereinbar, würde doch ein allgemeingültiges Recht auf Präventivkrieg das Instrumentarium der Politik auf gefährliche Art und Weise erweitern. Eine Politik, die auf der Grundlage von Mutmassungen und Willkür funktioniert, führt direkt in den Hobbes’schen Naturzustand, in dem sich jede Person das naturgegebene Recht zur eigenmächtigen Handlung herausnimmt, ohne dabei auf die Handlungen der Mitmenschen Rücksicht zu nehmen. Die Welt würde wieder zu jenem gefährlich instabilen und unsicheren Ort verkommen, der nach dem Ende des Ost-West-Konflikts überwunden zu sein schien.
7. Schlussfolgerungen und Ausblick
Zu Beginn dieser Arbeit habe ich die Frage gestellt, inwiefern die Praxis der präventiven, antizipatorischen Selbstverteidigung als legitimes politisches Mittel angesehen werden soll, um den globalen Herausforderungen im komplexen Weltsystem entgegenzutreten, und was für mögliche Konsequenzen eine solche Praxis auf die Stabilität des internationalen politischen Systems haben könnte. Anhand der Darstellung der weltpolitischen Veränderungen seit dem Ende des Ost-West-Antagonismus sollte aufgezeigt werden, dass die Zeit der symmetrischen Konfliktaustragung endgültig vorbei zu sein scheint. Das Gesicht der neuen Kriege ist durch eine zunehmende Asymmetrisierung der Mittel gekennzeichnet, was mit dem Zerfall staatlicher Strukturen und der Auflösung des ursprünglich staatlich kontrollieren Gewaltmonopols einhergeht. Politische Realisten möchten diesen staatlichen Zerfallsprozess wenn nötig mit unilateralen militärischen Massnahmen stoppen, wobei sie sich auf die anarchische Naturzustandskonzeption von Hobbes berufen. Im Gegensatz dazu sehen die Kosmopolitisten den einzig begehbaren Weg in der multilateralen Zusammenarbeit im Rahmen des Völkerrechts. Der Präventivkrieg der Bush-Doktrin ist eine Mischform aus diesen beiden politischen Positionen: Einerseits dafür konzipiert, um das völkerrechtlich legitimierte natürliche Recht auf Selbstverteidigung in Anspruch zu nehmen, andererseits dazu entwickelt, notfalls auch im Alleingang zu handeln. Dass aber der Präventivkrieg in der Form der antizipatorischen Selbstverteidigung mit dem gängigen Völkerrecht nicht vereinbar ist, weil Unilateralismus und Exzeptionalismus mit den normativen Kriterien der Allgemeingültigkeit und Universalisierbarkeit des Rechts nicht zusammenpassen, darauf haben Philosophen, Völkerrechtler und Politologen mehrfach hingewiesen. Von einem paradigmatischen Bruch hinsichtlich der Anwendung des Völkerrechts spricht gar Véronique Zanetti, die auf die stillschweigenden Verschiebungen der völkerrechtlichen Auslegung nach 9/11 aufmerksam macht. In der Tat scheint der in Anlehnung an Carl Schmitt abgewandelte Satz von Norman Paech “Imperial herrscht, wer die Grammatik des Rechts bestimmt” (Paech, 2003b) seit gut drei Jahren die aussenpolitische Marschroute der US-Administration zu prägen.
Doch nicht nur aus völkerrechtlicher Perspektive ist der Strategie der präventiven Selbstverteidigung mit Skepsis zu begegnen. Subjektive Wahrnehmungsverzerrungen der politischen Akteure, heterogene Handlungsmotivationen, offene Zeithorizonte, unintendierte Folgen und potenzielle Nachahmungseffekte stellen eine ganze Reihe von unkalkulierbaren Risiken dar, die eine Anwendung des präventiven Verteidigungskrieges in seiner amerikanischen Fassung für das internationale politische System untragbar machen. Die Bush-Doktrin klammert sich nämlich an eine doppelte Illusion: Erstens, dass mittels unilateraler militärischer Massnahmen die Welt der Gegenwart vor zukünftigen Gefahren geschützt und zweitens, dass mittels unilateraler militärischer Massnahmen die Welt der Zukunft vor den gegenwärtigen Bedrohungen bewahrt werden kann. Es ist nicht das politische Ziel, nämlich die Etablierung von Sicherheit und die Verbreitung von Frieden, das ich kritisiere, sondern die Mittel, die zur Erreichung dieses Ziels eingesetzt werden. Terroristische Attentate werden neue militärisch-präventive Massnahmen provozieren, und diese Massnahmen dienen wiederum als Rechtfertigungsgrundlage für weitere brutale Attacken. Es ist ein teuflischer Kreislauf, der in Gang kommt und der schwer zu durchbrechen ist. Die Ursachen, die den Asymmetrien unserer Welt zugrunde liegen, werden durch militärische Einsätze nicht behoben, sondern vielleicht sogar vervielfältigt. Doch welche politische Massnahmen und Programme können als brauchbare Alternativen zur präventiven Selbstverteidigung angesehen werden?
Das Konzept der Prävention soll und muss übernommen und weitergeführt, jedoch politisch-normativ anders aufgeladen werden.[25] Benjamin Barber beispielsweise tut dies, indem er von der “präventiven Demokratie” spricht. Gemäss seinen Ausführungen geht das Konzept der präventiven Demokratie davon aus, “dass das Einzige, was die Vereinigten Staaten (und nicht nur sie, sondern Staaten der Welt) vor Anarchie, Terrorismus und Gewalt zu schützen vermag, die Demokratie selbst ist - Demokratie im Innern ebenso wie Demokratie in den Konventionen, Institutionen und Vertragsbeziehungen, die die Verhältnisse zwischen den Staaten defininieren und regeln” (Barber, 2003: 160). In eine ähnliche Richtung zielt auch Hobsbawm, der das Schicksal der Menschheit vom Wiederaufbau der öffentlichen Institutionen abhängig macht (Hobsbawm, 2000: 711). Und Mary Kaldor sieht in der “kosmopolitischen Alternative”, die sich global orientieren und “gegen geopolitische oder kurzfristige innenpolitische Interessen” (Kaldor, 2000: 181) durchsetzen muss, einen begehbaren politischen Weg, wobei sie unter Kosmopolitismus “einerseits eine positive politische Vision, die Toleranz, Multikulturalismus, Zivilität und Demokratie einbegreift” (ebd.: 182) und andererseits die rechtliche Achtung bestimmter vorrangiger universeller Prinzipien versteht. Allen diesen politischen Konzepten ist gemein, dass sie “unverzichtbare Minimalvoraussetzungen symmetrischer Politik” (Münkler, 2003: 240) auf der Basis von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie wiederherzustellen versuchen. Dabei stützen sie sich primär auf vertrauensbildende Massnahmen und lehnen eine militärische Gewaltanwendung zur Beseitigung vorherrschender Asymmetrien ab. In Anbetracht der Komplexität und der Interdependenz des internationalen politischen Systems und angesichts der unintendierten Folgen, die politische Handlungen auslösen können, scheint ein Konzept, das auf Multilateralismus, Dialog und Empathie setzt, der derzeitigen Weltlage eher zu entsprechen als eine auf Mutmassungen, Willkür und Spekulation beruhende militärische Strategie.
8. Literaturverzeichnis
8.1 Monographien
- Barber, Benjamin (2003): Imperium der Angst. Die USA und die Neuordnung der Welt. München. C.H. Beck.
- Braun, Eberhard/ Heine, Felix/ Opolka, Uwe (2000): Politische Philosophie. Reinbek bei Hamburg. Rowohlt Verlag.
- Dürr, Hans-Peter (2002): Für eine zivile Gesellschaft. Beiträge zu unserer Zukunftsfähigkeit. München. Deutscher Taschenbuch Verlag.
- Enç, Berent (2003 ): How we act. Causes, Reasons, and Intentions. Oxford. Clarendon Press.
- Giddens, Anthony (1995): Konsequenzen der Moderne. Frankfurt a.M. Suhrkamp.
- Habermas, Jürgen (1996): Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie. Frankfurt a.M. Suhrkamp.
- Hobsbawm, Eric (2000): Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts. München. Deutscher Taschenbuch Verlag.
- Kaldor, Mary (2000): Neue und alte Kriege. Organisierte Gewalt im Zeitalter der Globalisierung. Frankfurt a.M. Suhrkamp.
- Kimminich, Otto/ Hobe, Stephan (2000): Einführung in das Völkerrecht. Tübingen/Basel. Francke.
- Kingdon, John W. (1995): Agendas, Alternatives, and Public Policies. New York. Harper Collins.
- Münkler, Herfried (2003): Die neuen Kriege. Reinbek bei Hamburg. Rowohlt Verlag.
- Nohlen, Dieter (Hrsg.) (1998): Wörterbuch Staat und Politik. München. Piper.
- O’Shaughnessy, Brian (1997): “Trying (as the mental ‘Pineal Gland’)”, in: Mele, Alfred R. (ed.): The Philosophy of Action. Oxford. University Press: 53-74.
- Oeter, Stefan (1998): “Humanitäre Intervention und Gewaltverbot: Wie handlungsfähig ist die Staatengemeinschaft?”, in: Brunkhorst, Hauke (Hrsg.): Einmischung erwünscht? Menschenrechte und bewaffnete Intervention. Frankfurt a.M. Fischer Taschenbuch Verlag: 37-60.
- Schülein, Johann August (1998): “Handlungstheorie und Psychoanalyse”, in: Balog, Andreas/ Gabriel, Manfred (Hrsg.): Soziologische Handlungstheorie. Einheit oder Vielfalt. Österreichische Zeitschrift für Soziologie, Sonderband 4. Opladen. Westdeutscher Verlag: 285-314.
- Seddon, Keith (1987): Time. A Philosophical Ttreatment. New York. Croom Helm.
- Stanko, Lucia/ Ritsert, Jürgen (1994): Zeit als Kategorie der Sozialwissenschaften. Münster. Verlag Westfälisches Dampfboot.
- Todd, Emanuel (2003): Weltmacht USA. Ein Nachruf. München. Piper Verlag.
- Tugendhat, Ernst (1986): Nachdenken über die Atomkriegsgefahr und warum man sie nicht sieht. Berlin. Rotbuch Verlag.
- Von Clausewitz, Carl (1832): Vom Kriege. Achtes Buch, Kapitel 3B-6B. Ausgabe: Bonn 1980. Dümmlers Verlag.
- Zanetti, Véronique (2000): “Menschenrechte und humanitäre Interventionspflicht. Einige Argumente für die Verrechtlichung der humanitären Intervention”, in: Gustenau, Gustav (Hrsg.): Humanitäre militärische Intervention zwischen Legalität und Legitimität. Tagung des Instituts für Internationale Friedenssicherung, Wien. Baden-Baden. Nomos Verlagsgesellschaft: 93-107.
8.2 Zeitschriften- und Zeitungsartikel
- Arnswald, Ulrich: “Präventiv-Krieg oder Präemptiv-Krieg? Der Irakkrieg als Beispiel für die “Enthegung des Völkerrechts”, in: Freitag: die Ost-West-Wochenzeitung 35, 22.08.2003. Im Internet unter: http://www.uni-kassel.de/fb10/frieden/themen/ Voelkerrecht/arnswald.html (03.03.04).
- Byers, Michael: “Präventivkrieg und Selbstverteidigung im Völkerrecht. Der Irak und der Fall Caroline”, in: Le Monde diplomatique, Nr. 6852, 13.09.2002 . Im Internet unter: http://www.taz.de/pt/2002/09/13/a0040.nf/textdruck (03.03.04).
- Chomski, Noam: “Preventive War ‘the Suprime Crime’. Iraq: invasion that will live in infamy”, in: ZNnet, 11.08.2003. Im Internet unter: http://www.zmag.org/ content/showarticle.cfm?SectionID=40&ItemID=4030 (15.02.2004).
- Eigenmann, Dominique: “Amerikas Macht und Europas Kritik”, in: Tages-Anzeiger, Nr. 59 (Jg. 111), 01.03.2003: 45.
- “Ein legitimer Krieg? Oder eben nicht?”, in: Tages-Anzeiger, Nr. 255 (Jg. 111), 03.11.03: 2.
- Fischer, Horst: “Zwischen autorisierter Gewaltanwendung und Präventivkrieg: Der völkerrechtliche Kern der Debatte um ein militärisches Eingreifen gegen den Irak”, in: Humanitäres Völkerrecht - Informationsschriften, Heft 1, 2003. Im Internet unter: http://www.ruhr-uni-bochum.de/ifhv/publications/huvi/Horst%20Fischer.pfd (15.02.2004).
- Fitschen, Patrick: “Europas strategische Antwort auf die Nationale Sicherheitsstrategie der USA”, 22.07.2003. Im Internet unter: http://www.kas.de/db_files/dokumente/7_dokument_dok_pdf_2081_1.pdf+EU-Strategiepapier&hl=de&ie=UTF-8 (05.03.04).
- Friedman, Thomas L.: “Budgets of Mass Destruction”, in: The New York Times, 01.02.2004. Im Internet unter: http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F70E12FC345C0C728CDDAB0894DC404482 (01.02.2004).
- Herberg-Rothe, Andreas: “Umkämpfter Clausewitz”, in: Arbeitskreis Militärgeschichte e.V., Newsletter April 2002. Im Internet unter: http://www.akmilitaergeschichte.de/newsletter/download/zip/NL17.pdf (20.02.2004).
- Imhasly, B.: “Bushs Irak-Doktrin als Argument für Indien. Wachsende Frustration über Infiltration in Kaschmir”, in: NZZ, Nr. 234, 09.10.02.
- Kamp, Karl-Heinz: “Vorbeugende Verteidigung gewinnt Anhänger. Reaktion auf eine veränderte Bedrohungslage”, in: NZZ, Nr. 22, 28.01.04.
- Kind, C.: “Amerikas Krieg gegen den Terror. Auf dem Weg zu einem neuen Imperealismus?”, in: NZZ, Nr. 278, 29.11.2003: 87.
- Kohler, Georg (1994): “Krieg, Politik und Markt. Kants Versprechen. Überlegungen am Ende der grossen Konkurrenz”, in: Zeitschrift für Philosophische Praxis 1: 12-19.
- Matthies, Volker: “Kriesenprävention. Möglichkeiten und Grenzen”, 15.09.2002. Im Internet unter: http://www.reader-sipo.de/artikel/0209_AII1.htm (23.03.04).
- Paech, Norman (a): “Der Irak-Krieg: Abschied vom System der Kollektiven Sicherheit”, in: Sozialismus, Nr. 262 (30), Januar 2003. Im Internet unter: http://www.uni-kassel.de/fb10/frieden/regionen/Irak/paech.htm (03.03.04).
- Paech, Norman (b): “Interventionsimperealismus. Von der Monroe- zur Bush-Doktrin”, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, Nr. 10, Oktober 2003. Im Internet unter: www.uni-kassel.de/fb10/frieden/ themen/Weltordnung/paech.html (03.03.04).
- Riklin, Alois: “Gerechter Krieg?”, in: NZZ, Nr. 25, 31.01.03: 64.
- Rochefort, David/ Cobb, Roger W. (1993): “Problem Definition, Agenda Access, and Policy Choice”, in: Policy Studies Journal 21: 56-73.
- Roth, Kenneth: “UNO muss glaubwürdiger werden”, in: Tages-Anzeiger, 24.01.04.
- Rüesch, A.: “Gesagtes und Ungesagtes in der Irak-Debatte”, in: NZZ, Nr. 234, 09.10.02: 6.
- Solana, Javier: “Eine neue Ära der transatlantischen Beziehungen. Verständnisschwierigkeiten, gegenseitige Abhängigkeiten, Rückbesinnung”, in: NZZ am Sonntag, Nr. 12, 23.03.03: 12.
- “Terror und Verfassung im Irak”, in: NZZ, Nr. 53, 04.03.04: 2.
- Zanetti, Véronique: “Nach dem 11. September: Paradigmenwechsel im Völkerrecht? ”, in: DZPhil, Berlin 50 (2002) 3: 455-469.
8.3 Dokumente
- Charta der Vereinten Nationen. Amtliche Fassung der Bundesrepublik Deutschland, BGBl. 1973 II S. 431. Im Internet unter: http://www.uno.de/charta/charta.htm (03.03.04).
- Die neue Nationale Sicherheitsdoktrin der Vereinigten Staaten (NSS). Vollständige Dokumentation der Langfassung in deutscher Übersetzung. Im Internet unter: http://www.uni-kassel.de/fb10/frieden/regionen/USA/doktrin-lang.html (03.03.04).
[...]
[1] In der englischen Sprache wird zwischen “preemptive strikes” und “preventive strikes” unterschieden. Diese beiden Begriffe sind zwar auch ins Deutsche übersetzt worden, jedoch ist dadurch eine Begriffskonfusion entstanden, die auch vor den Toren der politischen Wissenschaften leider nicht halt gemacht hat. Es kann folgende Unterscheidung getroffen werden: Der Präventivkrieg stellt grundsätzlich ein antizipatorischer, auf der Basis von Mutmassungen und Spekulationen geführter Krieg dar (Chomski, 2003). Unter Präemptivschlag versteht man einen militärischen Angriff, der im Falle einer unmittelbaren Bedrohung unter Berücksichtigung spezifischer Kriterien völkerrechtlich legitimiert durchgeführt werden darf (Roth, 2004; Byers, 2002). Mittels dieser Begriffsklärung lässt sich auch der Hussein-Entmachtungskrieg ziemlich klar einordnen. So versuchte die amerikanische und die britische Regierung im Vorfeld des Irakkrieges die anstehende militärische Operation der Weltgemeinschaft als präemptiv zu verkaufen, in Tat und Wahrheit war jedoch der anschliessende Feldzug aufgrund der dürftigen Beweislage ein Präventivkrieg.
[2] Besonders erwähnenswert ist sicherlich die Europa-Initiative von Jürgen Habermas, die in Zusammenarbeit mit dem französischen Philosphen Jacques Derrida entstanden ist und der sich namhafte europäische Intellektuelle angeschlossen haben (Im Internet unter: http://www.information-philosophie.de/philosophie/europa2.html ).
[3] Siehe dazu den interessanten Briefwechsel zwischen der Politikwissenschaftlerin Margret Johannsen und dem Sicherheitsexperten Holger Mey, der im Tages-Anzeiger unter dem Titel “Ein legitimer Krieg? Oder eben nicht?” abgedruckt worden ist (Tages-Anzeiger, 03.11.03).
[4] Erst die normative Auseinandersetzung und die rechtliche Definition zwischen zulässiger und verbotener militärischer Gewaltanwendung ermöglichte die Weiterentwicklung des ‘ius ad bellum’ bzw. dessen Ergänzung mit den Rechtsprinzipien des ‘ius in bello’ (Kimminich/Hobe, 2000: 42f).
[5] In Westeuropa dauerte diese Phase der Nationenbildung fast 300 Jahre und schloss mehrheitlich im 18. Jahrhundert ab (Münkler, 2003: 74). Man muss sich jedoch vergegenwärtigen, dass mit der allmählichen Dekolonisierung Afrikas und Asiens nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und seit dem Zerfall des ehemaligen sowjetischen Reiches dieser Staatsbildungsprozess in vielen Teilen der ehemals zweiten und dritten Welt vor nicht allzu langer Zeit begonnen hat. Viele der heutigen Konflikte können mitunter auf die politischen Emanzipationsversuche dieser ehemalig unterworfenen Staaten zurückgeführt werden (siehe dazu detalliert: Hobsbawm, 2000: 433-463)
[6] Es muss darauf hingewiesen werden, dass der Begriff “Staat” stellvertretend für viele Staatsformen stehen kann. So entscheidet in einer Monarchie der König oder die Königin über Krieg und Frieden und in einer Demokratie sind es die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die indirekt, nämlich über die gewählte Exekutive, über den Kriegs- oder Friedenszustand befinden (Nohlen, 1998: 730f).
[7] Clausewitz versucht in seinem Buch zu klären, wie eine Gewalteskalation verhindert werden kann. Aus diesem Grund setzt er die Politik und die Diplomatie der Kriegshandlung bewusst voran (Herberg-Rothe, 2002). Er weist darauf hin, dass nur ein starker souveräner Staat imstande ist, den rationalen und logischen Gesetzen zu gehorchen, durch deren Befolgung eine Eskalation der Gewalt verhindert werden kann: “Im Grunde war dieser Weltteil in eine Masse von kleinen Staaten zerfallen, die teils in sich unruhige Republiken, teils kleine, in ihrer Regierungsgewalt höchst beschränkte und unsichere Monarchien waren. Ein solcher Staat war gar nicht als eine wahre Einheit zu betrachten, sondern als ein Agglomerat von locker verbundenen Kräften. Einen solchen Staat darf man sich also auch nicht wie eine Intelligenz denken, die nach einfachen logischen Gesetzen handelt” (Clausewitz, 1832: 965).
[8] Paradebeispiele solcher implodierender Staaten sind das ehemalige Jugoslawien und das bürgerkriegsgebeutelte Afghanistan.
[9] Eine solche Diagnose lässt sich nur für den westlichen Teil der Welt aufstellen. Was genau passieren würde, wenn sich die beiden Atommächte Pakistan und Indien endgültig in die Quere kämen und auf einen ernsthaften Konfrontationskurs machen würden, darüber kann hoffentlich auch in Zukunft nur spekuliert werden.
[10] Eine kurze und interessante Kritik zu Kagans Buch “Macht und Ohnmacht - Amerika und Europa in der Neuen Weltordnung” findet sich im Tages-Anzeiger vom 1. März 2003 (Eigenmann, 2003). Einer vertieften normativ-kritischen Auseinandersetzung mit Kagans Argumenten hat sich Georg Kohler in der Vorlesung “Die neue Welt(un)ordnung” verschrieben, in der er die Kagan’schen Ideen gegenüber der philosophischen Position Kants stellte.
[11] In der Charta heisst es dazu: “Aus dieser Charta kann eine Befugnis der Vereinten Nationen zum Eingreifen in Angelegenheiten, die Ihrem Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines Staates gehören, oder eine Verpflichtung der Mitglieder, solche Angelegenheiten einer Regelung auf Grund dieser Charta zu unterwerfen, nicht abgeleitet werden” (UN-Ch, Art. 2, Zif. 7).
[12] Byers fasst den Fall “Caroline” folgendermassen zusammen: “Im Jahre 1837 traten britische Truppen einer Rebellion in der damaligen Kolonie Kanada entgegen. Die Vereingten Staaten wollten zwar die Rebellion nicht direkt unterstützen, um sich nicht die Supermacht Grossbritanien zum Feind zu machen, doch konnten sie nicht verhindern, dass Amerikaner eine Privatmiliz zur Unterstützung der Rebellion bildeten. Diese Freiwilligen brachten auf einem Flussdampfer namens ‘Caroline’ Waffen und Männer zu einer Insel auf der kanadischen Seite des Niagaraflusses. Die Briten revanchierten sich mit einem nächtlichen Überfall, eroberten den Dampfer, der vor dem Fort Schlosser im Bundesstaat New York, also auf US-Territorium angedockt lag, steckten die ‘Caroline’ in Brand und schickten sie flussabwärts über die Niagarafälle. In Washington löste der Zwischenfall einige Unruhen aus (…) Die diplomatischen Protestnoten mündeten in einen Briefwechsel zwischen dem britischen Sonderbeauftragten Lord Ashburton und US-Aussenminister Daniel Webster. Die kamen überein, dass solche Angriffe nur in einem einzigen Fall gerechtfertigt seien: bei einer ‘unmittelbaren, erdrückenden Notwendigkeit der Selbstverteidigung, die kein anderes Mittel der Wahl und keinen Moment der Überlegung zulässt’ - und auch nur dann, wenn die Massnahmen nicht ‘unvernünftig oder unverhältnismässig’ ausfielen” (Byers, 2002. Hervorhebung R. van de Pol)
[13] Diesen Umstand bestätigt auch Kenneth Roth, Direktor der US-amerikanischen Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, der in einem Interview mit dem Tages-Anzeiger auf die Frage ‘ Ist eine Reform des Völkerrechts nötig, um das neuerdings von den USA reklamierte Recht, präventiv Krieg zu führen, zu regeln ?’ antwortete: “Die UNO-Charta lässt im Prinzip schon heute einen vorbeugenden Erstschlag zur Selbstverteidigung zu. Sieht sich ein Land einer unmittelbaren militärischen Gefahr ausgesetzt, muss es nicht abwarten, bis es angegriffen wird” (Roth, 2004). Gleichzeitig weist er darauf hin, dass “die Führung von Präventivkriegen, für die eben keine allgemein erkennbare unmittelbare Gefährdung geltend gemacht werden kann” (ebd.) völkerrechtlich umstritten ist. Seiner Meinung nach muss der Sicherheitsrat deshalb Richtlinien erlassen, die diesbezüglich eine klare Unterscheidung erlauben.
[14] Der Sicherheitsrat ist zwar weitgehend frei in der Interpretation einer Bedrohungslage oder eines Friedensbruchs. Jedoch wird diese Interpretationsfreiheit durch die Vetomöglichkeit der fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats wesentlich eingeschränkt (Paech, 2003a).
[15] Kamp geht sogar einen Schritt weiter, indem er die Möglichkeit ins Spiel bringt, militärische Interventionen auch auf andere politische Felder auszuweiten wie z.B. zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlage, “etwa wenn sich eine vitale Bedrohung durch ökologisch verantwortungslose Staudammprojekte oder dramatisch unsichere Kernkraftwerke in Grenznähe ergibt” (Kamp, 2004). Man stelle sich das weltpolitische Chaos bloss einmal vor, das aus dieser absurden Idee entspringt, hätte beispielsweise Russland versucht, die gigantischen chinesischen und indischen Staudammprojekte militärisch zu durchkreuzen. Der Hobbes’sche Naturzustand wäre ein biblisches Paradies dagegen.
[16] Angesichts der Tatsache, dass alle unmittelbar beteiligten Akteure beim Zeitpunkt des terroristischen Anschlages ums Leben gekommen sind, war es gar nicht möglich, die direkt Verantwortlichen zu bestrafen. Der Angriff auf Afghanistan und der Irakfeldzug kann daher als Versuch angesehen werden, dem undurchsichtigen Feind ein medial wirksames Gesicht zu geben (Kind, 2003; Chomski, 2003).
[17] Ähnlich argumentiert auch Horst Fischer. Er schreibt, dass “Staaten den Begriff des bewaffneten Angriffs so weit ausgelegt (haben), dass Ihnen eine Selbstverteidigung im Vorgriff auf bestimmte Handlungen des Gegners erlaubt bleibt” (Fischer, 2003).
[18] Auf die Gefahr des Machtmissbrauchs, die von einer solchen Praxis der Zurechtbiegung des Rechts ausgeht, weist insbesondere der amerikanische Gesellschaftskritiker Noam Chomski hin: “It is not enough for a hegemonic power to declare an official policy. It must establish it as a ‘new norm of international law’ by exemplary action. Distinguished commentators may then explain that law is a flexible living instrument, so that the new norm is now available as a guide to action. It is understood that only those with guns can establish ‘norms’ and modify international law” (Chomski, 2003; siehe auch Arnswald, 2003 sowie Paech, 2003b). Hier kann hinzugefügt werden, dass die prinzipielle Aufgabe des Rechts ja gerade im Ausgleich von Machtasymmetrien liegt. Der Kant’sche Grundsatz der Universalisierbarkeit und der notwendigen Allgemeingültigkeit von Gesetzen verdeutlicht diesen Aspekt der Symmetrisierung auf eindrückliche Art und Weise. Wird nun quasi durch die Hintertür das formale Recht durch das Gewohnheitsrecht aufgehoben bzw. verändert, so fällt auch die symmetrisierende Wirkung des formalen, kodifizierten Rechts weg.
[19] Dass das Trauma von 9/11 einen erheblichen Einfluss auf den Inhalt der NSS ausgeübt hat, glaubt auch Fitschen. Er schreibt dazu: “Die NSS vom September 2002 ist ganz unter dem Schock des 11. Septembers entstanden. Nach der Erfahrung der Verwundbarkeit auf dem eigenen Territorium durch asymmetrische Angriffe galt es eine Antwort auf die zentrale Frage der Verteidigung der eigenen Sicherheitsinteressen zu finden” (Fitschen, 2003).
[20] In der NSS wird nicht zwischen präemptiven und präventiven Massnahmen unterschieden, was von kritischen Kommentatoren als bewusste Augenwischerei angesehen wird (Riklin, 2003).
[21] Die Art und Weise wie die britischen und amerikanischen Geheimdienste die Informationen im Vorfeld des Irakfeldzuges ausgewertet haben, veranlasste einige Kommentatoren dazu, von absichtlicher Manipulation zu sprechen. Der berühmte Kolumnist der New York Times, Thomas Friedman, ging einen Schritt weiter und bezichtete die amerikanische Regierung der glaubensgesteuertern Entscheidfindung. So schrieb Friedman wortwörtlich: “It should be clear to all by now that what we have in the Bush team is a faith-based administration. It launched a faith-based war in Iraq, on the basis of faith-based intelligence, with a faith-based plan for Iraqi reconstruction, supported by faith-based tax cuts to generate faith-based revenues. This group believes that what matters in politics and economics are convition and will - not facts, social science or history” (Friedman, 2004).
[22] Dass dieses unilaterale Handeln mit dem amerikanischen Hang zum Universalismus zusammenhängt, hat Emanuel Todd aufzuzeigen und kritisch zu durchleuchten versucht. Aufgrund von demographischen Daten und innenpolitischen Analysen kommt er zum Schluss, dass die hegemoniale Stellung der USA im Weltsystem bald zu Ende geht (Todd, 2003). Es darf darüber offen spekuliert werden, inwiefern die Strategie des Präventivkrieges ein politisch motivierter Versuch darstellt, sich gegen diese Machtabgabe noch einmal mit aller Kraft zur Wehr zu setzen.
[23] Dazu der Handlungstheoretiker Berent Enç: “It is necessarily a partial picture because the generational consequences of the *results* are indefinitely many. Each ρ in turn stands in some generational relation to huge number of events. Some of these events may have been anticipated in the deliberation process and taken into account in the construction of the act plan. But many others may be expected, yet ignored; still many more may be totatlly unexpecte (…) Many of these things he did were not part of what he may have intended” (Enç, 2003: 91).
[24] Dass eine solche Gefahr des ‘spill-over’ bzw. des negativen Dominoeffekts nicht aus der Luft gegriffen ist, lässt sich daran illustrieren, dass Indien noch im Oktober 2002 mit einem Präventivschlag gegen Erzfeind Pakistan gedroht hat. Laut NZZ habe der Finanzminister Indiens, Jaswant Singh, damals erklärt, dass die Doktrin des Präventivschlages nicht ein Sonderrecht eines einzelnen Staates sein könne (Imhasly, 2002). Dass Indien und Pakistan stolz auf ihre umfangreiche Atomwaffenarsenale sind, soll hier nur am Rande erwähnt werden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptfokus dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine normativ-kritische Auseinandersetzung mit dem politischen und militärischen Konzept des präventiven Selbstverteidigungskrieges, unter Berücksichtigung breiter gesellschaftlicher Entwicklungen wie der Globalisierung und der wachsenden ökonomischen und politischen Interdependenz.
Welche Fragen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Hauptfragen: Inwiefern kann und soll die Praxis des präventiven Handelns im Sinne der "antizipierenden Selbstverteidigung" als legitimes politisches Mittel angesehen werden, um den globalen Herausforderungen in einem zunehmend komplexen Weltsystem entgegenzutreten? Welche Konsequenzen hätte eine solche Praxis auf die Stabilität des internationalen politischen Systems?
Welche Themenkomplexe sind mit den Fragestellungen verknüpft?
Die Fragestellungen sind unmittelbar mit folgenden Themenkomplexen verknüpft: Der normative Charakter der Fragestellung, der Aspekt der Legitimation politischer Mittel, die Mittel-Zweck-Relation und die Definition globaler Herausforderungen.
Wie beurteilt Herfried Münkler die Veränderungen in der Kriegsführung?
Herfried Münkler untersucht die politischen und militärischen Veränderungen in der Kriegsführung der letzten 400 Jahre und betont die Bedeutung der territorialen Grenzziehung und der Entstehung von Nationalstaaten für die Entwicklung des Krieges.
Welche Rolle spielt das Gewaltmonopol des Staates in Bezug auf Krieg und Frieden?
Der souveräne Staat besitzt das alleinige und ungeteilte Gewaltmonopol und entscheidet letztinstanzlich über Krieg und Frieden. Dieses Konzept der Souveränität ist zum Wesensmerkmal des Staates geworden und hat die Entwicklung des Völkerrechts wesentlich beeinflusst.
Was sind die Hauptmerkmale der neuen Kriege?
Die neuen Kriege sind asymmetrisch und globalisiert. Sie gehen mit der Fragmentierung des Staates einher und erstrecken sich über längere Zeitperioden ohne explizite politische Ziele. Die Akteure sind nicht mehr nur souveräne Nationalstaaten, sondern auch parastaatliche und private Akteure.
Welche gegensätzlichen Positionen gibt es in Bezug auf militärische Gewaltmassnahmen?
Es gibt einerseits politische Idealisten/Kosmopolitisten, die auf die Einhaltung des Völkerrechts beharren und militärische Gewalt nur in Notsituationen billigen. Andererseits gibt es politische Realisten, die mit militärischen Massnahmen auf neue Bedrohungen reagieren möchten.
Wie steht das Völkerrecht zum Präventivkrieg?
Das Völkerrecht verbietet grundsätzlich den Krieg und die Gewaltanwendung, erlaubt aber die individuelle und kollektive Selbstverteidigung bei bewaffneten Angriffen. Der Präventivkrieg wird unter diesem Aspekt als völkerrechtswidrig angesehen, da er die temporale Verbindung zwischen Aktion und Reaktion aufhebt.
Was ist die Caroline-Klausel?
Die Caroline-Klausel legitimiert den militärischen Erstschlag bei einer unmittelbaren Kriegsgefahr, wenn es keine andere Wahl der Mittel mehr gibt und alle Verhandlungsoptionen ausgeschöpft worden sind.
Welche Auswirkungen hatte der 11. September 2001 auf das Völkerrecht?
Véronique Zanetti argumentiert, dass es nach den Terroranschlägen auf die USA de facto eine Verschiebung der Anwendung des Völkerrechts gegeben hat, die einem Paradigmenwechsel gleichkommt, insbesondere hinsichtlich der Definition bewaffneter Angriffe und des Rechts auf Selbstverteidigung.
Was besagt die Bush-Doktrin?
Die Bush-Doktrin, formuliert in der "Nationalen Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten" (NSS), behält sich das Recht vor, antizipatorische Selbstverteidigungsmassnahmen notfalls auch unilateral durchzuführen.
Welche Gefahren birgt die Antizipation im Kontext des Präventivkrieges?
Die Gefahren der Antizipation liegen im Problem der subjektiven Wahrnehmung, der heterogenen Handlungsmotivation, der offenen Zukunft, der unintendierten Folgen und der Gefahr der Nachahmung.
Welche Alternativen gibt es zum Präventivkrieg?
Als Alternativen werden die "präventive Demokratie" (Benjamin Barber), der Wiederaufbau öffentlicher Institutionen (Hobsbawm) und die "kosmopolitische Alternative" (Mary Kaldor) genannt, die auf Multilateralismus, Dialog und Empathie setzen.
- Citar trabajo
- Robert van de Pol (Autor), 2004, Die Manipulation der Gegenwart durch die Vorwegnahme der Zukunft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109383