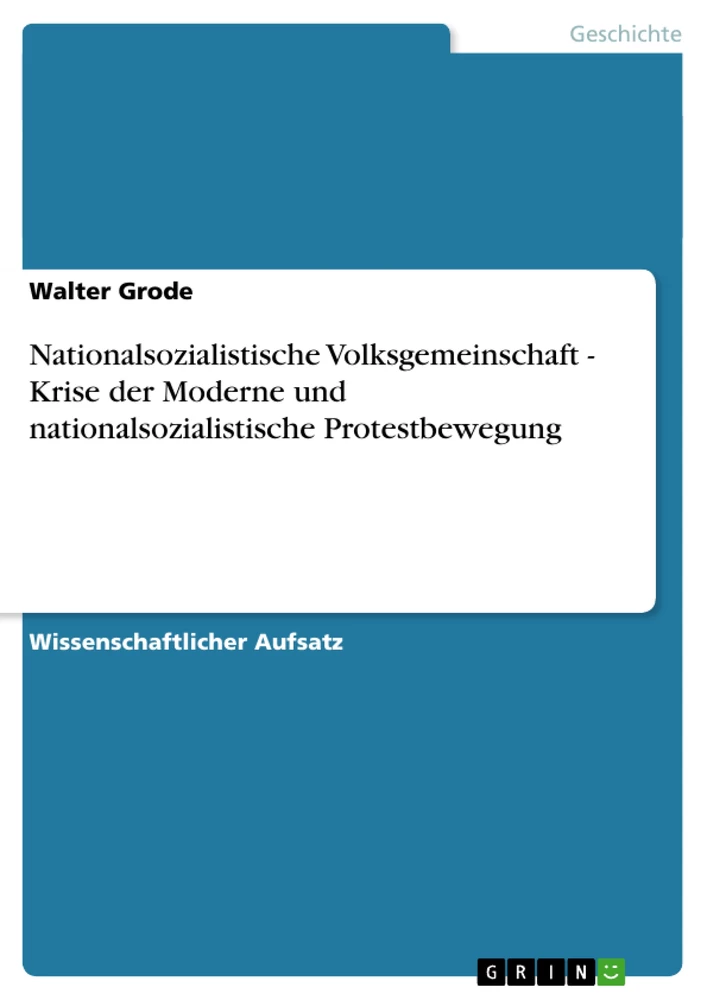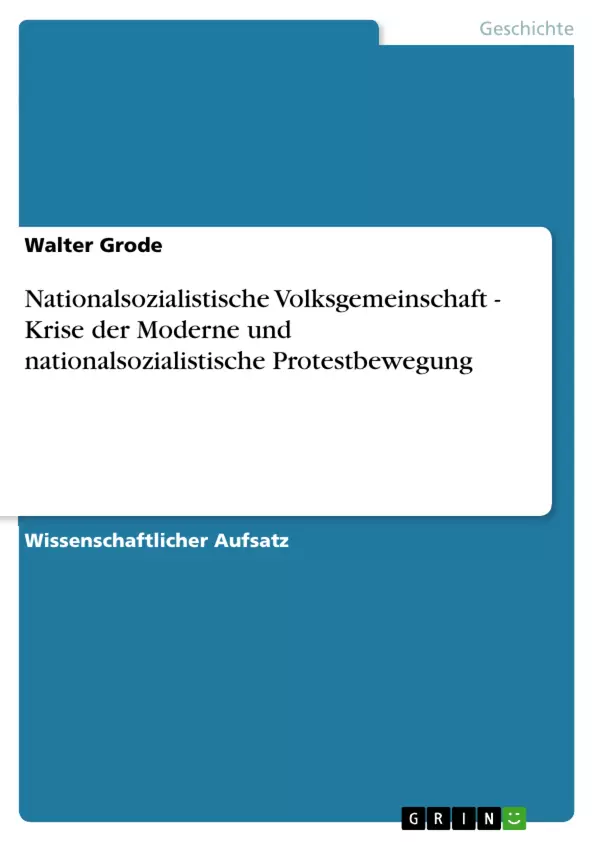Der Ende des 19. Jahrhunderts einsetzende Modernisierungsprozeß der westlichen
Industriegesellschaften hatte sich im Deutschland der zwanziger Jahre unverblümter
durchgesetzt als in anderen Ländern.
Die Zeit der Weimarer Republik stand im krisenhaft akzentuierten Schnittpunkt epochaler
soziokultureller Neuerungen. Sie bildete den Höhepunkt jener klassischen Moderne, die sich
um die Jahrhundertwende zu entfalten begonnen hatte. 1 In ihr entstanden die Züge unserer
gegenwärtigen Lebenswelt, erfolgte der Durchbruch der modernen Sozialpolitik, Technik,
Naturwissenschaft, der Humanwissenschaften und der modernen Kunst, Musik, Architektur
und Literatur. In den knapp 14 Jahren wurden nahezu alle Möglichkeiten der modernen
Existenz durchgespielt. Zugleich geriet die klassische Moderne in ihre Krisenjahre. Der
allgemeinen Durchsetzung folgten Problematisierung, Zurücknahme und Zusammenbruch.
Dieses Experiment der Moderne fand unter denkbar mißlichen Rahmenbedingungen statt.
Mehr als 30 Jahre laborierten das weltwirtschaftliche und das weltpolitische System an einer
Strukturkrise, deren Tiefpunkte die große Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1933 und der
Zweite Weltkrieg darstellten. Das besonders stark gehemmte Wirtschaftswachstum nach dem
Ersten Weltkrieg verengte die Handlungsspielräume für jene Kompromisse und
Kompensationen, die die politischen und sozialen Neuerungen der Weimarer Republik für die verschiedensten Bevölkerungsgruppen akzeptabel gemacht hätten. Wo es nicht nur keine
Zuwächse zu verteilen gab, sondern sogar Abstriche an der Substanz vorgenommen werden
mußten, radikalisierten sich alle Verteilungskämpfe und vertieften sich die Segmentierungen
und Polarisierungen der Gesellschaft, in der sich zum Schluß nur noch ebenso unversöhnliche
wie für sich genommen handlungsunfähige gegnerische Lager gegenüberstanden.
[...]
Inhalt
Erlebte Wirklichkeit der NS-Volksgemeinschaft
Alltagserfahrungen von "Normalität im Dritten Reich"
ANMERKUNGEN
LITERATURVERZEICHNIS
Der Ende des 19. Jahrhunderts einsetzende Modernisierungsprozeß der westlichen Industriegesellschaften hatte sich im Deutschland der zwanziger Jahre unverblümter durchgesetzt als in anderen Ländern.
Die Zeit der Weimarer Republik stand im krisenhaft akzentuierten Schnittpunkt epochaler soziokultureller Neuerungen. Sie bildete den Höhepunkt jener klassischen Moderne, die sich um die Jahrhundertwende zu entfalten begonnen hatte. 1 In ihr entstanden die Züge unserer gegenwärtigen Lebenswelt, erfolgte der Durchbruch der modernen Sozialpolitik, Technik, Naturwissenschaft, der Humanwissenschaften und der modernen Kunst, Musik, Architektur und Literatur. In den knapp 14 Jahren wurden nahezu alle Möglichkeiten der modernen Existenz durchgespielt. Zugleich geriet die klassische Moderne in ihre Krisenjahre. Der allgemeinen Durchsetzung folgten Problematisierung, Zurücknahme und Zusammenbruch.
Dieses Experiment der Moderne fand unter denkbar mißlichen Rahmenbedingungen statt. Mehr als 30 Jahre laborierten das weltwirtschaftliche und das weltpolitische System an einer Strukturkrise, deren Tiefpunkte die große Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1933 und der Zweite Weltkrieg darstellten. Das besonders stark gehemmte Wirtschaftswachstum nach dem Ersten Weltkrieg verengte die Handlungsspielräume für jene Kompromisse und Kompensationen, die die politischen und sozialen Neuerungen der Weimarer Republik für die verschiedensten Bevölkerungsgruppen akzeptabel gemacht hätten. Wo es nicht nur keine Zuwächse zu verteilen gab, sondern sogar Abstriche an der Substanz vorgenommen werden mußten, radikalisierten sich alle Verteilungskämpfe und vertieften sich die Segmentierungen und Polarisierungen der Gesellschaft, in der sich zum Schluß nur noch ebenso unversöhnliche wie für sich genommen handlungsunfähige gegnerische Lager gegenüberstanden.
Was den herrschenden Klassen hingegen notwendig war, erschien, so analysiert es Peter Brokmeier, als "die Quadratur des Kreises: Die Stillegung des sozialen Grundkonflikts unter Beibehaltung der gegebenen ökonomischen Strukturen."2 Weimar sei eine "Klassengesellschaft im Übergang" gewesen, und die Arbeiterschaft habe das Klassenbewußtsein zunehmend abgestreift, schreibt Heinrich August Winkler und fügt hinzu, daß die zeitgenössische Arbeiterkultur, so bestechend sie war, nur von einer kleinen Gegenelite gepflegt und von einer klassenübergreifenden Massenkultur zurückgedrängt worden sei. Die politischen Lager seien gutenteils quer zur sozialen Schichtung verlaufen, Weimar somit eine mehrfach "gespaltene Gesellschaft" gewesen.3 Dies wäre um so mehr von dem im Modernisierungsprozeß zerriebenen Bürgertum zu sagen, das angesichts des quantitativen Rückgangs der Industriearbeiterschaft und des Aufstiegs der Angestellten, zur eigentlich tragenden Schicht, zum wichtigsten Wählerreservoir der NSDAP wurde.
Jedes einzelne Krisensymptom in Deutschland fand sich auch in den anderen Ländern der modernen westlichen Industriegesellschaft. Insofern ist die deutsche Krise paradigmatisch. Aber in Deutschland hatte sich der Modernisierungsprozeß in den zwanziger Jahren brutaler durchgesetzt als in anderen Ländern. Es hatten sich nicht nur seine Lichtseiten besonders faszinierend ausgeprägt, sondern auch seine Schattenseiten besonders bedrückend auf die ohnehin deprimierende Alltagserfahrung gelegt. Geprägt von Krieg, Niederlage, Legitimationsverlust alter Werte, Inflation und Weltwirtschaftskrise, die 1932 mehr als sieben Millionen Deutsche arbeitslos gemacht hatte.
Die Verknüpfung dieser einzelnen Krisenfaktoren zu einer allumfassenden Krise der politischen Legitimation und der sozialen Wertsysteme war einzigartig in dieser Zeit und in diesem Land. Aus dieser umfassenden Krise schien es für die Deutschen keinen bekannten Ausweg zu geben, weder auf dem gewohnten Pfade des sozialen und politischen Handelns noch in der individuellen Perspektive des eigenen Lebenswegs. Die nationalsozialistische Bewegung indes hatte für alle individuellen und gesellschaftlichen Brüche der Moderne eine universelle Erklärung: Sie trat an als eine Protestbewegung gegen die Moderne; denunzierte die Moderne und projizierte die Ängste der tatsächlichen oder vermeintlichen Modernisierungsverlierer auf das Phantom einer jüdischen Rasse.
Dies gelang den Nationalsozialisten auch und gerade deshalb, weil die Juden ja in der Tat einen großen Beitrag zur Kultur der Zeit geleistet hatten. Die Spannung von Tradition und Modernisierung, von Sonderbewußtsein und Assimilationsdruck setzte bei ihnen ein bedeutendes Potential schöpferischer Kräfte frei, aber die rasch in den Vordergrund gerückte Stellung der jüdischen Minderheit im kulturellen Leben stieß in der neuen, ihrer selbst unsicheren Weimarer Republik auf antisemitische Ressentiments, die schon im religiös und ökonomisch getönten Nationalismus des Zweiten Reichs starke Wurzeln besaßen. Es beeinträchtigte Wirkung und Integration der Kultur von Weimar ganz besonders, daß sie als Werk >undeutscher< Kräfte gescholten und mit jenen antisemitschen Stereotypen belegt wurde, gegen die rationale Argumente wirkungslos waren: man diffamierte die Juden als Repräsentanten einer antinational-kosmopolitischen Zivilisation, als wurzellose und destruktive Kritiker, als Gegensatz zum "schöpferischen" deutschen Geist.4
Die allermeisten Juden waren seit vielen Generationen, mit allen Fasern ihrer Existenz in deutscher Sprache und Kultur verwurzelt. Dies bewirkte, daß sie "weitaus mehr als Deutsche denn als Juden"5 an der deutschen Kultur teilnahmen, und daß diese Beiträge zur deutschen Kultur durchweg weder in inhaltlicher noch in formaler Hinsicht einen spezifisch jüdischen Charakter trugen. In diesem Zusammenhang waren sie durchaus nicht nur Objekte einer gegen sie gerichteten Politik, sondern Subjekte des historischen Prozesses, Mithandelnde und Mitgestaltende der deutschen Geschichte. Gewiß, sie waren eine Minderheit, und es gab Spannungen und Konflikte, es gab Antisemitismus, aber sie fühlten sich in ihrer überwiegenden Mehrheit weder in der wilhelminischen Zeit noch in der Weimarer Republik als gesellschaftliche Außenseiter.6
Die anderthalb Jahrhunderte zwischen dem Beginn des Emanzipationszeitalters und der >Machtergreifung< der Nationalsozialisten waren für die jüdische Bevölkerung eine Zeit des sozialen Aufstiegs und staunenswerter Leistungen in sehr vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens.7 Dennoch ist es den Juden während dieser Zeit nicht gelungen, vollständig akzeptiert zu werden. Sie blieben im besonderen Sinne Außenseiter - nämlich nicht am Rand, sondern im Zentrum der Gesellschaft. Man empfand sie deshalb desto mehr als Fremde, als Eindringlinge, die irritierten, vor denen man ein diffuses Gefühl der Angst hatte. Widerstände, Diskriminierungen und offene Feindschaft waren an der Tagesordnung. Die konservativen Kreise, namentlich Adel, Geistlichkeit, Landwirtschaft und Kleinbürgertum, das heißt die Teile der Bevölkerung also, die an Kapitalismus und Industrie keinen oder nur wenig Anteil hatten, betrachteten mit zunehmender Unruhe die Entwicklung, die manche Juden in der Wirtschaft, besonders im Bank- und Börsenwesen, in der Presse und in der Politik, hervortreten ließ. Die aufkommende "antikapitalistische Sehnsucht" als Ausdruck eines Unbehagens an der Modernität in der Verbindung mit den ursprünglich theologisch-religiösen Wurzeln der Judenfeindschaft und dem Neid auf den Erfolg der Juden im Wirtschaftsleben führte dazu, daß in konservativen Kreisen schließlich die Juden als Haupturheber aller "zersetzenden" und "materialistischen" Ideen und als eine Gefahr für die deutsche Kultur angesehen wurden.
Dieser neue Antisemitismus, wie er sich bereits seit der zweiten Hälfte der siebziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts in Deutschland entwickelte, hatte mit einer spezifischen Art jüdischer Existenz nur noch wenig zu tun. Seine Anhänger und Propagandisten glaubten in der "Judenfrage" den Schlüssel gefunden zu haben, der ihnen den Zugang zum Verständnis aller politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Probleme der Zeit öffnete.8
Was den angeblich unverhältnismäßig hohen Anteil und übergroßen Einfluß der Juden auf den kulturellen Wandel angeht, so sind dies Übertreibungen, die geeignet waren, die Juden als Verkörperung des Bösen zu denunzieren. Besonders unsinnig war die speziell während der Weimarer Republik stereotyp vorgebrachte Behauptung, die Juden seien besonders begierig auf Experimente und Neuerungen in Kunst und Literatur, weil ihr Judentum, sprich ihre "Wurzellosigkeit" oder ihr "Intellektualismus", sie dazu prädestiniere. Es hat zwar Juden gegeben, die in der vordersten Reihe der kulturellen Avantgarde standen. Das waren aber nur Ausnahmen. Die Mehrzahl der deutschen Juden verhielt sich angepaßt. Sie schwammen wie die Nichtjuden unauffällig im Strom der deutschen Kultur, verhielten sich bürgerlich rechtschaffen, waren konservativ in den politischen Anschauungen, konventionell im Geschmack und patriotisch in ihren Überzeugungen.
Eine wirkliche Rolle im Kulturbetrieb haben die Juden nur dort gespielt, wo es um das geschriebene und gesprochene Wort ging. Dies ist insofern erklärbar, als hier, im Gegensatz zur bildenden Kunst, Traditionen und Erfahrungen fortwirkten, die jedem Juden von Kindheit an vertraut waren, selbst wenn er nichts mehr vom Judentum wußte und sich von diesem entfernt hatte. Für Verlage, Zeitungen, Zeitschriften oder Theater entwickelten Juden eine klar erkennbare Vorliebe. Der Kultursektor war eines der wenigen Felder, wo Juden ohne einer studentischen Verbindung angehört zu haben und ohne Reserveoffizier zu sein, aktiv werden und Karriere machen konnten. Hinzu kam, daß für Juden vielleicht Publizistik und Theater die Freiräume in der in ihren Strukturen festgefügten deutschen Gesellschaft waren, die es unabhängigen Geistern möglich machten, sich zu artikulieren und moderne und zukunftsweisende Ideen zu propagieren. 9
Bereits der deutschen Gesellschaft des Kaiserreichs hatten die Kräfte gefehlt, um das relativ plötzlich entstandene antisemitische Potential der Gründerjahre wieder abzubauen - im Gegenteil: Die Vorurteile konnten sich verfestigen und wurden in zunehmendem Maße durch andere Positionen imperialistischer, nationalistischer, militaristischer und sozialdarwinistischer Art weiter abgestützt und verstärkt. So entwickelte sich ein weitgehend unkontroverser, gewissermaßen "überparteilicher" und selbstverständlicher Antisemitismus, der keiner besonderen Rechtfertigung mehr zu bedürfen schien, nicht auffällig militant auftrat, dafür aber fast die gesamte Gesellschaft - mit Ausnahme der organisierten Arbeiterschaft - um so nachhaltiger durchdrang. Selbst Mitglieder und Anhänger liberaler Parteien gehörten nicht selten Vereinen oder Verbänden an, die keine Juden als Mitglieder duldeten.
Die Juden galten als die Pioniere der Veränderung und des Bruchs mit der Tradition; sie wurden als die eigentlichen Nutznießer des >Weimarer Systems< betrachtet und insbesondere auch deshalb von den Nationalsozialisten zum Ausgangspunkt ihrer antimodernen Gegenutopie gemacht. Daß dann später aus dieser antimodernen Utopie der Nationalsozialisten ein Konzept der Modernisierung durch Destruktion werden konnte, lag in dem wahnhaft-utopischen Charakter des Projekts, eine >ideale< und zudem antihistorische Gemeinschaft herbeizwingen zu wollen. 10 Deshalb war in der neuen nationalsozialistischen Welt, die die Natur (und die Nation) zur neuen politischen Religion gemacht hatte und beseelt war vom Glauben an Perfektion und quasi-paradiesische Vollkommenheit, an eine allgemeine Volksgesundheit, an soziale Hygiene und rassische Homogenität, kein Platz für rassische und soziale Außenseiter.
An der allgemeinen Stoßrichtung derart vager Vorstellungen war nichts NS- oder Hitler-Spezifisches.11 Derartiges Gedankengut war in der extremen Rechten bereits allgemein verbreitet, bevor die NSDAP den völkisch-nationalistischen "Markt" eroberte. Entscheidend dafür, daß die NSDAP eine so große Anhängerschaft gewinnen konnte, war weniger eine spezifisch nationalsozialistische Lehre als die Art und Weise, in der jene Ängste, Phobien und nebulösen Erwartungen artikuliert und öffentlichkeitswirksam präsentiert wurden, die nicht nur unter den traditionellen Anhängern der völkischen Rechten, sondern in der Bevölkerung insgesamt weit verbreitet waren. So basierte die NS-Propaganda, die sich formal aller Möglichkeiten moderner Massenkommunikation bediente, inhaltlich auf einem simplen Schwarz-Weiß-Schema: Stereotype Feindbilder wurden einer nur vage beschriebenen Utopie einer homogenen und konfliktfreien >Volksgemeinschaft< gegenübergestellt.12 Auf diese Weise wurde vermieden, in der Propaganda allzu konkrete Aussagen über die Ziele der NS-Politik zu machen. Denn trotz bestimmter spektakulärer Kampagnen trug die NS-Propaganda insgesamt eher den Charakter einer ständigen Berieselung, vergleichbar mit der alltäglichen Werbung eines führenden Waschmittelkonzerns, der nicht mehr auf spektakuläre Weise auf sein Produkt aufmerksam machen muß, sondern lediglich durch alltägliche Präsenz die Führungsrolle seine Marke sichern will.13
Innerhalb der nationalsozialistischen Ideologie und Propaganda spielte das antisemitische Motiv zu jedem Zeitpunkt die zentrale Rolle. Dabei knüpften die Nationalsozialisten an traditionelle Vorurteile und an Fremdenhaß an, indem sie >den Juden< in einer abstoßenden Karikatur als parasitäre Existenz darstellten und das Bild einer allmächtigen jüdischen Verschwörung entwarfen. Dieses stereotype Feindbild wurde in den innenpolitischen Auseinandersetzungen der Weimarer Zeit zunächst gegen "Marxisten und Finanzkapital" eingesetzt; nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten diente es der Ausgrenzung und Stigmatisierung der jüdischen Minderheit; während des Zweiten Weltkriegs rückte der Kampf gegen eine >internationale kommunistisch-plutokratische Weltverschwörung< in das Zentrum der Propaganda.
Die Propagandatechniken, mit die NSDAP die Massen für sich zu gewinnen verstand, hätten jedoch kaum zu einem Erfolg geführt, wenn das Wählerpotential den Nationalsozialisten und ihrer politischen "Alternative" nicht aufgrund äußerer Bedingungen zugefallen wäre. Ohne die Wirtschafts- und die immer kritischer werdende Regierungs- beziehungsweise Staatskrise und ohne die Auflösungstendenzen bei den liberal-konservativen bürgerlichen Parteien hätte dieses riesige "Marktsegment" nicht zur Verfügung gestanden; Hitler hätte weiterhin nur dem Geschmack einer Minderheit entsprochen und wäre im Bereich der Politik eine unbedeutende, verrückte Randerscheinung geblieben.
Die vielfältigen, innerhalb der NS-Bewegung aktiven Interessengruppen, die praktisch alle Teile der Gesellschaft (von den Jugendlichen und Frauen, über die Arbeiter und Bauern, Studenten, Ärzte, Anwälten und Verwaltungsbeamten bis hin zu den Lehrern und Professoren) für die diversen Parteigliederungen zu vereinnahmen suchten, bezogen ab 1929/30 die "große Idee" des Nationalsozialismus auf spezifische Gruppen- und materielle Interessen. Daß die Menschen sich vom Nationalsozialismus angezogen fühlten, lag daher nicht einfach - oder auch nur in erster Linie - an Hitler selbst, sondern hatte vielfältige individuelle Gründe. So war beispielsweise die Mehrheit der Weimarer Richter kaisertreu und antirepublikanisch geblieben. Zudem hatten Nachkrieg, Inflation und Herabsetzung der ohnehin bescheidenen Bezüge ihr gewohntes bürgerliches Lebensniveau erheblich gebeutelt und ihr Selbstwertgefühl beschädigt.14
Die Vorzüge der "Idee" bestanden selbst für die oberen Ränge der Partei zu einem Großteil gerade in der Unschärfe ihrer Formulierung. Statt sich für spezifische Punkte eines ausgearbeiteten Aktionsprogramms einsetzen zu müssen, konnte man sich fanatisch für eine in weiter Ferne gelegene, utopische Zukunftsvision ereifern. Hitler verstand es besser als andere, die ähnliche Ansichten artikulierten, in Menschen, die ihm begegneten eine gewisse Anfälligkeit für seine "Botschaft" mitbrachten, das Bild von der heroischen Zukunft eines erneuerten deutschen Volkes zu erwecken. Dazu müsse allerdings die alte Ordnung erst einmal völlig zerstört werden. Er riß Millionen von Menschen, die sich zu ihm hingezogen fühlten, durch die Überzeugung mit, daß er der einzige sei, der mit Hilfe seiner Partei die gegenwärtige Not beenden und Deutschland zu neuer Größe führen könne. Das Bild, das er von der Zukunft malte, versprach allen große Vorteile - solange sie >rassisch gesund< waren; gleichzeitig sollten jene >Schädlinge<, die das Volk bisher "ausgepreßt" hatten, nicht nur verjagt, sondern völlig vernichtet werden.
Erlebte Wirklichkeit der NS-Volksgemeinschaft
Hitler erklärte die Zusammenführung von Bürgertum und Proletariat, der >Arbeiter der Stirn< und der >Arbeiter der Faust< zur >lebendigen Theorie der Volksgemeinschaft<. Instinktsicher reagierte er damit auf einen verbreiteten, im Zeichen der Wirtschaftskrise noch wachsenden Hunger nach sozialer Integration.15 Jedoch waren die eindringlichen - und offensichtlich auch eingängigen - Forderungen nach gesellschaftlicher Harmonisierung für Hitler kein Selbstzweck. Sie standen zwar häufig im Kontext ebenso simpler wie historisch überholter Vorstellungen von einer starren sozialen Ordnung, ihr eigentlicher politischer Sinn lag jedoch darin, daß Hitler in der >völkischen< Konsolidierung die Voraussetzung rassenimperialistischer Machtentfaltung erblickte. Für das Individuum oder gar für dessen Anspruch auf Selbstverwirklichung war in diesem Komplex kein Platz.
Retrospektive Interpretationen des Wesens der entwickelten NS-Volksgemeinschaft gehen weit auseinander.16 Jedoch zeigen bereits Hitlers frühe Äußerungen deutlich eine Tendenz, die angestrebte >Volksgemeinschaft< in erster Linie als eine Leistungsmaschine zu verstehen. In seinem oft wiederholten Bekenntnis zu diesem Konstrukt völkischer Ideologie trafen rassenbiologische Vorstellungen, Antisemitismus und Lebensraum-Idee zusammen: Nur als eine homogene und willensstarke, von allen inneren Auseinandersetzungen und Schwächen befreite Volksgemeinschaft, so Hitlers These, werde Deutschland schließlich in der Lage sein, sich seiner äußeren Feinde zu erwehren und den erforderlichen Lebensraum zu erobern. Politische >Gleichschaltung<, Unterdrückung gesellschaftlicher Konflikte und rassische Reinigung galten als Voraussetzung für die erfolgreiche territoriale Expansion - und diese wiederum als Garant einer völkischen Zukunft.
Gleichwohl wäre es verfehlt, die Innenpolitik des Regimes allein oder auch nur in erster Linie vor der Folie der außenpolitischen Leitidee des >Führers< zu betrachten; vielmehr gilt es, die von den Zeitgenossen erlebte Wirklichkeit der >Volksgemeinschaft< mit der sich dem Zeithistoriker erschließenden Gesamtentwicklung seit 1933 kritisch vermittelnd in den Blick zu nehmen. Dabei zeigt sich dann zum Beispiel, daß die nach der Ausschaltung der Parteien und der Gewerkschaften verhältnismäßig rasch und systematisch einsetzenden Bemühungen des Regimes um die >Gewinnung des deutschen Arbeiters< durchaus nicht ohne Erfolg geblieben sind.17 Fast ebenso stark wie der polizeistaatliche Terror, sorgten suggestive Propaganda, verblüffende beschäftigungspolitische und bald auch erste außenpolitische Erfolge dafür, daß die Bereitschaft sich dem Zug der >neuen Zeit< anzuschließen - oder doch das Gefühl, sich ihm nicht mehr entgegenstellen zu sollen -, auch bei jenen wuchs, gegen deren politische Überzeugungen und Interessen das Regime angetreten war.
Zentrale Elemente dieses gesamtgesellschaftlichen Formierungsprozesses waren eine bis dahin nicht gekannte, alle technischen und organisatorischen Möglichkeiten nutzende unentwegte Mobilisierung der Menschen und, damit zusammenhängend, die Inszenierung eines beispiellosen "Führer-Mythos". Damit realisierten Hitler und Goebbels zugleich auf romantisch-konservativer Erlöserträume des 19. Jahrhunderts.18 Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, von welch außerordentlicher Bedeutung diese konsequente Idealisierung Hitlers für die immer wieder neu zu stiftende Akzeptanz des Regimes gewesen ist;19 die Projektion sämtlicher Erfolge, Erwartungen und Sehnsüchte auf den >Führer< war Bedingung und Kalkül der charismatischen Herrschaft.
Das >Dritte Reich< durchlief unter dem Blickwinkel der Erfahrungsgeschichte seit Mitte der dreißiger Jahre eine Phase konsolidierter Herrschaft,20 in der sich die Ideologie der Volksgemeinschaft für weite Teile der Bevölkerung, auch der Arbeiterschaft, als tragfähig und sogar als attraktiv zu erweisen schien. Nach den Vorstellungen der DAF-Führer stellten die Beseitigung des "Klassenkampfes" und an seiner Statt die Einrichtung der >Betriebsgemeinschaft< aus Beschäftigten und Arbeitgebern in jedem Betrieb eine der zentralen ideologischen und praktisch-politischen Zielsetzungen der nationalsozialistischen Arbeiterpolitik dar. Interessengegensätze und betriebliche Konflikte, für die die Arbeitskämpfe und das Gegeneinander von Gewerkschaften und Betriebsräten auf der einen Seite und von Arbeitgeberverbänden und Betriebsleitungen auf der anderen Seite standen, sollten abgelöst werden von dem harmonischen Miteinander von >Betriebsführer< und >Gefolgschaft<, die zudem beide in demselben Verband organisiert waren.21
Zudem spielten die wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung und die (letztlich bescheiden) wachsenden Konsummöglichkeiten bei der nationalsozialistischen Integrationspolitik eine zentrale Rolle, wichtiger aber noch war das veränderte Lebensgefühl: Die große Mehrheit der Deutschen glaubte inzwischen an nationalen "Wiederaufstieg" und individuelle Aufstiegschancen, an künftige Größe und an ein besseres Leben für sich selbst und die kommenden Generationen. Der permanente sozialpolitische Aktionismus22 und eine egalitäre Propaganda (von der Geburtenförderung über die >Kraft-durch-Freude<-Reisen bis zum kollektiven "Eintopfessen") stifteten "affektive Integration"23 und trugen dazu bei, daß die Entkopplung von Lohn und Status 24 funktionierte. Massenhaft wurde in den sogenannten Friedensjahren soziales Bewußtsein verändert, wurden Klassen- und Standesdünkel delegitimiert und mentale Sperren aus dem Weg geräumt.25 Die auf diese Weise produzierte Regimeloyalität erzeugte ihrerseits eine Dynamik psychosozialer Kraftentfaltung, die sich als äußerst funktional im Sinne der NS-Ideologie erwies - nicht zuletzt dann im Rahmen der Kriegführung und in den besetzten Gebieten.
Das destruktive Potential der nationalsozialistischen >Volksgemeinschaft< kam allerdings nicht erst während des Krieges zum Vorschein; Abgrenzung und Aggressivität gegenüber allem Fremden, Abweichenden oder für feindlich Erklärten, nach innen wie nach außen, war immer Teil dieses herrschaftsgesteuerten Integrationskonzepts, und als solches war es mit der völkischen Rassenideologie unauflöslich verknüpft. Rassismus war gleichsam sein Fundament.
Der gemeinsame Nenner aller Formen des NS-Rassismus war die Klassifikation und Behandlung bestimmter Menschengruppen als "Minderwertige". Der nationalsozialistische Rassismus schloß von ausgewählten, wirklichen oder angeblichen Unterschieden zwischen Menschen - physischen, psychischen, geistigen, also sozialkulturellen Unterschieden - auf ihre Ungleichheit im Sinne einer Wert-Hierarchie, wobei Minderwertigkeit an den sozialen und kulturellen Normen der angeblich wertvolleren Gruppe gemessen wurde. Er verweigerte den wirklich oder angeblich "Fremden" und "Anderen" nicht nur das Recht auf Gleichheit, sondern vor allem das Recht auf Freiheit: das Recht, "anders" zu sein oder zu scheinen, ohne deshalb diskriminiert zu werden. Auf diese Weise bildete sich auch im Bewußtsein der Bevölkerungsmehrheit ein latenter Antagonismus von "gesunder Normalität" und "Ausmerze" heraus.26 Die gleiche Dynamik von Integration und Segregation lag der gesamten NS-Sozialpolitik zugrunde.27 Die Politisierung und politische Realisierung solcher Klassifikation, Behandlung und Radikalisierung dieser Politik bis hin zum Massenmord war in all ihren Stadien das Novum, Unikum und Spezifikum des Nationalsozialismus.
Daß die >Volksgemeinschaft< eine exklusiv >arische< sein sollte, hatten Hitler und die Seinen den Deutschen in der >Kampfzeit< schon hinreichend bekanntgemacht; nach 1933 mußten darüber nicht mehr viele Worte verloren werden. Auch daß politische Dissidenz oder gar offener Widerstand unnachsichtig verfolgt werden würden, konnte niemanden überraschen. Aber die Tatsache, daß eine bis in die physische Vernichtung führende Politik der Ausgrenzung sich künftig gegen jeden Deutschen richten sollte, sofern er den rassischen Vorstellungen und sozialen (Leistungs-)Erwartungen des Regimes nicht entsprach oder nicht entsprechen konnte, wurde der Mehrheit der >Volksgenossen<, aller Erbgesundheits-Propaganda, allen Zwangssterilisierungen und allen Gerüchten über die "Euthanasie"-Morde zum Trotz, nicht bewußt. Die monströsen Dimensionen der gesellschaftssanitären Utopie, die letztlich auf permanente >Ausmerze< aller Leistungsschwachen, >Minderwertigen< und >Gemeinschaftsunfähigen< zielte, blieben unerkannt. Für das Verständnis des Lebensgefühls der damaligen Zeitgenossen ist dies, ebenso wie der Versuch der Regimeführung, die Ermordung der europäischen Juden geheimzuhalten, von großer Bedeutung: Nur deshalb konnte die Realität der >Volksgemeinschaft< selbst noch unter den Bedingungen des totalen Krieges von der Mehrheit der Deutschen weitaus weniger negativ erlebt werden, als ihre menschenverachtenden Implikationen.
Alltagserfahrungen von "Normalität im Dritten Reich"
In den Erinnerungen von Zeitgenossen, aber auch schon in den für Historiker inzwischen zugänglichen Quellen zum Alltag und zur Volksmeinung im >Dritten Reich< stößt man immer wieder auf das Phantom der alltäglichen "Normalität". Man erinnert sich an die "normalen Zeiten" des Wirtschaftswunders Mitte der dreißiger Jahre zwischen der Arbeitslosigkeit der Weltwirtschaftskrise und den Bombardierungen der Kriegsjahre.28 Schon die von Goebbels kontrollierten Massenmedien hatten ja neben der direkten politischen Propaganda eine durchaus unpolitische heile Welt mittels Revuefilm, Presse und Funk vorgegaukelt.29 Oft verdrängt jedoch die Erinnerung, daß es sich um ein gespaltenes Bewußtsein handelte, das sich an der Arbeitsbeschaffung in der Rüstungsindustrie freute und doch den heraufziehenden Krieg fürchtete, das seichte Kino-Vergnügen genoß und doch die Furcht vor den Folgen eines unbedachten Wortes verinnerlicht hatte.
Nach 1945 ist diese Doppelexistenz der Deutschen dadurch bewältigt worden, daß der millionenfache Judenmord als unbegreifliches und irgendwie einzigartiges Schrecknis isoliert wurde von der alltäglichen Geschichte des Dritten Reiches. Man klammere sich an die vermeintliche Normalität des Alltags des "kleinen Mannes", um sich der Frage nach dem Wissen über die oder gar der Mitverantwortung an der Massenvernichtung "im Osten" entziehen zu können.30
Im öffentlichen Leben der fünfziger Jahre spiegelte sich diese gespaltene Erinnerung in zwei charakteristischen Verdrängungsformen wider. Auf der einen Seite stand ein Konzept christlich-jüdischer "Versöhnung", das vom aufrichtigen Bemühen um historisches Lernen bis zu manchmal peinlichen Manifestationen des Philosemitismus reichte.31 Daneben entwickelte das kollektive Gedächtnis sozusagen eine erneute Selektion der Opfer. Millionen ermordeter Russen und Polen, Zigeuner, körperlich und geistig Kranke, asoziale und homosexuelle KZ-Häftlinge verschwanden aus der Erinnerung. Zeitweise, auf dem Höhepunkt des kalten Krieges, widerfuhr dasselbe Kommunisten und Emigranten.
Die Konzentration des öffentlichen Bewußtseins in den fünfziger Jahren auf die Einzigartigkeit der Vernichtung der jüdischen Menschen trug dazu bei, daß die meisten anderen Opfer darüber verdrängt wurden. Die deutsche Öffentlichkeit der Nachkriegszeit machte es sich leicht. Sie bekundete "Buße" gegenüber einer Opfergruppe, die in der Folge eben dieser NS-Verbrechen aus dem Gesichtsfeld der Deutschen entfernt worden war. Die Verbrechen an Russen, Polen und Kommunisten dagegen - als den Teileinheiten des damaligen offiziellen NATO-Feindbildes - oder an Zigeunern, Homosexuellen, geistig und körperlich Schwerkranken, Zwangssterilisierten und Asozialen als weiterhin stigmatisierten Gruppen werden "vergessen".
Die Erinnerung als eine unpolitische "Normalität" in den dreißiger Jahren konnte insofern auch deshalb das kollektive Gedächtnis besetzt halten, weil gewisse strukturelle Parallelitäten zwischen der "Normalität" des ersten deutschen Wirtschaftswunders in den dreißiger Jahren und der Wirtschaftswundergesellschaft der fünfziger Jahre bestanden. Das galt nicht nur für so etwas Harmloses wie zum Beispiel die Freude an den gleichen Filmen und Filmstars, sondern auch für einen vergleichbaren Verdrängungsvorgang: In den dreißiger Jahren wurde die Gegenwart des NS-Terrors verdrängt, in den fünfziger Jahren die vergangene Gewalttätigkeit des NS-Systems.
Zu den angeblich positiven Erinnerungen an den Alltag des "kleinen Mannes" während des Dritten Reiches gehören immer wieder Sätze wie: Damals habe es keine Kriminalität gegeben, damals seien die Arbeitsscheuen von der Straße gebracht worden, damals habe man unbesorgt seine Wäsche auf der Leine hängen lassen können und überhaupt habe es damals noch Ordnung und Disziplin gegeben.32
Die erwähnten Erinnerungen legen jedoch eigentlich eine andere Schlußfolgerung nahe, beziehen sie sich doch alle auf bestimmte gewalttätige Maßnahmen der Nationalsozialisten im Alltag: auf die KZ-Einweisungen sogenannter Arbeitsscheuer und Krimineller; auf die fortgesetzte Inhaftierung sogenannter Gewohnheitsverbrecher; auf die "Säuberung" der Straßen von Landstreichern, Landfahrern und Zigeunern; auf eine Ordnung, die den Einsatz von Terror nicht verbarg; auf eine Disziplin, die dem einzelnen oft genug das Rückgrat brach. >Normalität< und Terror gingen hier zusammen.
Dies alles verweist auf eine verschwiegene Alltagsgeschichte des Rassismus.33 Der nationalsozialistische Rassismus beschränkte sich keineswegs auf den Antisemitismus, auch wenn sich im Haßbild des >Juden< die Aggressionen der Nazis besonders bündelten und das jüdische Volk weitaus die meisten Opfer zählte. Da gab es die Zwangssterilisierungen hunderttausender angeblich Erbkranker, bei denen der Tod Tausender von Frauen bewußt in Kauf genommen wurde;34 da war die Inhaftnahme vieler Tausender, die durch Krieg, Inflation und Arbeitslosigkeit aus der Bahn geworfen waren und jetzt als >Asoziale< in die Konzentrationslager geschickt wurden,35 da wurden jene verfolgt, die einen gleichgeschlechtlichen Partner liebten,36 da wurden angeblich >Arbeitsscheue< inhaftiert, weil Himmlers KZ-Kosmos Insassen brauchte;37 da wurden Millionen Ausländer der >Vernichtung durch Arbeit< ausgeliefert.38 In all diesen Fällen gewannen die Nationalsozialisten und die zahlreichen mitbeteiligten Beamten, Pfleger, Wärter und begutachtende Wissenschaftler ihr gutes Gewissen aus der Behauptung, abweichendes Verhalten sei im Grunde erblich, also durch Rassenhygiene >ausmerzbar<. Sozialer Rassismus gegen alle irgendwie >Gemeinschaftsfremden< im eigenen Volk39 und ethnischer Rassismus gegen sogenannte >Fremdvölkische< gehörten im Nationalsozialismus zusammen, wie besonders die Verfolgung der >Zigeuner< belegt.40 Ziel nicht nur dieses Projekts war die Gesamtlösung aller sozial und ethisch irritierenden Probleme, durch Selektion und Aussonderung der >Unwerten<, über Inhaftierung und Sterilisation bis zur >Vernichtung durch Arbeit< und zur industriemäßigen seriellen Ermordung.
Zwischen den ungeheuerlichen und trotz aller historischen Erklärungsversuche dem vernünftigen Verstehen letztlich unzugänglichen Faktum des millionenfachen "Holocaust" und der in apologetischer Absicht immer wieder beschworenen Alltagsnormalität jenseits des Nationalsozialismus erstreckt sich also in Wirklichkeit ein fatales Kontinuum von Diskriminierung, Selektion und Ausmerze, dessen ungeheuerliche Konsequenzen vielleicht in ihrer Gesamtheit den meisten Zeitgenossen verborgen blieben, dessen menschenverachtender alltäglicher Rassismus aber ständig und überall präsent war.
So oder ähnlich hätte noch vor wenigen Jahren das definitive Urteil des kritischen Segments der Nachkriegsgeneration gelautet. Die Spät- und Nachgeborenen identifizierten die Kriegsgenerationen mit den Täter, was ja angehen mag. Uns selbst jedoch setzten wir moralisch an die Stelle der Opfer. Ohne Frage war diese Substitution der realen Opfer auch eine Form der Verdrängung.
LITERATURVERZEICHNIS
Angermund, R. (1990), Deutsche Richterschaft 1919-1945. Krisenerfahrung, Illusion, politische Rechtsprechung, Frankfurt/M.
Bacharach, W.Z. (1986), Konsequenz und Manipulation der nationalsozialistischen Rassenideologie, in: U. Büttner (Hrsg.), Das Unrechtsregime, Bd. I, Hamburg, S. 49-58
Benz, W. (Hrsg.), (1992b), Jahrbuch für Antisemitismusforschung 1, Frankfurt/Main
Bock, G. (1986), Zwangssterilisation im Nationalsozialismus. Studien zur nationalsozialistischen Rassen- und Frauenpolitik, Opladen
Bock, G. (1993), Gleichheit und Differenz in der nationalsozialistischen Rassenpolitik, in: GG 19, S. 277- 310
Botstein, L. (1991), Judentum und Modernität. Essays zur Rolle in der deutschen und österreichischen Kultur 1848 bis 1938, Wien/Köln
Bracher, K.D. (1986), Demokratie und Machtergreifung. Der Weg zum 30. Januar 1933, in: ders. u.a. (Hrsg.), Nationalsozialistische Diktatur, a.a.O., S. 17-36
Bracher, K.D. u.a. (Hrsg.),(1986) Nationalsozialistische Diktatur. Eine Bilanz, Bonn
Bracher, K.D. u.a. (Hrsg.), (1992), Deutschland 1933- 1945. Neue Studien zur nationalsozialistischen Herrschaft, Bonn
Brokmeier-Lohfing, P. (1986), Geschichte vernichten. Reflexionen über den organisierten Massenmord im deutschen Faschismus, in: DD 10, S. 27-39
Broszat, M. (1970), Soziale Motivation und Führer-Bindung des Nationalsozialismus, in: VfZ 18, S. 392-409
Ebbinghaus, A. u.a. (Hrsg.),(1984), Heilen und Vernichten im Mustergau Hamburg, Hamburg
Elfferding, W. (1980), Opferritual und Volksgemeinschaftsdiskurs am Beispiel des Winterhilfswerks (WHW), in: AS 62, S. 199-226
Frei, N. (1993a), Der Führerstaat. Nationalsozialistische Herrschaft 1933-1945, München
Geyer, H.M. (1989), Soziale Sicherheit und wirtschaftlicher Fortschritt. Überlegungen zum Verhältnis von Arbeitsideologie und Sozialpolitik im Dritten Reich, in: GG 15, S. 382-406
Haug, W. F. (1986), Die Faschisierung des bürgerlichen Subjekts. Die Ideologie der gesunden Normalität und die Ausrottungspolitiken im deutschen Faschismus. Materialanalysen, Berlin Herbert, U. (1985), Fremdarbeiter. Politik und Praxis des >Ausländereinsatzes< in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches, Berlin/Bonn
Heuel, E. (1989), Der umworbene Stand. Die ideologische Integration der Arbeiter im Nationalsozialismus 1933-1935, Frankfurt a.M.
Jäckle, R. (1988), "Pflicht zur Gesundheit" und "Ausmerze". Medizin im Dienst des Regimes, in: DH 4, S. 59-77
Jochmann, W. (Hrsg.), (1980), Monologe aus dem Führerhauptquartier 1941-1944, München
Kershaw, I. (1988), Der NS-Staat. Geschichtsinterpretationen und Kontroversen im Überblick, Reinbek
Kershaw, I. (1992), Hitlers Macht. Das Profil der NS-Herrschaft, München
Longerich, P. (1992), Nationalsozialistische Propaganda, in: K.D. Bracher u.a., Deutschland 1933-1945, a.a.O., S. 291-314
Lüdtke, A., (Hrsg.), (1989), Alltagsgeschichte. Zur Rekonstruktion historischer Erfahrungen und Lebensweisen, Frankfurt a.M.
Mommsen, H.(1988), Einleitung, in: Mommsen/Willems (Hg.)Herrschaftsalltag im Dritten Reich, a.a.O., S. 9-11
Mommsen, H./ Willems, S. (Hrsg.), (1988), Herrschaftsalltag im Dritten Reich. Studien und Texte, Düsseldorf
Niethammer, L. (Hrsg.), (1983), "Die Jahre weiß man nicht, wo man die heute hinsetzen soll". Faschismuserfahrungen im Ruhrgebiet. Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet 1930-1960, Berlin/Bonn
Otto, H.U./ Sünker, H. (Hrsg.), (1991), Politische Formierung und soziale Erziehung im Nationalsozialismus, Frankfurt am Main
Peukert, D. (1981), Arbeitslager und Jugend-KZ. Die >Behandlung Gemeinschaftsfremder< im Dritten Reich, in: Ders./Reule>Peukert, D. (1982), Volksgenossen und Gemeinschaftsfremde. Anpassung, Ausmerze und Aufbegehren unter dem Nationalsozialismus, Köln
Peukert, D. (1986), Der deutsche Arbeiterwiderstand 1933-1945, in: K.D. Bracher u.a. (Hrsg.), Nationalsozialistische Diktatur, a.a.O., S. 633-654
Peukert, D. (1987), Die Weimarer Republik. Krisenjahre der Klassischen Moderne, Frankfurt am Main
Peukert, D. / Reulecke, J. (Hrsg.), (1981), Die Reihen fast geschlossen. Beitrüge zur Geschichte des Alltags unterm Nationalsozialismus, Wuppertal
Pingel, F. (1979), Häftlinge unter SS-Herrschaft. Widerstand, Selbstbehauptung und Vernichtung in Konzentrationslagern, Hamburg
Prinz, M. (1986), Vom neuen Mittelstand zum Volksgenossen. Die Entwicklung des sozialen Status der Angestellten von der Weimarer Republik bis zum Ende der NS-Zeit, München
Projektgruppe für die "vergessenen" Opfer des NS-Regimes (1986), Verachtet-verfolgt-vernichtet. Zu den vergessenen Opfern des NS-Regimes, Hamburg
Reichel, P. (1991), Der schöne Schein des Dritten Reiches. Faszination und Gewalt des Faschismus, München/Wien
Reichssportverlag (Hrsg.),(1936), Olympia Zeitung. Offizielles Organ der XI. Olympischen Spiele 1936 in Berlin; Nr. 1-29, (21. Juli - 18. Aug. 1936)
Rürup, R. (1988), Emanzipation und Antisemitismus, in: Strauss/ Kampe (Hg.), (1988), Antisemitismus, a.a.O., S. 88-98
Schoenbaum, D. (1968), Die Braune Revolution. Eine Sozialgeschichte des Dritten Reiches, Köln/Berlin
Schoeps, J.H. (Hrsg.), (1989), Juden als Träger bürgerlicher Kultur in Deutschland, Sachsenheim
Schön, P. (1985), Armenfürsorge im Nationalsozialismus. Die Wohlfahrtspflege in Preußen zwischen 1933 und 1939 am Beispiel der Wirtschaftsfürsorge, Weinheim/Basel
Strauss, H. / Kampe, N. (Hrsg.), (1988), Antisemitismus. Von der Judenfeindschaft zum Holocaust, Bonn
Stümke, H.G./Finkler, R. (1981), Rosa Winkel, Rosa Listen. Homosexuelle und >Gesundes Volksempfinden< von Auschwitz bis heute, Reinbek
Vorländer, H. (1988), Die NSV. Darstellung und Dokumentation einer nationalsozialistischen Organisation, Boppard
Weyrather, I. (1993), Muttertag und Mutterkreuz. Der Kult um die >deutsche Mutter< im Nationalsozialismus, Frankfurt am Main
Winkler, H.A. (1977), Vom Mythos der Volksgemeinschaft, in: AfS 17, S. 484-490
Winkler, H.A. (1993), Weimar 1918-1933. Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie, München
Wisotzky, K.(1983), Der Ruhrbergbau im Dritten Reich. Studien zur Sozialpolitik im Ruhrbergbau und zum sozialen Verhalten der Bergleute in den Jahren 1933 bis 1939, Düsseldorf
Wollenberg, J. (Hrsg.), (1989), "Niemand war dabei und
keiner hat's gewußt" - Die deutsche Öffentlichkeit und die Judenvernichtung 1933-1945, München
Wulf, J. (1983), Presse und Funk im Dritten Reich. Eine Dokumentation, Franfurt/M./Berlin/Wien
Zimmermann, M.(1989), Verfolgt, vertrieben, vernichtet. Die nationalsozialistische Vernichtungspolitik gegen Sinti und Roma, Essen
Zölling, P.(1986), Zwischen Integration und Segregation. Sozialpolitik im "Dritten Reich" am Beispiel der NSV in Hamburg, Frankfurt a.M.
Zollitsch, W.(1989), Die Vertrauensratswahlen von 1934 und 1935. Zum Stellenwert von Abstimmungen im >Dritten Reich< am Beispiel Krupp, in: GG 15, S. 361-381
Zollitsch, W. (1990), Arbeiter zwischen Weltwirtschaftskrise und Nationalsozialismus. Ein Beitrag zur Sozialgeschichte der Jahre 1928 bis 1936, Göttingen
ABKšRZUNGEN (Literaturverzeichnis)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
ANMERKUNGEN
[...]
1 In seinem Essay über die Weimarer Republik hat Detlev J.K. Peukert (1987) diese, fast alle gesellschaftlichen und kulturellen Bereiche ergreifende Krise beispielhaft offengelegt.
2 Brokmeier-Lohfing 1986, S. 29.
3 Vgl. Winkler 1993.
4 Vgl. Bracher 1986, S. 26.
5 Gay 1986, S. 115.
6 Vgl. Rürup 1988, S. 91ff.
7 Vgl. Botstein 1991; Grab 1991.
8 Vgl. Jochmann 1988, S. 140.
9 Vgl. Schoeps 1989.
10 Vgl. Bacharach 1986.
11 Vgl. Kershaw 1992.
12 Vgl. Longerich 1992; Paul 1990; Reichel 1991.
13 Vgl. Longerich 1992, S. 311.
14 Vgl. Angermund 1990.
15 Vgl. Broszat 1970, bes. S. 393-398.
16 So wird die NS-Volksgemeinschaft in der Literatur u.a. als "Schein" (Mommsen 1988,S.9f.), als "Mythos" (Winkler 1977), als "Ritual der Klassenlosigkeit, ohne die Klassenverhältnisse anzutasten" (Elfferding 1980, S. 225),als Grundlage für den Bewegungscharakter des nationalsozialistischen Regimes (Kershaw 1988) oder als realpolitisches und partiell verwirk-lichtes Programm (Prinz 1986, S. 336) verstanden und interpretiert.
17 Noch bevor seit etwa Mitte der dreißiger Jahre eine weitgehende sozialpsychologische Integration der Arbeiterschaft gelang, gab es nicht unbeträchtliche politische Re-Integrationserfolge u.a. im Zusammenhang mit den Vertrauensratswahlen 1934/35. Neue Analysen auf Betriebsebene zeigen, daß die ältere Literatur den nach dem Verbot der Gewerkschaften zu erwartenden Mißerfolg der Nationalsozialisten überzeichnet hat. Frühere parteipolitische und weltanschauliche Bindungen waren für die Wahlentscheidung offenbar von geringerer Bedeutung als konkrete materielle und innerbetriebliche Interessenlagen. Die politische Zäsur von 1933 hatte sich ins kollektive Bewußtsein der Arbeiterschaft also anscheinend weniger eingebrannt als bisher angenommen. Vgl. Wisotzky 1983; Zollitisch 1989; Zollitsch 1990.
18 Vgl. Reichel 1991.
19 Vgl. Kershaw 1992.
20 Vgl. Frei 1993a, S. 85ff.
21 Vgl. Heuel 1989.
22 Vgl. Weyrather 1993; Otto/Sünker 1991.
23 Kershaw 1988, S. 260.
24 Vgl. Schoenbaum 1968, bes. S. 150f.
25 Vgl. Geyer 1989.
26 Vgl. Haug 1986; Jäckle 1988.
27 Vgl. Otto/Sünker 1991; Schön 1985; Vorländer 1988; Zölling 1986.
28 Das Bild dieser Erinnerungen einer ganzen Generation spiegelt sich idealtypisch in der "Olympia-Zeitung", vgl. Reichssportverlag 1936.
29 Vgl. Wulf 1983.
30 Vgl. Wollenberg 1989.
31 Vgl. Benz 1992b.
32 Vgl. Lüdtke 1989; Niethammer 1983.
33 Vgl. Projektgruppe für die >vergessenen< Opfer des NS-Regimes 1986; Ebbinghaus u.a. 1984.
34 Vgl. Bock 1986 und 1993.
35 Vgl. Otto/Sünker 1986.
36 Vgl. Stümke/Finkler 1981.
37 Vgl. Peukert 1981; Pingel 1979.
38 Vgl. Herbert 1985.
39 Vgl. Peukert 1982.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Dieser Text behandelt die erlebte Realität der NS-Volksgemeinschaft, Alltagserfahrungen von "Normalität im Dritten Reich" und die Rolle der NS-Ideologie in der Gesellschaft.
Was waren die Hauptmerkmale der Weimarer Republik?
Die Weimarer Republik war eine Zeit epochaler soziokultureller Neuerungen, der Durchbruch moderner Sozialpolitik, Technik, Naturwissenschaft, der Humanwissenschaften und der modernen Kunst. Sie war aber auch von Krisen, wirtschaftlichen Problemen und gesellschaftlichen Spaltungen geprägt.
Wie nutzten die Nationalsozialisten die Krisen der Weimarer Republik aus?
Die Nationalsozialisten präsentierten sich als Protestbewegung gegen die Moderne und projizierten die Ängste der Modernisierungsverlierer auf das Feindbild der jüdischen Rasse. Sie boten einfache Erklärungen für komplexe Probleme und versprachen eine homogene Volksgemeinschaft.
Welche Rolle spielten Juden in der Weimarer Republik?
Juden leisteten einen großen Beitrag zur Kultur der Weimarer Republik, was jedoch auf antisemitische Ressentiments stieß. Sie wurden fälschlicherweise als Repräsentanten einer antinationalen Zivilisation und als Gefahr für die deutsche Kultur dargestellt.
Was waren die Merkmale des Antisemitismus im Deutschen Reich und in der Weimarer Republik?
Der Antisemitismus war im Deutschen Reich und in der Weimarer Republik weit verbreitet, sowohl in religiöser, ökonomischer und nationalistischer Form. Juden wurden als Pioniere der Veränderung und Nutznießer des Weimarer Systems betrachtet und zum Ausgangspunkt antimodernen Utopien gemacht.
Wie funktionierte die NS-Propaganda?
Die NS-Propaganda nutzte moderne Massenkommunikationsmittel, um ein simples Schwarz-Weiß-Schema zu verbreiten. Stereotype Feindbilder wurden einer vage beschriebenen Utopie einer homogenen Volksgemeinschaft gegenübergestellt. Sie vermied konkrete Aussagen über die Ziele der NS-Politik und basierte auf ständiger Berieselung.
Was war die NS-Volksgemeinschaft?
Die NS-Volksgemeinschaft war ein Konzept der sozialen Integration, das die Zusammenführung von Bürgertum und Proletariat vorsah. Sie sollte eine homogene und willensstarke Gemeinschaft schaffen, die zur rassenimperialistischen Machtentfaltung fähig war. Für das Individuum oder gar dessen Anspruch auf Selbstverwirklichung war in diesem Komplex kein Platz.
Wie gelang es dem NS-Regime, die Arbeiter zu gewinnen?
Das Regime setzte auf suggestive Propaganda, beschäftigungspolitische Erfolge und die Inszenierung eines "Führer-Mythos". Auch das veränderte Lebensgefühl, der Glaube an nationalen "Wiederaufstieg" und individuelle Aufstiegschancen trugen zur Akzeptanz des Regimes bei.
Welche Rolle spielte die wirtschaftliche Entwicklung im Dritten Reich?
Die wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung und die wachsenden Konsummöglichkeiten spielten bei der nationalsozialistischen Integrationspolitik eine zentrale Rolle.
Wie stand es um die "Normalität" im Dritten Reich?
Trotz der Propaganda einer heilen Welt gab es ein gespaltenes Bewusstsein. Man freute sich an der Arbeitsbeschaffung und fürchtete den Krieg, genoß seichte Unterhaltung und verinnerlichte die Angst vor den Folgen unbedachter Worte. Nach 1945 wurde der millionenfache Judenmord als unbegreifliches Schrecknis isoliert von der alltäglichen Geschichte des Dritten Reiches.
Welche Formen des Rassismus gab es im Nationalsozialismus?
Der Nationalsozialismus kannte verschiedene Formen des Rassismus, darunter Antisemitismus, Zwangssterilisationen, Verfolgung von Asozialen, Homosexuellen und Arbeitsscheuen. Sozialer Rassismus gegen "Gemeinschaftsfremde" und ethnischer Rassismus gegen "Fremdvölkische" gehörten zusammen.
Was war die Rolle von Selektion und Ausmerze im NS-System?
Selektion und Ausmerze waren zentrale Elemente der NS-Ideologie. Sie zielten auf die Beseitigung aller Leistungsschwachen, "Minderwertigen" und "Gemeinschaftsunfähigen". Die monströsen Dimensionen dieser gesellschaftssanitären Utopie blieben der Mehrheit der "Volksgenossen" jedoch verborgen.
Was wurde nach dem Krieg aus dem kollektiven Gedächtnis in Deutschland?
Im öffentlichen Leben der fünfziger Jahre spiegelte sich eine gespaltene Erinnerung wider. Einerseits gab es ein Konzept christlich-jüdischer "Versöhnung", andererseits eine erneute Selektion der Opfer. Die Konzentration auf die Vernichtung der Juden führte dazu, dass andere Opfergruppen verdrängt wurden.
- Citar trabajo
- Dr. phil. Walter Grode (Autor), 1994, Nationalsozialistische Volksgemeinschaft - Krise der Moderne und nationalsozialistische Protestbewegung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109459