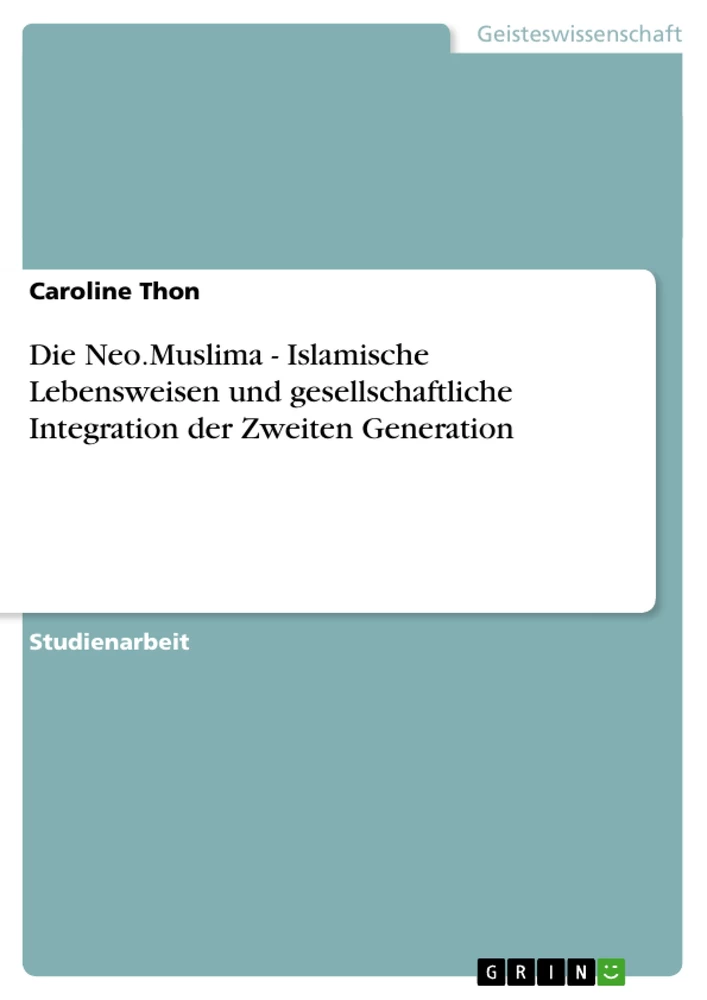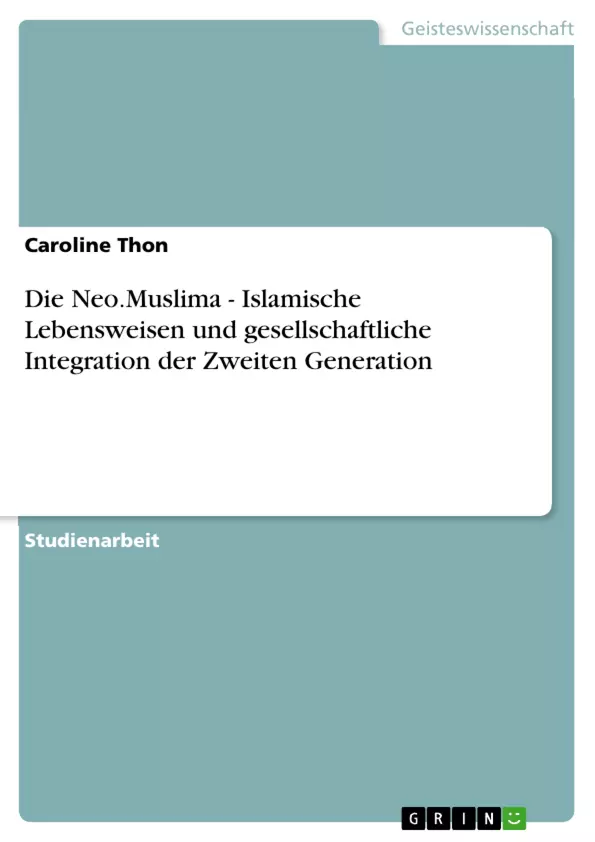Was bedeutet es, in zwei Welten zu leben, aber keiner wirklich anzugehören? Diese Frage steht im Zentrum einer faszinierenden Auseinandersetzung mit der Lebensrealität junger, muslimischer Frauen in Deutschland, der sogenannten zweiten Generation türkischer Gastarbeiter. Jenseits von Integrationsdebatten und Stereotypen über "den Islam" enthüllt dieses Buch eine vielschichtige Suche nach Identität, Selbstverwirklichung und religiöser Erfüllung. Es beleuchtet, wie diese Frauen, aufgewachsen zwischen zwei Kulturen, traditionelle Erwartungen und moderne Ansprüche miteinander vereinbaren. Die Studie untersucht, wie sich die Hinwendung zum Islam auf den Integrationsprozess auswirkt und ob sie tatsächlich ein Hindernis darstellt, oder vielmehr eine Quelle der Stärke und des Selbstbewusstseins sein kann. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die "Neo-Muslima" gelegt, junge Frauen, die eine radikal erscheinende Variante des Islams verfolgen und deren Lebensentwürfe oft als besonders kontrovers wahrgenommen werden. Entdecken Sie, wie diese Frauen den Islam als intellektuelles Projekt begreifen, traditionelle Rollenbilder hinterfragen und neue, emanzipatorische Wege beschreiten. Erfahren Sie, wie sie mit dem Kopftuch ein Zeichen setzen, das sowohl religiöse Hingabe als auch Selbstbestimmung symbolisiert. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der der Glaube nicht nur Tradition, sondern auch Innovation bedeutet und in der die Suche nach einer eigenen Identität zu einer kraftvollen Form der Selbstbehauptung wird. Das Buch bietet neue Perspektiven auf die Themen Integration, Identität, Islam in Deutschland, Migration, kulturelle Hybridität, Gender und Emanzipation. Es richtet sich an alle, die sich für die Lebensrealitäten muslimischer Frauen interessieren und mehr über die komplexen Zusammenhänge zwischen Religion, Kultur und Gesellschaft erfahren möchten. Es analysiert die Rolle von Bildung, sozialer Anerkennung und individueller Selbstbestimmung in der Gestaltung hybrider Identitäten und bietet einen differenzierten Einblick in die Herausforderungen und Chancen, denen sich junge Muslime in Deutschland stellen müssen. Die Auseinandersetzung mit Begriffen wie "deutsche Leitkultur" und "Parallelgesellschaft" erfolgt kritisch und konstruktiv, immer mit dem Ziel, ein tieferes Verständnis für die Vielfalt und Komplexität der muslimischen Lebenswelten in Deutschland zu fördern. Es zeigt, wie sich die religiösen Überzeugungen und Wertvorstellungen dieser Frauen in ihren Lebensentwürfen widerspiegeln und wie sie diese nutzen, um ihren Platz in der Gesellschaft zu finden und ihre Stimme zu erheben.
Gliederung
1. Einleitung
2. Von den Gastarbeitern zur zweiten Generation – ein historischer Abriss der Zuwanderung
2.2. Ökonomische und soziale Etablierung
2.1. Kulturelle und religiöse Etablierung
3. Hybride Identitäten und Integration die Problematik der zweiten Generation in der Wissenschaft
3.1. Die zweite Generation als Thema der Migrationsforschung
3.2. Des-integrative Aspekte des Integrationsdiskurs Der notwendige „Fremde“ in der Gesellschaft
3.3. Die Wahrnehmungen des Islam – Empfundene Differenzen zur „deutschen“ Gesellschaft
4. Islamisierung und Integration – Synthetisierung individueller religiöser Lebenskonzepte
4.1. Der Islam als intellektuelles Projekt – Der Werdegang der „Bildungsaufsteigerin“ zur religiösen Exegetin
4.2. Moderne Perspektiven im islamischen Gewand – Neo-Muslimische Emanzipationsbestrebungen
4.3. Alternative Bezugspunkte – Die islamische Persönlichkeit als Ausweg aus dem Dilemma „Ethnisch vs. National“
5. Resümee
6. Bibliographie
1. Einleitung
Seit Anfang der 1990er Jahre ist innerhalb der Zweiten Generation der ehemaligen türkischen Gastarbeiter in Deutschland eine verstärkte Hinwendung zur islamischen Religion zu beobachten (siehe Nökel, 2002: 12; siehe auch Tietze, 2003: 83-91). Die Skepsis gegenüber islamischen Entwicklungen in der deutschen Gesellschaft ist parallel zu diesem Phänomen gestiegen, was zum einen seinen Ursprung in der Wahrnehmung einer vermehrten, international stattfindenden Problematisierung des Islams hat (vgl. Nökel, 1996: 275). Zum anderen wird die Gesellschaft derzeit mit der Tatsache konfrontiert, dass sich die ehemaligen „Gastarbeiter“ und ihre Nachkommen in der Bundesrepublik faktisch niedergelassen haben und als etablierte Bevölkerungsgruppe inzwischen Forderungen nach gleichberechtigten gesellschaftlichen Partizipationsmöglichkeiten formulieren u. a. unter Anerkennung bestimmter kultureller, oft islamischer Spezifika, wie sie sich auf der gesellschaftspolitischen Ebene in Debatten und in Rechtsstreiten um den Bau von Moscheen, das Tragen von Kopftüchern im Staatsdienst oder Islamischen Religionsunterricht manifestieren. Es stellt sich daher die Frage, wie sich die Gesellschaft mit der Tatsache, eine Einwanderungsgesellschaft mit einer großen muslimischen Minderheit zu sein, in Zukunft umgeht.
Da die islamische Religion in einem Großteil von Veröffentlichungen und in der Öffentlichkeit unter dem Gesichtspunkt des politischen Fundamentalismus’ betrachtet wird und auch im Rahmen der Integrationsdebatte zumeist als des-integrativer Faktor bewertet wird (siehe dazu Nökel, 1996: 275; siehe Bukow/Yildiz, 2003: 9, 14), wird sich diese Arbeit mit der Frage auseinandersetzen, in welchem Verhältnis die oben erwähnte Islamisierung zum Integrationsstatus der Zweiten Generation der türkischen Einwanderer steht und inwiefern sich – auf einer individuellen Ebene - bikulturelle, moderne, islamisch geprägte Lebenskonzepte herausbilden. Angesichts der großen Heterogenität der Zweiten Generation, die keine allgemeingültigen Schlüsse zulassen würde, wird sich der Fokus der Arbeit auf die türkisch-sunnitischen Neo-Muslima[1] richten. Diese sind junge, in Deutschland aufgewachsene Töchter der ersten
Migrantengeneration, die eine besonders radikal erscheinende Variante des Islams verfolgen.
Der Bezug zum Inhalt des Seminars besteht insofern, als in dieser Arbeit Gedankengänge und Erklärungsansätze miteinbezogen werden, die Jenny B. White in ihrem Artikel „Turks in the New Germany“ geäußert hat. Dies wird insbesondere in der Erläuterung der Integrationsproblematik der türkischstämmigen Migranten und deren Nachkommen der Fall sein.
Um der Arbeit einen historischen Rahmen zu geben, wird im zweiten Kapitel zunächst auf die Geschichte der Etablierung der türkischen Migranten seit dem Anwerbeabkommen in den 1960er Jahren in der deutschen Gesellschaft eingegangen. Darauf folgt in Kapitel 3 eine allgemeine Darstellung der Rolle der Zweiten Generation in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung über Integration. Dabei wird betrachtet, inwiefern kulturelle Unterschiede in dieser Hinsicht problematisiert werden und inwieweit dies strukturelle Ursachen hat. Außerdem wird dargestellt, welche Rolle der Islam im Kontext des Integrationsdiskurses spielt. Im vierten Teil werden ethnographisch geführte Studien über die Neo-Muslima aufgegriffen, um die Integrationsproblematik der Zweiten Generation und individuelle Reaktionen darauf näher zu beschreiben. Außerdem wird thematisiert, welche Bedeutung die Islamisierung für die persönliche Integration der jungen Frauen in Deutschland hat und welche Formen der Synthese moderner und islamischer Elemente entwickelt werden.
Abschließen wird die Arbeit mit einem Resümee im fünften Teil.
Die verwendete Literatur entstammt größtenteils der Soziologie, Ethnologie und
Politikwissenschaft. Bemerkenswert ist dabei, dass sich die Soziologie in einem sehr viel größeren Maße als die Ethnologie systematisch mit dem Thema Migration[2] auseinandergesetzt hat. Die Studien zu den Neo-Muslima, die den Kern der Arbeit bilden, sind zwar von einer Soziologin und einer Religionswissenschaftlerin erstellt worden, jedoch sind sie in Hinblick auf die Methodik, die ausführlich in den Monographien erläutert wird, als ethnographische Arbeiten zu werten (siehe dazu Klinkhammer, 2000: 104-121, siehe Nökel, 2002: 16-29).
2. Von den Gastarbeitern zur Zweiten Generation – ein historischer Abriss der Zuwanderung
Die Migrationsphase, die für die Etablierung der türkischen Bevölkerung in der BRD entscheidend war, begann in 1960er Jahren mit den deutsch-türkischen Anwerbeabkommen für eine zeitlich begrenzte Arbeitsmigration.[3] Die Rekrutierung türkischer, größtenteils männlicher Arbeitnehmer, die die Mangellage des deutschen Industriesektors ausgleichen sollte, gründete auf dem Prinzip der Rotation, so dass zurückkehrende Gastarbeiter durch neue Migranten ersetzt werden sollten (siehe Sen/Aydin, 2002: 12). Eine tatsächliche Einwanderung entsprach anfänglich somit weder der Erwartungshaltung der türkischen Arbeitsmigranten noch der des deutschen Staates. Ihre „ethnisch-kulturelle Identität wurde aufgrund [dessen] nicht mit Blick auf eine mögliche nachhaltige Eingliederung in die deutsche Gesellschaft thematisiert“, so dass keinerlei Integrationsmaßnahmen stattfanden (Sen/Sauer/Halm, 2001: 14).
Der Anwerbestopp, den die BRD in Zusammenhang mit der rezessiven Entwicklung durch die Erdölkrise 1973 verhängte, konterkarierte jedoch die Politik der Rückwanderung (siehe Sen/Aydin, 2002: 13). Da eine Rückkehr in die Türkei zu diesem Zeitpunkt eine erneute Arbeitsmigration in die BRD ausschloss und viele türkische Arbeitsmigranten noch nicht die Zielsetzung ihrer Migration[4] erreicht hatten, wurde die Re-Migration häufig in die Zukunft verschoben, blieb dabei aber Teil des Lebenskonzepts der ersten Migrantengeneration (vgl. Sen/Sauer/Halm, 2001: 14/15).
2.1. Kulturelle und religiöse Etablierung
In Folge des Anwerbestopps in den 1970er Jahren wurde verstärkt das Programm zur Familienzusammenführung genutzt.[5] Nicht zuletzt der Zuzug der Familie und das Heranwachsen der so genannten Zweiten Generation[6] bewirkte, dass die türkischen Migranten ihre Bedürfnisse und Ansprüche an ihre sozialen und kulturellen
Lebensbedingungen änderten und so ihre Lebenswelt von einem „Provisorium der vorübergehenden Erwerbsmigration“ hin zu einem „Dauerprovisorium“ umgestalteten (Sen/Sauer/Halm, 2001: 16).
Erste Vereine wurden in den 1960er Jahren gegründet, um Begegnungen und Informationsaustausch unter den Migranten zu fördern und kulturelle und religiöse Traditionen zu bewahren (Sen/Aydin, 2002: 13). In den 70er Jahren wurde das Netz selbstverwalteter kultureller und religiöser Organisationen stark ausgeweitet. Es folgten Moscheenvereine, die u.a. die Funktion der religiösen Unterweisung und Sozialisation der Zweiten Generation erfüllen sollten (siehe Sen/Aydin, 2002: 14). Die einzelnen Vereine waren dabei zunächst „mono-ethnisch“ und auch „mono-konfessionell“, so dass sie die Heterogenität der Zuwanderer bezüglich Herkunft (Kurde, Türke etc.) und Religion (Sunniten, Schiiten, Sufisten etc.) widerspiegelten (Klinkhammer, 2000: 87).
Im Laufe der 1980er Jahre erfolgte mit der Gründung der großen Dachverbände[7] eine Institutionalisierung des Islam in der Bundesrepublik und somit auch eine Anpassung an die vorgegebenen gesellschaftlichen und rechtlichen Strukturen der Bundesrepublik (siehe Klinkhammer, 2000: 88-90)[8]. Die Intention hinter dem Zusammenschluss eines großen Teils der kleineren Vereine lag u. a. darin, sich als legitime Repräsentanten der muslimischen Minderheit darzustellen, so dass sie auf der gesellschaftspolitischen Ebene als Akteure für die Durchsetzung muslimischer Interessen akzeptiert würden (vgl. dazu Klinkhammer, 2000: 88-92). So hat sich ein Teil der Dachorganisationen beispielsweise um die Erlangung des Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts bemüht, durch den sie den Kirchen in Deutschland rechtlich gleichgestellt wären und z.B. berechtigt wären, Islamischen Religionsunterricht in den staatlichen Schulen anzubieten. Auch regionale Vereine haben sich juristisch für Belange wie den Islamischen Religionsunterricht oder das Schächten eingesetzt.
Die Vereine prägen durch ihre Aktivitäten die öffentliche Wahrnehmung der türkischen Immigrantengruppe bzw. der Muslime in der Bundesrepublik entscheidend mit (vgl. Teczan, 2000: 401/402). Wie groß die Zahl ihrer Mitglieder absolut ist, war bisher nicht zu ermitteln. Nach der repräsentativen Studie von Sen, Sauer und Halm sind insgesamt 36% der türkischstämmigen Bevölkerung Mitglied bzw. fühlen sich einem Verein verbunden. Dabei zeigen die hier geborenen Migrantennachkommen im Vergleich zur ersten Generation eine geringe Affinität zu den großen religiösen Vereinen (siehe Sen/Sauer/Halm, 2001: 86).
Des Weiteren existiert eine schier unüberschaubare Zahl an kleineren türkischen Vereinen, die sich sozial und/oder kulturell engagieren. Diese sind in der Forschung jedoch noch nicht systematisch untersucht worden (vgl. FES, 1998: 48).
2.2. Ökonomische und soziale Etablierung
Da die türkischen Gastarbeiter größtenteils Arbeiten im Industriesektor übernahmen, die mit niedriger Qualifikation[9] und geringem sozialem Ansehen verbunden waren, wurden sie von der Strukturkrise Mitte der 1970er Jahre hart getroffen (siehe Manfrass, 1991: 53/54). Die Arbeitslosenquote der Migranten lag im Vergleich zur deutschen Bevölkerung erheblich höher und der Wechsel in den wachsenden Dienstleistungssektor gestaltete sich für die türkischen Arbeitslosen immens schwieriger als für die Deutschen (vgl. Manfrass, 1991: 53/54; siehe dazu Rommelspacher, 2002: 159). Die folgende dauerhaft hohe Arbeitslosigkeit der ersten Generation, die durch den „Primat des Inländers“ auf dem Arbeitsmarkt aufrechterhalten wurde und zur wachsenden Inanspruchnahme sozialer Leistungen führte, die relativ starke demographische Konzentration der Migranten in bestimmten, strukturell benachteiligten Stadtteilen der industriell geprägten Städte und Metropolen und die geringeren Bildungschancen der jugendlichen Zweiten Generation – all diese Faktoren wirkten wechselseitig aufeinander (vgl. Manfrass, 1991: 5/6, 52-55). Als Konsequenz entwickelte sich durch die gesellschaftliche Wahrnehmung der türkischen Migrantengruppe als „soziale Unterschicht“ und „soziale[s] Problem“ ein ethnisch konnotiertes Stigma, welches zudem die schwache gesellschaftliche und ökonomische Positionierung und die Chancenlosigkeit der nachfolgenden Generation weiter generierte (Manfrass, 1991: 55, 61/62).
Inzwischen hat sich ein Teil der türkischstämmigen Migranten[10] der systematischen Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt durch den Weg in die Selbständigkeit und den Aufbau eigener Betriebe entzogen und somit eine eigene ökonomische Infrastruktur errichtet (siehe dazu Sen/Sauer/Halm, 2001: 29/30). Unter den Nachkommen der Zuwanderer zeichnet sich auch eine zunehmende Heterogenität im Bereich der Bildung ab, wobei aber nur ein – relativ zu der entsprechenden deutschen Generation – geringer Teil von ca. 10% Zugang zur höheren Bildung hat und immer noch knapp 60% mit Hauptschulabschluss oder gar keinem Abschluss den Arbeitsmarkt betreten (siehe Sen/Sauer/Halm, 2001: 21ff.). Trotz schulischer oder beruflicher höherer Qualifikation wird vielen türkischstämmigen Aspiranten durch rassistische Diskriminierung der soziale Aufstieg verwehrt (siehe dazu Sen/Sauer/Halm, 2001: 23). Laut dem Migrationsbericht 2002 des Zentrums für Türkeistudien sind etwa 50% der 18 bis 45jährigen als un-/angelernter Arbeiter oder Facharbeiter tätig, ein kleinerer Teil als Angestellte (14%) und als Selbständige (9,1%) (vgl. Sen/Sauer/Halm, 2001: 29). Dabei zeigt sich in den jüngeren Jahrgängen eine Tendenz vom Arbeiter- hin zum Angestelltenverhältnis und ein geringerer Anteil an Selbständigen (siehe Sen/Sauer/Halm, 2001: 29)[11].
Im Gegensatz zur ersten Generation orientieren sich die Lebenspläne der Nachkommen sehr viel stärker an einem Leben in der Bundesrepublik, besonders dann, wenn sie über eine höhere Schulbildung verfügen (siehe Sen/Sauer/Halm, 2001: 97; siehe Sauer, 2001: 200). So ziehen über 60% der in Deutschland geborenen Gastarbeiterkinder die Beantragung der deutschen Staatsbürgerschaft in Betracht, die letztlich den Verlust der türkischen Staatsbürgerschaft bedeutet (siehe Sauer, 2001: 213).
3. Hybride Identitäten und Integration – die Problematik der Zweiten Generation in der Wissenschaft
In den folgenden Abschnitten wird erarbeitet werden, wie die Zweite Generation in Deutschland in Hinblick auf ihre bikulturelle Sozialisation wahrgenommen wird und welche Schwierigkeiten sich aus dieser Wahrnehmung für die soziale Situierung der Migrantennachkommen in der Bundesrepublik ergeben. Dabei wird ein Exkurs in das deutsche Verständnis von Integration unternommen und untersucht, inwiefern hier systematische Ausgrenzungen der Zweiten Generation durch die Produktion von „Fremdheit“ stattfinden. Des Weiteren wird angesichts der Thematik der Arbeit dargestellt werden, welche Rolle dem Islam in der Auseinandersetzung der so genannten deutschen Mehrheitsgesellschaft und der türkischstämmigen Bevölkerungsgruppe zugewiesen wird.
3.1. Die Zweite Generation als Thema der Migrationsforschung
Über lange Zeit wurden Identität und Kultur in der Migrationsforschung als statische Merkmale eines Individuums angesehen (vgl. Polat, 1997: 36). Als Empfänger einer bikulturellen Sozialisation durch die türkische Familie auf der einen und der “deutschen“ Gesellschaft auf der anderen Seite, wurden die in der Bundesrepublik geborenen bzw. aufgewachsenen Türken demnach in der wissenschaftlichen Literatur der letzten Jahrzehnte als eine Generation dargestellt, die durch Identitätskrisen und –konflikte geprägt ist (vgl. Polat, 1997: 35; vgl. White, 1997: 759). Im Allgemeinen wurde dafür der Zusammenprall zweier unterschiedlicher Wertesysteme, im Besonderen durch die als traditionell, patriarchalisch und autoritär beurteilten Erziehungskonzepte und Lebensstile der Eltern als Ursache ausgemacht (vgl. Polat, 1997: 35)[12]. Die negative Einschätzung der kulturellen Hybridität geht bis zur Annahme, dass die „Entwurzelung“, also die fehlende Möglichkeit der eindeutigen kulturellen Selbstverortung zu einer erhöhten Anfälligkeit für Kriminalität und somit zu gesellschaftlichen Konflikten führt (vgl. Lajios, 1991: 52. zit. in Polat, 1997: 36).
Inzwischen gibt es in der Migrationsforschung den Ansatz, Identität nicht als statisch bzw. festgelegt anzusehen und die Konflikte der Zweiten Generation nicht in
einer sozusagen endogenen Identitätskrise auszumachen (vgl. Sen/Sauer/Halm, 2001: 19). Stattdessen wird die Identitätsentwicklung[13] als wechselseitiger, andauernder Prozess zwischen dem Individuum und seiner Umwelt bzw. der Gesellschaft erkannt und die Ursache der Konflikte in der relativen Chancenlosigkeit der Zuwandererkinder in der Bundesrepublik erkannt (siehe dazu Sen/Sauer/Halm, 2001: 18/19; vgl. Polat, 1997: 37). Unter dieser Annahme scheint es auch möglich durch geeignete Integrationsmaßnahmen in den Identitätsbildungsprozess einzugreifen und „konservierte ethnokulturelle Identitäten“ zugunsten der Übernahme der “deutschen Identität“ aufzulösen (Sen/Sauer/Halm, 2001: 104). Diese Erkenntnisse der Migrationsforschung spiegeln sich in dem heutzutage vorherrschenden Integrationsverständnis wider.
Idealtypische Integrationsverläufe (nach Sen/Sauer/Halm, 2001: 17/18) [14]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Modell geht davon aus, dass im Integrationsprozess das Zusammenspiel zweier Faktoren entscheidend ist:
Je nachdem, in welchem Ausmaß das Aufnahmeland Zugangschancen zu gesellschaftlichen Ressourcen[15] ermöglicht, und die Zuwanderer die kulturellen Werte
der sogenannten Aufnahmekultur übernehmen, so illustriert dieses Modell, gestalten sich die Integrationsverläufe unterschiedlich. Die Teilhabechancen an den Ressourcen der Gesellschaft nehmen hierbei insofern eine wichtige Rolle ein, als sie nicht nur auf eine materielle Gleichstellung der Migranten abzielen, sondern auch eine bedeutende Quelle der „sozialen Anerkennung“ für die Migranten darstellen, durch die die Identifizierung mit der so genannten Mehrheitsgesellschaft gestärkt wird; ein Mangel an
Anerkennung wirkt dagegen tendenziell segregierend (siehe Sen/Sauer/Halm, 2001: 31, 108/109; siehe Anhut/Heitmeyer, 2000: 45).
Inwieweit die türkischstämmigen Mitbürger der Bundesrepublik sich in diesem Sinne positiv integriert haben, wird im Allgemeinen in quantitativen Studien anhand bestimmter etischer Indikatoren gemessen, an denen sich demnach zeigt, an welcher Kultur sich die türkischstämmige Bevölkerung in ihrem Alltagsleben orientiert. Bei diesen Indikatoren handelt es sich bei Sen, Sauer und Halm beispielsweise um Heiratsverhalten, interkulturelle Kontakte mit Deutschen, die Mediennutzung, die Sprachkompetenz sowie die Religion (siehe Sen/Sauer/Halm, 2001: 43-99). Auch die Möglichkeit der sozialen Partizipationsmöglichkeiten wird anhand bestimmter Variablen[16] gemessen. Durch die Verschränkung dieser Daten wird die Tendenz des Integrationsverlaufs in Hinsicht auf verschiedene Lebensbereiche ermittelt (siehe dazu Anhut/Heitmeyer, 2000: 18-24 sowie: Sen/Sauer/Halm; 2001: 111).
Als ideales Ziel des Integrationsprozesses wird die Assimilation, also die Adaption der Migranten an die genannte Mehrheitskultur bei möglichst hoher sozialer und ökonomischer Chancengleichheit angesehen, da dieses Modell für die Aufnahmegesellschaft am wenigsten konfliktträchtig erscheint (siehe Sen/Sauer/Halm, 2001: 18). Jedoch gehen die pragmatischen Integrationsvorstellungen von einer graduellen Assimilation unter Beibehaltung einer gewissen kulturellen Pluralität aus (siehe Sen/Sauer/Halm, 2001: 19; vgl. Anhut/Heitmeyer, 2000: 18/19). Tendenzen zur Segregation und Exklusion sind demnach negative Entwicklungen, die sich im Rückzug in die „eigene Ethnie“ und den Aufbau eigener „ethnischer Infrastruktur“ auswirken können (siehe Sen/Sauer/Halm, 2001: 19, 109; siehe auch Anhut/Heitmeyer, 2000: 42ff.). Daraus kann der Aufbau einer ethnisch definierten Subgesellschaft resultieren, die sich von der sogenannten Mehrheitsgesellschaft isoliert, kulturell homogenisiert und als „Milieu abweichenden Verhaltens“ ein Konfliktpotenzial innehat (Anhut/Heitmeyer, 2000: 40-42).
Die türkischen Gastarbeiter der ersten Generation stehen in der heutigen Migrationsforschung nicht mehr im Zentrum der Untersuchungen. Sie gelten in Hinblick auf ihren Integrationsstatus als weitgehend homogene Gruppe: aufgrund ihres Migrationskonzepts, das letztlich die Rückkehr in die Türkei mit einschließt, haben bzw. hatten die Gastarbeiter kaum Integrationsabsichten und gelten dementsprechend typischerweise als segregiert (siehe Sen/Sauer/Halm, 2001: 14, 110). Große Integrationserwartungen und –bemühungen erscheinen bei dieser Gruppe, die zudem inzwischen größtenteils das Rentenalter erreicht hat, nicht mehr angebracht. Der Fokus ruht daher auf der Zweiten Generation, deren Integrationsprozess nach Ansicht der Migrationsforschung noch nicht abgeschlossen und somit weiterhin beeinflussbar ist (siehe Sauer, 2001: 223-226). Außerdem sind sie als die erste Generation, die in der Bundesrepublik aufgewachsen ist, diejenigen, an denen sich am ehesten die zukünftige Entwicklung der Etablierung der türkischen Minderheit in der Gesellschaft erkennen lässt. So kommt der Migrationsbericht des Zentrums für Türkeistudien zum Jahr 2002 zu folgendem Ergebnis:
„Insgesamt ist der Status der Zweiten Generation im Vergleich zur ersten durch eine Verschiebung hin zur Assimilation gekennzeichnet, wobei auch Tendenzen von Inklusion (Generierung einer spezifischen Migrantenkultur), Exklusion (im subjektiven Vergleich zur Mehrheitsgesellschaft) und Segregation festzustellen sind.“ (Sen/Sauer/Halm, 2001: 111)
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die bikulturelle Sozialisation der Zweiten Generation auch im gegenwärtigen Integrationskonzept immer noch problematisiert wird. In einem solchen Modell, in dem ein „nationales“ einem „ethnischen“ Wertesystem wie zwei Pole gegenübergestellt werden, erscheint Bikulturalität nur als Zwischenschritt einer erfolgreichen Integration. Zwar wird den Migrantennachkommen durch ihre Sozialisation in der Bundesrepublik ein „Assimilationsvorteil“ im Vergleich zu ihren Eltern im Sinne der sprachlichen Kompetenz und dem erfolgreichen Durchlaufen des deutschen Bildungssystems zugesprochen (Klinkhammer, 2000: 56). Dennoch gilt die Zweite Generation nicht als integriert, vielmehr pendelt sie nach diesem Verständnis zwischen zwei Kulturen, wobei der Bezug auf die eigene ethnische Herkunftskultur als Risiko einer „ethnischen Abschottung“ gedeutet wird.
3.2. Des-integrative Aspekte des Integrationsdiskurs –Der notwendige „Fremde“ in der Gesellschaft
Die Prämisse des oben dargestellten gegenwärtigen migrationswissenschaftlichen Paradigmas, nämlich dass die Zweite Generation trotz ihres Aufwachsens in der deutschen Gesellschaft nicht Teil dieser ist und sozusagen eine „zweite Sozialisation“ zur Anerkennung erforderlich ist, findet sich auch auf der Ebene des gesellschaftspolitischen Diskurses wieder (vgl. Bukow, 2003: 64)[17]. Nicht zuletzt aus ethnologischer Sicht ist diese Annahme zu problematisieren:
Zunächst geht sie von der essentialistischen Idee einer klar abgrenzbaren, relativ statischen „türkischen Herkunftskultur“ und „deutschen Aufnahmekultur“ aus, wobei Kultur zudem hin und wieder mit Identität gleichgesetzt wird (siehe dazu Sen/Sauer/Halm, 2001: 108-110). Indem das Handeln der Migranten als Ausdruck einer „türkischen“ bzw. „deutschen“ Identität gedeutet wird, wird vorausgesetzt, dass für die Akteure gleichsam diese kollektiven Identitätskategorien bedeutsam sind und dass ihr Handeln in einem direkten Kontext zu ihrer etwaigen ethnischen Identität steht (vgl. dazu auch Bukow, 1996: 123). So stellen auch Laviziano, Mein und Sökefeld fest:
„Nationale (und kulturelle) Identität wird [demnach] so gedacht, daß sie die letztgültige Identifizierungshoheit beansprucht und auf gleicher Ebene simultan keine andere Identifizierung neben sich duldet“ (Laviziano/Mein/Sökefeld, 2001: 49)
Allerdings finden sich auf der Ebene der individuellen Identität eine Vielfalt von Bezügen und Identifizierungen mit Gruppen, die je nach Situation für das Individuum und sein Handeln bedeutsam werden können (siehe Heinz, 1993: 18-22). Die binäre, ethnisch vs. national ausgerichtete Identitätslogik des Diskurses jedoch bewirkt, dass die heterogenen, individuellen und vielschichtigen Selbstkonzepte der hier aufgewachsenen Türken und türkischstämmigen Deutschen immer wieder in Bezug zum „ethnischen Kollektiv“ gestellt werden (vgl. Laviziano/Mein/Sökefeld, 2001: 47; vgl. Nökel, 1999: 128). Somit werden die Identitätskategorien „Türken“ und „Deutsche“ nicht nur als maßgebendes, dichotomes Ordnungsmuster erhalten, in dem eine bikulturelle Migrantenkultur oder andere Identitätskategorien keinen Platz haben (vgl. Laviziano/Mein/Sökefeld, 2001: 49). Auch werden durch den Verweis des Einzelnen auf seine angebliche ethnische Identität Differenzen „in Form einer self-fulfilling-prophecy im Vollzug ihrer Unterstellung erst hervorgebracht“ (Bukow, 1996: 123). Dadurch dass die Integrationsvorstellungen auf der Logik einer sich national definierenden Gesellschaft basieren und mit essentialisierten Idealkulturen operieren, werden die Grenzen zur so genannten Mehrheitsgesellschaft bzw. die oppositionelle ethnische Gruppe erst reifiziert.
Laut White, die eine Feldforschung zu türkischen Einwanderern in Berlin vorlegt, sind diese „nationalen“ Grenzen der Gesellschaft undurchdringlich, da das Konzept des „Deutschseins“ auf die Idee der Abstammung rekurriert und nicht, wie der Integrationsdiskurs suggeriert, auf kulturelles Verhalten (siehe White, 1997: 760):
„The unattainability of acceptance is hidden behind a screen of discourse that promises integration in return for behavioral adaption. The hidden impossibility of this premise perpetuates the image of the Turkish community as essentially Other and unintegrable.” (White, 1997: 760)
Mit der Konstruktion des „Fremden“, wie White sie anspricht, bekommt der systematische Ausschluss der zweiten Zuwanderergeneration aus der „deutschen“ Gesellschaft eine funktionale Bedeutung. Der Fremde ist Produkt des Konzepts der Nation bzw. des Nationalismus: erst durch die Abgrenzung zu einem oppositionellen Fremden, lässt sich die imaginierte deutsche Gemeinschaft als Identität greifbar und begreifbar machen (vgl. dazu Rommelspacher, 2002: 10). Die Zuschreibung von Fremdheit funktioniert als kognitiver Prozess, in dem unter Einfluss der historischen Gegebenheiten bestimmte, als Differenz empfundene Merkmale selektiv betont und stereotypisiert (vgl. Rommelspacher, 2002: 10ff.). Die Stereotypisierung entpersonalisiert, kollektiviert und schafft Distanz, die unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann; je nach Grad der Distanzierung sind die Grenzen zwischen dem Fremden und dem Eigenen durchlässiger oder dichter (vgl. Rommelspacher, 2002:11). Aus diesem Kontrast wird einerseits die Gewissheit über ein eigenes, abgegrenztes Selbstbild gespeist, andererseits dient die Grenzziehung dazu, gesellschaftliche Hierarchien aufzubauen und Machtverteilung zu rechtfertigen (siehe Sökefeld, 2001: 5; siehe Rommelspacher, 2002: 10, 17). Mit dem Argument der Fremdheit kann Individuen und
Gruppen die Anerkennung in der Gesellschaft verweigert und dadurch der Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen vorenthalten werden (siehe Rommelspacher, 2002: 14-17). So existieren in den meisten multi-ethnischen Gesellschaften soziale und ökonomische Grenzen, die mit denen ethnischer Gruppen zusammenfallen (vgl. Rommelspacher, 2002: 156). Dabei, so Rommelspacher, gilt dieses Prinzip der „ethnischen Schichtung“ insbesondere für die Gruppen, die der so genannten Mehrheitsgesellschaft als kulturell am fremdesten gelten (siehe Rommelspacher, 2002: 156-158).
Prüft man die Situation der türkischen Migrantengruppe auf dieses Muster hin, so erscheint Whites Annahme zunächst berechtigt: Durch die Immigration als Gastarbeiter im industriellen Sektor „bildeten [die türkischen Migranten] damals die neue Unterklasse, und die einheimische Bevölkerung konnte auf ihre Kosten aufsteigen“ (Rommelspacher, 2002: 17). Diese ökonomische und soziale Position blieb weitgehend unverändert bis die Zweite Generation als Bildungs- und Arbeitsmarktaspiranten auftraten. Mit dem Selbstverständnis Teil der Gesellschaft zu sein, formulieren sie höhere Ansprüche und Bedürfnisse als ihre Eltern – sowohl gegenüber der Gesellschaft als auch gegenüber sich selbst (vgl. Sen/Sauer/Halm, 2001: 111; vgl. Anhut/Heitmeyer, 2000: 24). Es ist jedoch fraglich, ob ihr sozialer Aufstieg von der deutschen Bevölkerung gewünscht wird. Denn nicht zuletzt durch die Wiedervereinigung veränderte sich parallel zu dieser Entwicklung die politische und ökonomische Lage der Bundesrepublik: der Aufbau Ost und die weltwirtschaftlich bedingte rezessive Tendenz führten zu innergesellschaftlichen Verteilungskämpfen (vgl. Bukow, 2003: 62). Gleichzeitig forderte die Fusion der ostdeutschen und westdeutschen Bevölkerung zu einer imaginierten Deutschen Einheit, also der Bildung einer gemeinsamen Identität, Differenzen und die dazugehörigen Stereotypisierungen zu relativieren (siehe White, 1997: 761ff.; siehe auch von Thadden, 1991: 493). Zugunsten eines Einschlusses des „Anderen“[18] wurde innerhalb dieses Prozesses die Distanz zum Fremden, in diesem Fall den türkischen Migranten und ihren Nachkommen, im gesellschaftspolitischen Raum verstärkt betont (siehe White, 1997: 761ff.).
So stellt Rommelspacher fest, dass sowohl die ökonomischen Chancen der türkischen Migranten als auch ihr Ansehen in der Gesellschaft in den vergangenen Jahren gesunken sind (siehe Rommelspacher, 2002: 158/159, 163). Bemerkenswert ist dabei, dass die hiesige Sozialisation der Zweiten Generation und ihre spezifische Lebenssituation durch den Migrationshintergrund der Eltern von außen nicht anerkannt werden. So werden sie meist nicht von der ersten Generation differenziert bzw. sie werden mit dem Begriff „Ausländer“ bezeichnet, wodurch sie ungesehen ihres fehlenden Migrationserfahrung und ihrer Sozialisation in der Bundesrepublik mit Migranten anderer Herkunft, Lebenssituation und differentem sozialen und rechtlichen Status in der Bundesrepublik in eine Kategorie zusammenfasst werden (siehe Schneider, 2001: 20; siehe dazu Laviziano/Mein/Sökefeld, 2001: 46). Dementsprechend bestehen recht verzerrte Bilder über die Lebensrealität der Zweiten Generation, die jedoch politisch sehr gut zu gebrauchen sind.
3.3. Die Wahrnehmungen des Islam –Empfundene Differenzen zur „deutschen“ Gesellschaft
Während die türkischen Einwanderer früher primär über ihre nationale Herkunft, also als „Türken“ identifiziert wurden, werden sie gegenwärtig zunehmend als „Muslime“ wahrgenommen (vgl. Rommelspacher, 2002: 99). Die vermeintliche Zugehörigkeit zum Islam[19] wird somit als signifikante Differenz und als Quelle der „als fremd empfundene[n] Habitusformen“ interpretiert (Sen/Sauer/Halm, 2001: 13; siehe auch Manfrass, 1991: 81; siehe Schneider, 2001: 19).[20] Klinkhammer stellt des weiteren fest, dass die gelebte Religiosität „als eine Distanzierung der Migrantinnen und
Migranten von einer als ‚säkular’ verstandenen Aufnahmegesellschaft gedeutet“ wird (Klinkhammer, 2000: 56): „Religiosität kommt [..] – wenn überhaupt – als fundamentalisierende, das Fremde bewahrende Haltung in den Blick“. (Klinkhammer, 2000: 56). Der Islam hat sich demnach bezüglich der vermeintlich muslimischen Bevölkerung zu der Essenz des Fremden verdichtet.
Diese Entwicklung mag einerseits einer verstärkten Sichtbarkeit islamischen Lebens und islamischer Symbole im Alltag unterstützt worden sein, die sich teils erst in den letzten Jahren etabliert haben, so z.B. die wachsende Zahl der Moscheen[21] insbesondere in den Großstädten. Ebenso ist seit einigen Jahren eine Islamisierung der Zweiten Generation zu bemerken, die sich im Alltagsleben z.B. durch das Kopftuch als Zeichen islamischer Religiosität zeigt (siehe Nökel, 2002: 16). Auf der Bühne der Gesellschaftspolitik treten zudem die muslimischen Verbände vermehrt auf und fordern die Gesellschaft auf, sich mit der bleibenden Existenz islamischer Lebensweisen in Deutschland auseinanderzusetzen und diese als gleichberechtigt anzuerkennen.[22] Dies ist auch eine Herausforderung an das Selbstverständnis der Gesamtgesellschaft, die sich nach 40 Jahren der faktischen Einwanderung offiziell nie als Einwanderungsgesellschaft definiert hat.
Andererseits fand zeitgleich mit dieser innergesellschaftlichen Auseinandersetzung international eine intensive Thematisierung des Islam statt, die nicht unerheblich in die Konstruktion des deutschen Fremdbildes des Islam mit einfließt: Nach Zusammenbruch des Sozialismus erhielt in verschiedenen Ländern eine Re-Politisierung des Islam Einzug, die in der westlichen Welt in erster Linie als (potenzieller) Fundamentalismus wahrgenommen und analysiert wurde (siehe Rommelspacher, 2002: 99; siehe auch Schiffauer, 1997: 172-188). Die Kontinuität der historischen Konkurrenz zwischen Islam und Christentum, die in den säkularen Gesellschaften kontextabhängig als eine Gegnerschaft von Anti-Moderne/-Aufklärung/-Zivilgesellschaft/-Zivilisation und den Gesellschaftsmodellen und Wertvorstellungen der „westlichen Welt“ gedeutet wurde, rückt somit wieder in den Vordergrund und gewinnt in den letzten Jahren insbesondere durch Terroranschläge islamischer Fundamentalisten eine Dimension vermeintlich direkter Bedrohung (siehe dazu Schiffauer, 1997: 172ff.).
Diese gegenwärtigen externen Entwicklungen haben ebenfalls eine Rückwirkung auf die Perzeption des islamischen Lebens in der Bundesrepublik und auf die Prämissen, unter denen sich politische und gesellschaftliche Akteure mit Migrantengruppen, die einen vermeintlich muslimischen Hintergrund haben, auseinandersetzen (siehe Bukow, 2003: 62). Islamische Religion und Lebensweisen werden, laut Bukow, zu einem „Islam-Mythos“ essentialisiert und zur „Inkarnation der Integrationsbarrieren“ konstruiert (Bukow, 2003: 63; Bukow/Yildiz, 2003: 14). Dadurch wird die „stillschweigende Integration“ der Zuwanderer, die sich im Sinne einer alltagspraktischen Anpassung der Lebensgewohnheiten und (religiösen) Einstellungen an die „deutschen“ Verhältnisse über die Jahre vollzogen hat, grundsätzlich in Frage gestellt (siehe Bukow, 2003: 61-63). Auch Nökel kritisiert, dass die überwiegend einseitige Konzentration wissenschaftlicher Studien auf vermutete fundamentalistische Aktivität islamischer Organisationen, nicht nur den Blick auf die Diversität individueller islamischer Lebenskonzepte verstellt, sondern auch die Selbstbestimmtheit dieser anzweifelt (vgl. Nökel, 1996: 275).
Letztere Annahme, nämlich dass der Islam eine Form der unkritischen Unterwerfung unter einen streng konservativen, nicht modulierbaren Regelkanon bedeutet, der angesichts seiner religiösen Fundierung in einer säkularen Gesellschaft tendenziell als unmodern bzw. irrational[23] erscheint, und der Persönlichkeit eine Individualisierung nach “westlichem“ Verständnis verwehrt, spiegelt sich insbesondere in der deutschen Interpretation der “islamischen Frau“ wider.[24] So ist die „Unterdrückung der Frau im bzw. durch den patriarchalen Islam“ ein Fremdbild, das in der Öffentlichkeit – unabhängig von konservativer oder progressiver Orientierung der Publikationen und Diskurse – noch dominant ist (Rommelspacher, 2002: 114; siehe
Schneider, 2001: 19). Die vorherrschenden Attribute wie „‚rückständig’, ‚isoliert’, ‚hilfsbedürftig’ und ‚unterdrückt’“ unterstellen den Immigrantinnen und ihren Töchtern Handlungsunfähigkeit und erzeugen u. a. paternalistische Reaktionen von deutscher Seite, wie White an ihrem Beispiel der interventionistischen deutschen Sozialarbeit darstellt (Klinkhammer, 2000: 19; siehe White, 1997: 759[25] ). Auch im so genannten „Kopftuch-Streit“ wurde deutlich, dass das Kopftuch als kulturelles Symbol für Unterjochung der Frau und Rückständigkeit verstanden wird, wodurch es als visuelle Provokation der sich als universalistisch und modern verstehenden Gesellschaft wirkt (siehe Rommelspacher, 2002: 114).
Die Bilder zum Islam der deutschen Gesellschaft bewegen sich somit größtenteils in einem Spektrum zwischen fundamentalistischer Aggression und kultureller bzw. sozialer Regression. Von diesem essentialistischen Standpunkt aus erscheint ein interkultureller Brückenschlag zwischen der (bekennenden) muslimischen Minderheit vonseiten der modernen Gesellschaft unmöglich.
4. Islamisierung und Integration Synthetisierung individueller religiöser Lebenskonzepte
In den folgenden Kapiteln wird das Verhältnis von Integration und der Islamisierung der Zweiten Generation in zwei Dimensionen betrachtet:
Zunächst in Hinsicht auf die Frage, in welcher Beziehung die Hinwendung zur islamischen Religion und Lebensführung zum Selbstverständnis der deutschen als moderne Gesellschaft steht und inwiefern die islamisch gerahmten Lebenskonzepte mit den Werten und Vorstellungen fusionieren, die die „deutsche“ Gesellschaft im Kontrast zu “dem Islam“ als ihr Eigen bezeichnet. Zudem wird hinterfragt werden, in welchem Verhältnis die Islamisierung zum „ethnischen Kollektiv“ steht.
Das Phänomen der Islamisierung in der Bundesrepublik ist Geschlechter übergreifend, trans-ethnisch[26] und zeigt sich in unterschiedlichen religiösen
Lebensentwürfen der Angehörigen der Zweiten Generation. So stellt Tietze in ihrer Untersuchung junger männlicher Muslime in Hamburg-Wilhelmsburg fest, dass soziale Probleme und (empfundene) rassistische Diskriminierung bedeutende Faktoren in der Islamisierung sind (siehe Tietze, 2003: 84-86). Dem gegenüber stehen die Studien von
Klinkhammer und Nökel. Ihre Informantinnen gehören zu den so genannten Bildungsaufsteigerinnen der Zweiten Generation: sie verfügen über höhere Schulabschlüsse bzw. Bildung und sind somit in Hinsicht auf ihre Biographien „hochgradig integriert“ (Nökel, 2002: 18; siehe Klinkhammer, 2000: 118). Die Erfahrungen von massiver Diskriminierung wird von den jungen Frauen kaum beschrieben (vgl. Nökel, 1996: 281).
Klinkhammer stellt auf der Grundlage ihrer Forschungsergebnisse zudem drei Typen islamischer Lebensführung fest, denen jeweils eine eigene Form der Einbindung des Islam in die Lebenskonzepte der jungen Frauen zugrunde liegt: die traditionalisierende, die universalisierende[27] und die exklusivistische islamische Lebensführung (siehe dazu Klinkhammer, 2000: 286). Im Rahmen der Islamisierung lässt sich also eine Vielfalt islamisch-religiöser Lebenskonzepte feststellen. Den ersten beiden Formen ist gemein, dass der Islam von den Frauen nicht als absolute Struktur bzw. als alleinige Handlungsanleitung in allen Lebensbereichen verstanden wird (siehe Klinkhammer, 2000: 286-288). Dies ist nur bei der exklusivistischen Variante der Fall, die auch Nökel in ihrer Untersuchung der so genannten „Neo-Muslima“ beschreibt. Gerade diese Art der Interpretation von islamischer Religiosität erscheint unter der Annahme eines säkularen Verständnisses in ihrer Extremität zunächst als tendenziell fundamentalistisch bzw. anti-modern und entspricht somit am ehesten dem Prototyp des „fremden Islam“, der angeblich nicht integrierbar ist. Daher werden sich die nächsten Subkapitel mit den türkisch-sunnitischen Mädchen bzw. Frauen befassen, die nach Nökels und Klinkhammers Analysen, diese Form islamischer Lebensweise für sich gewählt haben. Die individuellen Biographien, die die Wissenschaftlerinnen durch narrative Interviews generiert haben, weisen dabei viele Ähnlichkeiten in Hinsicht auf die Formen des Zu- und Umgangs mit der islamischen Religion auf.
4.1. Der Islam als intellektuelles Projekt – Der Werdegang der „Bildungsaufsteigerin“ zur religiösen Exegetin
Die Beschäftigung mit dem Islam beginnt in den Biographien der Neo-Muslima in der Regel innerhalb der (späten) Pubertät (siehe Nökel, 1999: 127). Bis zu diesem Zeitpunkt gleichen die jungen Frauen in ihrem „Habitus de[n] deutschen Jugendlichen“ (Nökel, 2002: 60): sie interessieren sich für Mode und orientieren sich an den gängigen Trends, färben sich die Haare, gehen aus (soweit dies innerhalb der elterlichen Vorschriften möglich ist), einzelne engagieren sich als Klassensprecherin oder auch politisch (siehe Nökel, 2002: 82; siehe Nökel, 1999: 133; siehe Klinkhammer, 2000: 124/125). Dennoch erscheint ihnen selbst die Islamisierung nicht als Bruch mit ihrem bisherigen Leben. Ganz im Gegenteil: Obwohl ein Großteil der Frauen berichtet, während der Jugend gar keinen oder einen durch die traditionell-islamische Lebensweise der Familie verursachten negativen Bezug zu dieser Religion gespürt zu haben, wird die Islamisierung von den Frauen in der Rückschau nicht als Konversion, sondern als Kontinuität in der Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit verstanden (vgl. z.B. Klinkhammer, 2000: 130/ 168). Das heißt auch, dass sie diesen Schritt nicht als Rückzug aus der Gesellschaft[28] oder eine fundamentale Abwendung von ihren – den Anforderungen der modernen Gesellschaft entsprechenden – Lebenszielen[29] sehen (siehe Nökel, 2002: 187).
Ausschlaggebend dafür ist die Herangehensweise der jungen Frauen an den Islam: die Neo-Muslima machen sich nicht die islamische Lebensweise der Eltern zur Grundlage. Das Gros der Mädchen hat den Islam lediglich im Rahmen familiärer „traditioneller“ Lebensweise kennen gelernt: Nur sehr wenige der Elternhäuser sind streng religiös, meist wird eklektizistisch an der Einhaltung bestimmter islamischer Traditionen und Regeln festgehalten (z.B. Begehung der Feiertage, in manchen Fällen auch Anlegen des Kopftuchs mit Eintritt in die Pubertät), selten wird für die Töchter eine systematische Einführung in die islamische Religion z.B. durch den Besuch eines Korankurses arrangiert und in manchen Fällen scheinen die Eltern weitgehend säkular zu leben (vgl. Nökel, 1999: 126; siehe Klinkhammer, 2000: 123/124, 162/163). In der Zeit vor der eigenständigen Hinwendung zum Islam spielt das islamische Erbe für die eigene Persönlichkeit der Mädchen nur punktuell eine Rolle, indem es in Form von familiärer Tradition auftaucht und auch von Fall zu Fall zu innerfamiliärem Konfliktstoff gereicht, z.B. wenn anhand islamischer Traditionen Freiheiten begrenzt werden, die ihre nicht-muslimischen Freundinnen ausleben können oder das Anlegen des Kopftuchs von den Eltern forciert wird (siehe z.B. Klinkhammer, 2000: 124).
Der elterliche, traditionell gelebte Islam wird von ihnen im Rückblick als „rudimentäres“ oder „falsches“ Wissen abgewertet, auf das die eigene Religiosität nicht fußen kann (vgl. Klinkhammer, 2000: 249; vgl. Nökel, 2002: 69). Sie sehen in der an Traditionen und religiösen Autoritäten orientierten islamischen Praxis der Eltern Zeichen einer fehlenden eigenständigen Reflektion und einen Mangel an eigener Interpretation der kategorischen islamischen Quellen Koran und Sunna [30] – diese sind für Neo-Muslima zentral für ihren Zugang zum Islam (vgl. Nökel, 1999: 132). Die plötzliche Attraktivität der Religion liegt für die Frauen gerade in der Entdeckung, dass sich ihnen durch die eigenständige und intellektualisierende Exegese der islamischen Quellen religiöse Handlungs- und Lebensanleitungen eröffnen, in denen sie ihre modernen Grundüberzeugungen z.B. bezüglich der Geschlechterrollen widergespiegelt sehen und nicht den als einschränkend bzw. weltfremd erlebten Charakter der religiösen Praxis der Eltern (siehe z.B. Klinkhammer, 2000: 127/128). Zentral in der Auseinandersetzung mit den Eltern ist dabei oft das patriarchale Geschlechterverhältnis, das für die jungen Frauen durch ihre eigene Lesweise des Koran als Produkt von Traditionen, aber nicht als Teil des „wahren“[31] Bezeichnung vonseiten der Neo-Muslima (siehe Klinkhammer, 2000: 130) Islam identifiziert wird (siehe z.B. Klinkhammer, 2000: 130). Mit der rationalen Erschließbarkeit, der Möglichkeit der individuellen und differenzierten Ausarbeitung einer eigenen, lebensnahen und -praktischen islamischen Weltsicht erfüllt die neo-muslimische Idee des Islam den „westlichen Bildungsanspruch“, dem der Islam der Eltern nicht gerecht wird (Klinkhammer, 2000: 130).
Auf der Basis der eigenständigen Quellenarbeit, die u. a. aufgrund der Rahmung durch vorhandene kategorische Forderungen des Islam[32] nicht ins Beliebige abdriftet, gestalten sich die Neo-Muslima eine strenge islamische Systematik, die praktisch alle Lebensbereiche umfasst (vgl. Nökel, 2002: 67).[33] Einerseits wird somit das ehemals weltlich orientierte Leben an die Anforderungen einer exklusiv religiösen Lebensführung akkomodiert und alte Gewohnheiten, die als nicht islamkonform erkannt werden, abgelegt (vgl. Nökel, 2002: 67). Andererseits sind Koran und Sunna in Aussagen sehr vage oder – was die Ahadith[34] der Sunna betrifft – teilweise in ihrer Authentizität umstritten, so dass für ihre Übersetzung in lebenspraktische Anweisung Interpretation erforderlich wird (vgl. Nökel, 2002, 69). Innerhalb des Deutungsprozess werden islamische Vorschriften auch daraufhin überprüft, ob sie sich sinnvoll in das Alltagsleben integrieren lassen, d.h. ob sie in den Kontext eines modern ausgerichteten Lebenskonzepts passen – so werden aus dem Surenfundus, diejenigen bevorzugt, die die eigenen Positionen stützen (siehe Klinkhammer, 2000: 131).[35] Ebenso werden traditionelle Deutungsweisen angefochten: So finden einige z.B. das traditionelle Verbot des Hosentragens für Frauen als äußerst unpraktisch bzw. den Zwang zum Rock als Ausdruck patriarchaler Unterdrückung (vgl. Nökel, 2002: 87-93). Die Widerlegung geschieht allerdings immer auf der Basis rationaler Argumentation. Im Falle des Hosentragens wird beispielsweise angeführt, dass ein solches Stück Stoff nicht per se als „maskulin“ zu definieren sei und der Sündentatbestand – nämlich die Verleugnung des eigenen natürlichen, von Allah gegebenen weiblichen Geschlechts – somit nicht zwangsweise erfüllt ist (vgl. Nökel, 2002: 89).
Dies bezeugt einerseits den differenzierten, rational geprägten Zugang zum Religiösen wie auch zugleich die Bedeutung einer weiteren Komponente in der Exegese und Lebensführung: die individuelle Verantwortlichkeit für das eigene Handeln. Stimmt die innere Einstellung bzw. die Absicht, so sind für die Neo-Muslima auch Grenzgänge in Hinsicht auf islamische Vorschriften möglich (siehe Nökel, 2002: 154). Insofern ist die Befolgung islamischer Regulationen primär in der Hinsicht systematisch, als dass „Ritus [und] Lebensstil“ zu einer Einheit zusammengeführt werden (Nökel, 2002: 74). In der Ausführung jedoch bleibt die Stärke und Integrität der eigenen Persönlichkeit für die Neo-Muslima die maßgebende Autorität (siehe z.B. Nökel, 2002: 154). Indem sich die jungen Frauen als souveräne und zuverlässige Deuterinnen verstehen, erscheint ihnen auch der Imam oder Hoca als Mittler zwischen dem Gläubigen und den Schriften suspekt (siehe Nökel, 2002: 51). Ebenso ist die Zugehörigkeit zu den islamischen Dachverbänden bzw. Verbänden wie Milli Görüs eher ein seltenes Phänomen (vgl. Nökel, 1999: 127). Austausch und Diskussion über die Anwendung islamischer Regulationen auf die eigene moderne Lebenswelt, also die gemeinsame Suche eines „praktischen weiblichen Islam“ findet eher innerhalb von Mädchen- und Frauengruppen statt (siehe Nökel, 2002: 46/52).
Bezüglich des religiösen Zugangs der Neo-Muslima ist also die Tendenz zu einer Individualisierung religiöser Lebensweise auf der Basis der dialoghaften, skriptural orientierten Auseinandersetzung mit dem Islam erkennbar. Dass die Erarbeitung eines „wahren“, von aufgesetzten Traditionen befreiten Islam hier nicht eine Sehnsucht nach einer originär-islamischen, medinensischen Gesellschaftsvorstellung bedeutet, sondern im Gegenteil auf eine zeitgenössische, lebensnahe Interpretation von Koran und Sunna abzielt, zeigt sich ebenso (siehe auch Nökel, 2002: 59). Wichtig ist dabei, dass die jungen Frauen von dem intellektuellen und ethischen Kapital Gebrauch machen, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt erworben haben. Dass dieses Kapital auf den Ideen der Moderne fußt, wird besonders in der Rolle des Individuums als selbstbestimmtes Subjekt deutlich, das sich der Verantwortung über sein Handeln bewusst ist und somit im (Bedeutungs-)Zentrum der religiösen Deutung und Lebensweise steht (siehe auch Nökel, 2002: 58; siehe Klinkhammer, 2000: 270). Der Islam, der hier in erster Linie in Form des Koran und der Sunna eine Rolle spielt, dient demnach als eine Art „Baukasten“, dessen Inhalte nicht willkürlich, aber im Rahmen der religiösen Eigenverantwortung und Intellektualisierung zu einer umfassenden, Sinn gebenden und individuellen Lebensgestaltung gebraucht wird (vgl. Nökel, 2002: 24).
4.2. Moderne Perspektiven im islamischen Gewand – Neo-Muslimische Emanzipationsbestrebungen
Bereits in den „vorislamischen“ Biographien der Neo-Muslima bestehen emanzipative Bestrebungen. Zunächst steht dieser Prozess im Kontext einer konkreten Benachteiligung im Bildungssystem, welche die jungen Frauen aufgrund ihrer Herkunft aus der „Gastarbeiter-Klasse“[36] erfahren: Trotz der ungleich schwierigeren Startvoraussetzungen erarbeiten sich die Mädchen oftmals den Rang der Klassenbesten und schaffen sich so die Grundlage für einen individuellen sozialen Aufstieg (siehe Nökel: 2002: 139). Die Idee der Bildungskarriere bzw. der späteren „doppelten Lebensführung“ durch die Vereinbarung von Beruf und Familie zeigt dabei ein weibliches Selbstverständnis, das den Ansprüchen der Moderne durchaus genügt (siehe Nökel, 2002: 145). Begründet ist dieses nicht nur in der reinen Notwendigkeit die ökonomische Position zu verbessern, sondern in einer Überzeugung von einem universalistischen Geschlechtermodell (siehe Nökel, 2002: 189). Sowohl die Biographien der Mütter, deren Rolle sich aufgrund fehlender Bildung meist auf die der Haus- oder Putzfrau oder der Fabrikarbeiterin beschränkt als auch teils als unangebracht patriarchal und einschränkend empfundene Verhältnisse innerhalb der eigenen Familie dienen als Nährboden für das Streben nach einem Frauenbild, das sich durch Geschlechteregalität und Souveränität auszeichnet (siehe Nökel, 2002: 146,190/191; siehe Klinkhammer, 2000: 124).
Im Kontext der Islamisierung ist das Projekt der Emanzipation daher ein zentrales Moment. Zu Anfang steht die Entdeckung, dass der Islam nicht nur als Durchsetzungsmittel eines patriarchalischen Regiments nützt, sondern dass durch die Aneignung des Quellenwissens und intellektueller Reflektion der Islam in den Dienst emanzipativer Lebensziele gestellt werden kann. Dies gilt insbesondere innerhalb der muslimisch geprägten Umwelt: Mit Hilfe einer den weiblichen Interessen opportunen, aber stringenten islamischen Argumentation können sie sich so bspw. Freiräume innerhalb der Familie und deren Umkreis erstreiten (siehe Klinkhammer, 2000: 250). Indem sie sich so als souveräne, versierte Exegetinnen des Islams darstellen und sich somit der islamischen, sozio-kulturellen Codes bemächtigen und nicht vom „westlichen“ Standpunkt für ihre Position streiten, können sie so die sozialen Regulationen zugunsten der eigenen Ziele und Position beeinflussen, Unabhängigkeit und Respekt erlangen (siehe Nökel, 1999: 135).[37].
In diesem Zusammenhang stellt das Kopftuch einen interessanten, hinterfragenswerten Aspekt dar. Von den universalistischen bzw. feministischen Stimmen in der Diskussion immer wieder als der Punkt angeführt, an dem angeblich eine der islamischen Lehre immanente Rückständigkeit bzw. ihre Verhaftung in obsoleten, patriarchalen Geschlechterverhältnissen festgemacht werden kann, verändert sich die Deutung und Bedeutung des Kopftuchs für die Neo-Muslima abhängig von den Kontexten (siehe dazu Kapitel 3.3). In Bezug auf die private religiöse Praxis steht das Kopftuch zunächst, gemäß der eigenen Interpretation, für die strenge Gläubigkeit, für eine vollkommene Unterwerfung unter Allah und dient im Alltag als „leibgebundenes Memorial individueller Perfektion und Selbstdisziplinierung“ in Hinblick auf die religiöse Lebensweise (Nökel, 2002: 95).[38] Insofern wird es von den Neo-Muslima als unverzichtbarer, äußerer Part einer „wahren“ Muslima gesehen (vgl. Nökel, 2002: 93; vgl. Klinkhammer, 2000: 276). Essentiell ist hierbei jedoch die eigene Wahl. So wird das Kopftuch eindeutig abgelehnt, wenn es z.B. durch autoritären Zwang der Eltern oder Dritter als Zeichen irrationalen Gehorsams und Unterdrückung erscheint (vgl. Nökel, 2002: 117). In Bezug auf die zwischengeschlechtlichen Verhältnisse wird das Tuch nicht als Rückzug in die Passivität oder als Verhüllung der eigenen Persönlichkeit empfunden, sondern gerade als Zeichen der Selbstbehauptung und als Mittel der Selbstbestimmung. Dies gilt innerhalb des familiären bzw. muslimisch geprägten Raums, in dem sich die Neo-Muslima bewegen als auch für die Begegnungen innerhalb der nicht-muslimischen Gesellschaft – jedoch auf unterschiedliche Art und Weise. So bietet es Schutz vor einem zum Nachteil der Frau „sexistisch aufgeladenen öffentlichen Raum“ (Klinkhammer, 2000: 279). Durch die Zurücknahme der eigenen sexuellen Reize wird der Mann nur noch mit der „Persönlichkeit“ und nicht mehr vorrangig mit dem „Körper“ konfrontiert (vgl. Klinkhammer, 2000: 279). Sie entziehen sich somit einer potenziellen Betrachtung als Objekt männlicher sexueller Projektion. Durch die Benutzung islamischer Zeichen gewinnen sie – zumindest vonseiten der muslimischen Umgebung - Respekt sowie auch Vertrauen in ihre Integrität und eigenverantwortliche Handlungsfähigkeit (siehe Klinkhammer, 2000: 250, 280/281). Zu erkennen ist hier eine auf moderne Ideen der universellen Gleichheit sowie weibliche Selbstbestimmung abzielende Position, die jedoch von der Warte eines auf „westliche“ Zeichen und Habitus beschränkten Feminismus nicht als solche zu erkennen ist (siehe dazu auch Rommelspacher, 2002: 114ff.).
In der Auseinandersetzung mit der nicht-muslimischen Gesellschaft erhält das Tuch eine Bedeutung, die als individual-politisch bezeichnet werden kann (siehe dazu Nökel, 2002: 93). Zunächst ist es ein Zeichen partikularistischer Forderung, Anerkennung als Gleiche unter der Prämisse der individuellen Andersartigkeit zu erhalten (siehe Klinkhammer, 2000: 272; vgl. Nökel, 2002: 150). Insbesondere in der Berufswelt erscheint die Konfrontation als Kampf um Selbstbehauptung, der sich sowohl auf die eigene Person wie auch auf die Rehabilitierung des Islams innerhalb der deutschen Gesellschaft bezieht (siehe Nökel, 2002: 277/278). Letzteres erscheint dabei mit ersterem unweigerlich verbunden zu sein, da die Frauen immer wieder Fremdessentialisierungen vonseiten der Nichtmuslime erfahren, die auf stereotypisierten Bildern des „Gastarbeiter-Islam“ der ersten Generation gründen. Eine Informantin Nökels bringt das Fremdbild auf die Formel: „Kopftuch, Analphabet, nix deutsch.“ (Nökel, 2002: 151). Die sprachliche und berufliche Kompetenz, die moderne Erscheinung (z.B. durch betont modische Kleidung) und das Kopftuch sind eine sehr bedachte Kombination der Neo-Muslima, die darauf abzielt, Stereotype zu dekonstruieren und das angeblich Widersprüchliche miteinander zu verbinden: Moderne, selbstbewusste Weiblichkeit und islamischer Glaube bzw. Habitus (siehe Nökel, 2002: 170, 174). Das Tuch stellt in ihrer eigenen Biographie zumeist ein „Fanal weiblicher Selbstbehauptung“ dar, das als Krönung am Ende der eigenen emanzipativen, islamischen Entwicklung steht (Nökel, 2002: 157; siehe Klinkhammer, 2000: 277, 280; siehe oben). Ein Verzicht auf das Tuch würde zwar die Arbeitssuche, die sich für die Kopftuchträgerinnen besonderes schwierig gestalten, erleichtern, aber einer Verleugnung ihrer Entwicklung gleichkommen (siehe Nökel, 2002: 151 ff.).
Ebenso würde es die Bemühung konterkarieren, die Vereinbarkeit von integrierter moderner Lebensführung und islamischer Religiosität zu demonstrieren und somit die gängigen deutschen Fremdbilder zum Islam zu widerlegen. Die Motivationen, die hinter diesem Projekt stehen, werden des Weiteren im folgenden Abschnitt erläutert.
4.3. Alternative Bezugspunkte - Die islamische Persönlichkeit als Ausweg aus dem Dilemma „Ethnisch vs. National“
Die Hinwendung zum Islam, die wie bereits erwähnt, meist in der späteren Phase der Pubertät stattfindet, dient in erster Linie als „Akt der Selbstbestimmung, der […] auf sich selbst gerichtet ist“ – (Nökel, 2002: 101). Dass es sich zumindest aus der subjektiven Sicht der Frauen um eine Art Identitätssuche und deren erfolgreiches Ende handelt, wird aus Aussagen wie z.B. „’Ich habe meine Religion gefunden’“ und „’Das war, was ich schon immer gesucht habe’“ deutlich (Nökel, 1999: 127, siehe auch Klinkhammer, 2000: 126). Wie bereits in Kapitel 3.3 dieser Arbeit dargelegt wurde, wird im derzeitigen Migrationsdiskurs der Islam zumeist als signifikantes Spezifikum der türkischen Kultur und islamische Religiosität im Rückschluss als Zeichen der Verhaftung in ethnischen Strukturen und den damit verbundenen traditionellen Lebensweisen erkannt. Was die Bezugsgröße für „das Ethnische“ in diesem Diskurs ist, wird nicht vollkommen klar, unter anderem deshalb, weil sich die Untersuchungen immer wieder auf Symptome eines angeblichen „ethnischen Rückzugs“ wie Mediennutzung, Heiratsverhalten oder auch die Religiosität beziehen, jedoch z.B. nicht die dahinter stehenden Kognitionen bzw. Motive erfragen (siehe Kapitel 3.1.). So schwammig dieses Ethnische inhaltlich sein mag, es scheint letztlich mit der Kultur der Gastarbeiter-Generation gleichgesetzt zu werden, die als gesellschaftlich segregiert gilt und so am ehesten als Repräsentant der so genannten Herkunftskultur und deren Werte dasteht (siehe Kapitel 3.1).[39] Diese Definition spiegelt sich auch in den Kognitionen der Neo-Muslima zum türkisch Ethnischen wieder, die wiederum nicht unbedeutend von den negativen Fremdbildern der Mehrheitsgesellschaft beeinflusst sind (vgl. Nökel, 1999: 128). Untersucht man das Verhältnis der islamischen Identität der Neo-Muslima zu ihrer ethnischen Herkunft, so wird deutlich, dass die Islamisierung in diesem Kontext eine eindeutige Abgrenzung von dieser bedeutet (vgl. Nökel, 1999: 128/129). Das Gastarbeiter-Milieu erscheint, wie bereits in den Kapiteln 4.1 und 4.2 erwähnt, als Gegenpol zu der eigenen sozialen Position und Grundüberzeugungen.
Während „das Ethnische“, das in Form des typisch „Türkischen“ der elterlichen Tradition und Lebensweise auftaucht, von den jungen Frauen abgelehnt wird, ist die subjektive Wahrnehmung in der vor-islamischen Zeit von der Ahnung bestimmt, dass man auch trotz eindeutiger Zeichen der Anerkennung und des Integriertseins innerhalb der Gesellschaft aufgrund des türkischen Hintergrunds „die Andere“ bzw. „Fremde“ ist und damit zumindest indirekt dem Gastarbeiter-Milieu zugeordnet wird (vgl. Nökel, 1996, 282; siehe Klinkhammer, 2000: 163). Dabei geht es nicht um Erfahrungen offenen Rassismus’, sondern um feinere Formen der Diskriminierung durch indirekte Zuordnungen zu „den Türken“ bzw. „den Muslimen“, also der „alltägliche[.] ‚Distinktionismus’“, der jedoch nicht immer in einer negativen Form[40] auftritt (Nökel, 2002: 15, 139; siehe Nökel, 1996: 294; siehe Klinkhammer, 2000: 247). Jedoch vermittelt dies die Gewissheit, dass das „Deutschsein“ denen, die sich nicht auf „deutsche Wurzeln“ berufen können, trotz erkennbarem „deutschen“ Habitus unzugänglich bleibt (siehe Kapitel 3.2 dieser Arbeit). Diese Form der alltäglichen, oft sehr subtilen Stilisierung zur „Fremden“ durch die Umwelt, stellt schließlich, so Klinkhammer, einen wichtigen Motivationsfaktor für die anfängliche Beschäftigung mit dem Islam dar (siehe Klinkhammer, 2000: 252).
Der Islam bietet in dieser Hinsicht einen Ausweg, indem er als Teil der eigenen, authentischen, „anderen“ Kultur reklamiert werden kann und somit zumindest im Rahmen der Identitätssuche ein vergeblich erscheinendes Assimilationsstreben nichtig werden lässt (siehe Nökel, 1999: 129/130). Außerdem können sich die Frauen durch die Annahme der Differenz als Teil ihrer authentischen Identität die Fremdbilder, deren Projektionsfläche sie bis dahin trotz ihres „deutschem“ Habitus waren, bemächtigen und durch die Kombination vermeintlich widersprüchlicher Zeichen (wie z.B. anhand des Kopftuchs in Kapitel 4.2. erläutert) in Frage stellen (siehe Nökel, 2002: 264/265).
Auch wenn der Islam in der Wahrnehmung durch die nichtmuslimische Gesellschaft zunächst mit dem Gastarbeiter-Klischee belastet ist, so lässt sich aus ihm aufgrund seiner reichen Geschichte und des Deutungsspielraums seiner schriftlichen Urquellen eine gleichwertige, auch auf dem Prinzip der Rationalität gründenden „Gegenkultur“ herausarbeiten (Nökel, 1999: 129; siehe Klinkhammer, 2000: 253). Davon wird aber im Verständnis der Neo-Muslima ihre Zugehörigkeit zur Gesamtgesellschaft nicht berührt (siehe Nökel, 2002: 20). Es geht ihnen bei ihrem Projekt eines modernen Islam nicht um einen gesellschaftlichen Umsturz oder eine Segregation in eine islamische Gemeinschaft (vgl. Nökel, 1996: 277). Eine islamische Kollektivierung erscheint in diesem Sinn ebenso wenig wünschenswert, wie eine ethnische. Dies zeigt sich in der Skepsis gegenüber größeren islamischen Vereinigungen (vgl. Klinkhammer, 2000: 288). Wie bereits erwähnt, ist das Individuum und seine eigene religiöse Deutung der Kern des neo-islamischen Selbstverständnisses. Eine ideologisch verbrämte Vergemeinschaftung würde nicht in dieses Konzept passen. Zwar steht der individuelle Kampf um Anerkennung des „Anderssein“ in einer Gesellschaft, in der keine vollkommene Assimilation möglich erscheint, auch in Bezug zu einem größeren Projekt einer Aufklärung über den modernen Islam (vgl. Klinkhammer, 2000: 289). Daraus kann jedoch nicht das Streben nach dem Aufbau einer islamischen „Parallelgesellschaft“ mit eigenen Strukturen erkannt werden, sondern eher der Versuch eine gleichberechtigte Teilhabe in einer multikulturellen Gesellschaft zu erwirken. Der Blick in die persönlichen Lebenswege der Neo-Muslima zeigt, dass sich die Frauen weder in Bildung und Beruf noch in der Wahl der Kontakte aus dem nicht-muslimischen Umfeld in eine islamische Nische zurückziehen (siehe Nökel, 2002: 147 ff.). Dieses stände auch in einem Widerspruch zu dem Projekt dar, sich als diskursfähige, moderne Muslimin darzustellen und als solche Anerkennung zu erlangen; hierbei ist der Austausch mit den Nichtmuslimen auf der alltäglichen Bühne der Berufswelt und Schule ein elementarer Bestandteil (siehe Nökel, 2002: 167, 277/278).
Allerdings bleibt fraglich, wie erfolgreich diese Politik des Individuums, das Fremdbild „Islam“ neu zu konnotieren, sein kann und ob die Exklusion, die sie durch die Umwelt erfahren unter den Zeichen der Zeit nicht als „selbstgemachte Desintegration“ gedeutet wird.
5. Resümee
Das Ziel dieser Arbeit war es, die Islamisierung innerhalb der Zweiten Generation der Gastarbeiter und ihre Auswirkung auf den Integrationsstatus innerhalb der Gesellschaft zu untersuchen. Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass sich die Islamisierung in der Bundesrepublik als sehr heterogenes Phänomen zeigt, welches in der wissenschaftlichen als auch gesellschaftlichen Debatte nicht lapidar unter dem Begriff „der Islam“ zusammengefasst werden kann. Im gleichen Zuge stellen sich die geläufigen Fremdbilder und Konnotionen zum Islam in Frage, die nicht unwesentlich in die etische Betrachtung der islamischen Lebenskulturen durch die Migrationsforschung mit einfließen.
Die hier dargestellte Variante religiöser Lebensweise der so genannten Neo-Muslima, die im religiösen Sinne als fundamental gelten kann, erscheint zunächst u. a. durch religiöse Symbole wie das Kopftuch und der strengen Orientierung an dem „wahren“, skripturalen Islam als Sinnbild fundamentalistischer Religiosität und würde gemäß migrationswissenschaftlicher Deutung so am ehesten als „Konservierung ethno-kultureller Identitäten“ bewertet werden. In der Untersuchung der kognitiven Konzepte der Neo-Muslima lässt sich jedoch weder per se eine Auflehnung gegen die modernen Werte der säkularen Gesellschaft im Sinne eines „Kampf der Kulturen“ noch ein Integrationsdefizit oder „Rückfall ins Ethnische“ erkennen.
Ganz im Gegenteil wird deutlich, dass sich es sich um eine Form der Synthetisierung eines individualisierten, religiösen Lebensstils handelt, der fest im Boden rationalistischen und universalistischen Denkens verwurzelt ist und der auf das im deutschen Bildungssystem erlangte Bildungskapital zurückgreift. Gerade durch die Veränderung der sozialen Ausgangslage als so genannte Bildungsaufsteigerin und dem eigenen intellektuellen Anspruch stellt das „Ethnische“, dass von den Neo-Muslima von der Lebensweise, der traditionalistischen religiösen Praxis, patriarchaler Verhältnisse und auch dem niedrigen Bildungs- und Sozialstatus der elterlichen Migrantengeneration repräsentiert wird, keinen alternativen Bezugspunkt dar. Gleichzeitig erleben sie sich aufgrund ihrer türkischen Herkunft die alltägliche Distinktion als „Andere“ bzw. „Fremde“, wodurch sie der deutschen Gesellschaft als potenzielle Projektionsfläche dieses Etiketts der Minderwertigkeit der türkischen Gastarbeiter dienen. Die Islamisierung bedeutet in diesem Kontext sich der Fremdbilder zu bemächtigen, sie durch den eigenen modernen islamischen Habitus zu widerlegen und in diesem Rahmen soziale Anerkennung in der Gesellschaft unter der Prämissen der individuellen „Andersartigkeit“ zu gewinnen. Nicht die Zugehörigkeit zur Gesellschaft im Sinne von Integration oder Des-Integration wird innerhalb dieses Projekts zur Disposition gestellt, sondern der Platz der Zweiten Generation in der sozialen Hierarchie der Gesamtgesellschaft.
Die Migrationsforschung, die die soziale Klassen- und Anerkennungsproblematik der Zweiten Generation bereits erkannt hat, schuldet dem Phänomen der kulturellen Hybridität einen präziseren und weniger von Idealkulturen geleiteten Blick. Im Falle der Neo-Muslima werden die in den unterschiedlichen Sozialisationsfeldern angeeigneten kulturellen Komponenten zu einer eigenen, in alle Richtungen –also sowohl in der muslimischen als auch deutschen Gesellschaft- kommunikationsfähigen Kultur verquickt. Im Zuge dessen können sich auch die Bedeutungen der Symbole verändern bzw. umgedeutet werden wie z.B. anhand des Kopftuch als Zeichen eines „wahren“ egalitären Islams im Kontrast zu einem patriarchalischen Islam der Traditionen deutlich wurde.
Angesichts der großen Heterogenität kann bezüglich der zukünftigen bürgerlichen Etablierung der muslimisch geprägten Minderheit in der Bundesrepublik keine Prognose abgegeben werden. Es ist fraglich, als wie durchsetzungsfähig sich die Position der Neo-Muslima in der muslimischen Landschaft der Bundesrepublik aber auch der Gesamtgesellschaft erweisen wird. Angesichts der geringen Institutionalisierung und Organisation der Neo-Muslima ebenso wie ihrer individualistischen Ausrichtung scheint es unwahrscheinlich, dass ihre gesellschaftspolitische Wirkung über den Rahmen des Individuellen hinausgehen wird. Ebenso geben die derzeitigen Umstände des wachsenden Skeptizismus gegenüber multikulturellen Konzepten und insbesondere islamischer Religiosität, die auch an ökonomische Ängste gebunden sind, und der gesellschaftlichen Nützlichkeit des „Fremden“, wenig Hoffnung, dass sich die Gesamtgesellschaft auf die komplexen Selbstkonzepte, die sich unter „dem Kopftuch“ befinden, einlässt und altbewährte Fremdbilder in Frage stellt.
6. Bibliographie:
Anhut, Reimund; Wilhelm Heitmeyer: Desintegration, Konflikt und Ethnisierung. Eine Problemanalyse und theoretische Rahmenkonzeption. In: Reimund Anhut, Wilhelm Heitmeyer (Hrsg.): Bedrohte Stadtgesellschaft. Soziale Desintegrationsprozesse und ethnisch-kulturelle Konfliktkonstellationen. Juventa: Weinheim, München, 2000, S. 17-75.
Anthias, Floya; Nira Yuval-Davis: Racialized boundaries. Race, nation, gender, colour and class and the anti-racist struggle. Routledge: London, New York, 1993.
Auernheimer, Georg: Der sogenannte Kulturkonflikt. Orientierungsprobleme Ausländischer Jugendlicher. [o. V.]: Frankfurt a. M., 1988.
Bukow, Wolf-Dietrich: Feindbild Minderheit: Zur Funktion von Ethnisierung. Leske+Budrich: Opladen,1996.
Bukow, Wolf-Dietrich: Der Islam. Ein bildungspolitisches Thema. In: Wolf-Dietrich Bukow, Yildiz Erol (Hrsg.): Islam und Bildung. Leske+Budrich: Opladen, 2003, S. 57-80.
Bukow, Wolf-Dietrich; Erol Yildiz: Islam und Bildung. In: Wolf-Dietrich Bukow, Erol Yildiz (Hrsg.): Islam und Bildung. Leske+Budrich: Opladen, 2003, S. 9-18.
Esser, Hartmut; Jürgen Friedrichs (Hrsg.): Generation und Identität. Theoretische und empirische Beiträge zur Migrationssoziologie. [o.V.]: Opladen, 1990.
FES - Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.): Die soziale und politische Partizipation von Zuwanderern in der Bundesrepublik Deutschland. Friedrich Ebert Stiftung: Bonn, 1998.
Heckmann, Friedrich: Ethnische Minderheiten, Volk und Nation: Soziologie interethnischer Beziehungen. [o.V.]: Stuttgart, 1992.
Heinz, Marco: Ethnizität und ethnische Identität. Eine Begriffsgeschichte. Mundus Reihe Ethnologie Bd. 72. Holos: Bonn, 1993.
Hoffmann-Nowotny; Hans-Joachim: Integration, Assimilation und die “Plurale Gesellschaft“. Konzeptuelle, theoretische und praktische Überlegungen. In: Charlotte Höhn, Detlev B. Rein (Hrsg.): Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland. [o.V.]: Boppart am Rhein, 1990: S.15-31.
Kaufmann, Franz-Xaver: Elemente einer soziologischen Theorie sozialpolitischer Intervention. In: Franz-Xaver Kaufmann: Staatliche Sozialpolitik und Familie. [o.V.]: München, Wien, 1982, S. 49-86.
Klinkhammer, Gritt: Moderne Formen islamischer Lebensführung. Eine qualitativ-empirische Untersuchung zur Religiosität sunnitisch geprägter Türkinnen in Deutschland. Diagonal: Marburg, 2000.
Lajios, K[?]: Familiäre Sozialisations-, soziale Integrations- und Identitätsprobleme ausländischer Kinder und Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland. In [Hrsg.?]: Die zweite und dritte Ausländergeneration. Ihre Situation und Zukunft in der Bundesrepublik Deutschland. Leske+Budrich: Opladen, 1991, [S.?].
Laviziano, Alex; Corinna Mein, Martin Sökefeld: To be German or not to be… - Zur „Berliner Rede“ des Bundespräsidenten Johannes Rau. Ethnoscripts. 3. Jg. 1 (2001), S. 39-53.
Manfrass, Klaus: Türken in der Bundesrepublik. Nordafrikaner in Frankreich. Ausländerproblematik im deutsch-französischen Vergleich. Bouvier: Bonn, Berlin, 1991.
Mihciyazgan, Ursula: Die religiöse Praxis muslimischer Migranten. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung in Hamburg. In: Ingrid Lachmann, Wolfram Weiße (Hrsg.): Dialog zwischen den Kulturen: Erziehungstheoretische und religionspädagogische Gesichtspunkte interkultureller Bildung. [o.V]: Münster, New York, 1994, S. 195-206.
Nökel, Sigrid: “Ich habe ein Recht darauf, meine Religion zu leben“: Islam und zweite Migrantengeneration in der Bundesrepublik Deutschland. In: Günther Schlee, Karin Werner (Hrsg.): Inklusion und Exklusion. Rüdiger Köppe: Köln, 1996, S. 275- 303.
Nökel, Sigrid: Islam und Selbstbehauptung – Alltagsweltliche Strategien junger Frauen in Deutschland. In: Klein-Hessling, [?]; Sigrid Nökel, [?] Werner: Der neue Islam der Frauen. Transcript: Bielefeld, 1999, S. 124-146.
Nökel, Sigrid: Die Töchter der Gastarbeiter und der Islam. Zur Soziologie alltagsweltlicher Anerkennungspolitiken. Eine Fallstudie. Transcript: Bielefeld, 2002.
Polat, Ülger: Soziale und kulturelle Identität türkischer Migranten der Zweiten Generation in Deutschland. Dr. Kovac: Hamburg, 1997.
Rommelspacher, Birgit: Anerkennung und Ausgrenzung. Deutschland als multikulturelle Gesellschaft. Campus: Frankfurt a.M., New York, 2002.
Sauer, Martina: Die Einbürgerung türkischer Migranten in Deutschland. Befragung zu Einbürgerungsabsichten und dem Für und Wider der Einbürgerung. In: Andreas Goldberg, Dirk Halm und Martina Sauer (Hrsg.): Migrationsbericht des Zentrums für Türkeistudien 2002. Bd. 4. LIT: Münster, Hamburg, Berlin, London, 2001, S. 165-228.
Schiffauer, Werner: Migration and Religiousness. In: Tomas Gerholm, Yngve Georg Lithman (Hrsg.): The New Islamic Presence in Western Europe. [o.V.]: London, New York, 1988, S. 146-158.
Schiffauer, Werner: Fremde in der Stadt. Suhrkamp: Frankfurt a.M., 1997.
Schily, Otto: Vorwort. In: Andreas Goldberg, Dirk Halm und Martina Sauer (Hrsg.): Migrationsbericht des Zentrums für Türkeistudien 2002. Bd. 4. LIT: Münster, Hamburg, Berlin, London, 2001, S. 5.
Schneider, Jens: Deutsche Identität in der Berliner Republik. Ethnoscripts. 3. Jg. 1 (2001), S. 10-24.
Sen, Faruk; Hayrettin Aydin: Islam in Deutschland. C.H. Beck: München, 2002.
Sen, Faruk; Martina Sauer und Dirk Halm: Intergenerative Verhalten und (Selbst)Ethnisierung von türkischen Zuwanderern. Gutachten des ZfT für die Unabhängige Kommission “Zuwanderung“. In: Andreas Goldberg, Dirk Halm und Martina Sauer (Hrsg.): Migrationsbericht des Zentrums für Türkeistudien 2002. Bd. 4. LIT: Münster, Hamburg, Berlin, London, 2001, S. 11-126.
Sökefeld, Martin: Der Lehr- und Forschungsschwerpunkt “Ethnizität und interethnischer Beziehungen“ am Hamburger Institut. Ethnoscripts. 3. Jg. 1 (2001), S. 1-9.
Strobel, Rainer; Wolfgang Kühnel, Wilhelm Heitmeyer: Junge Aussiedler zwischen Assimilation und Marginalität. Abschlussbericht (Kurzfassung). Bericht des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und Sport NRW. Düsseldorf, 2000.
Taylor, Charles: Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung. Fischer: Frankfurt a.M., 1997.
Teczan, Levent: Kulturelle Identitäten und Konflikt. Zur Rolle politischer und religiöser Gruppen in der türkischen Minderheitsbevölkerung. In: Heitmeyer, Wilhelm; Reimund Anhut (Hrsg.): Bedrohte Stadtgesellschaft. Soziale Desintegrattionsprozesse und ethnisch-kulturelle Konfliktkonstellationen. Juventa: Weinheim, München, 2000, S. 401-448.
Tietze, Nikola: Muslimische Identitäten. In: Wolf-Dietrich Bukow, Erol Yildiz (Hrsg.): Islam und Bildung. Leske+Budrich: Opladen, 2003, S. 83-91.
Thadden, Rudolf von: Aufbau nationaler Identität. Deutschland und Frankreich im Vergleich. In: Bernhard Giesen (Hrsg.): Nationale und Kulturelle Identität. Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewusstseins in der Neuzeit. Suhrkamp: Frankfurt a.M., 1991, S. 493-510.
White, Jenny B.: Turks in the New Germany. American Anthropologist.[?. Jg.] 4 (1999), S. 754-769.
[...]
[1] Der Begriff ist von Nökel geprägt worden und wird von ihr wie folgt erläutert: „Die Begriffe Neo-Islam und Neo-Muslime werden [..] anstelle der etablierten Begriffe wie Fundamentalismus oder Reislamisierung verwendet, um die negative, assoziative, ideologisch belastete und lokal auf die historisch islamisch geprägten Regionen bezogene Besetzung zu vermeiden. Zudem setzt die Migrationssituation wesentliche spezifische Rahmenbedingungen. Dazu gehört z.B. die Absenz der Forderung von islamisch legitimierbarer politischer Führung“ (Nökel, 1996: 298).
[2] Dies betrifft in diesem Fall die Migrationsforschung in Hinsicht auf die Bundesrepublik Deutschland.
[3] In der Regel waren drei bis fünf Jahre geplant (vgl. Sen/Aydin, 2002: 14).
[4] Die persönliche Motivation zur Arbeit in der BRD war häufig, mit dem erwirtschafteten Einkommen die Lebensgrundlagen in der Türkei zu finanzieren. Parallel zum Anwerbestopp war die wirtschaftliche und auch politische Situation in der Türkei sehr unsicher, weshalb bei einer Rückkehr u. a. auch die Verwirklichung des Migrationsziels unsicher erschien (siehe Sen/Sauer/Halm, 2001: 14/15).
[5] 1982 hatte die Anzahl türkischer Migranten zeitweise ihren Höchststand (1,581 Millionen) erreicht. Durch die Anreize staatlicher Rückkehrförderungsprogramme sank die Zahl leicht (1985: 1,402 Mio), stieg jedoch wieder an, so dass im Jahr 2002 rund 2,4 Millionen „Bürger türkischer Herkunft“ in der BRD lebten (siehe dazu Manfrass, 1991: 1; Sen et. al., 2001: 14).
[6] Bezeichnung für die Kinder der Arbeitsmigranten, die entweder in Deutschland geboren oder in ihren ersten Lebensjahren migriert sind (siehe Polat, 1997: 9).
[7] Zu nennen sind hier insbesondere die DITIB (Diyanet Isleri Türk-Islam Birligi – Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion), der Islamrat, IGMG (Islamische Gemeinde Milli Görüs – Nationale Weltsicht), der ZMD (Zentralrat der Muslime in Deutschland), die VIKZ (Verband der Islamischen Kulturzentren e.V.) und die Föderation der türkisch-demokratischen Idealistenvereine in Europa e.V. (Graue Wölfe). Letzterer gilt als nationalistischer Kulturverein, in dessen Programm aber auch islamische Elemente eine bedeutende Rolle spielen (siehe Klinkhammer, 2000: 88 und FES, 1998: 26-27).
[8] Die klerikale Hierarchie und Institutionalisierung, wie sie innerhalb der christlichen Kirche vorhanden sind, gibt es im Islam im Grunde nicht. Insofern stellt die Organisation in Verbänden eine Annäherung an die kirchlichen Strukturen dar, die für die Gesetzgebung zu religiösen Institutionen maßgebend waren.
[9] Das bedeutet keineswegs, dass die türkischen Gastarbeiter minder qualifiziert waren. Vielmehr verlor die Türkei durch die Arbeitsemigration einen nicht unbedeutenden Teil ihrer Facharbeiter (siehe Manfrass, 1991: 4).
[10] Generationen übergreifend sind es ca. 10% (siehe Sen/Sauer/Halm, 2001: 29).
[11] Der Anteil der Staatsdiener liegt fast unverändert bei 2,2%. Zu der Aufschlüsselung der Zahlen nach kleineren Alterskohorten (siehe Sen/Sauer/Halm, 2001: 29).
[12] Polat verweist hier z.B. auf Studien von Schrader/Nikles/Gries, 1979; Neumann, 1981; Lajios, 1991; Nieke, 1991; Heitmeyer, 1997.
[13] Zum Identitätsbegriff siehe auch White, 1997: 754 und Heinz, 1993: 15-39.
[14] Das folgende Modell orientiert sich an Sen/Sauer/Halm (1997: 17/18), die sich wiederum auf das Schema von Strobel et. al. (2000: 5) berufen. Sen/Sauer/Halm weisen auf eine Reihe weiterer Autoren der soziologischen Migrationsforschung hin, die sehr ähnliche Konzepte verwenden, so z.B.: Kaufmann, 1982: 49-82; Auernheimer, 1988; Esser/Friedrichs, 1990; Hoffmann-Nowotny, 1990: 15-31; Heckmann, 1992; Nauck/Kohlmann/ Diefenbach, 1997: 477-499. Auch Anhut/Heitmeyer teilen die Grundannahmen dieses Modells. Siehe dazu Anhut/Heitmeyer, 2000: 45. Das hier vorgestellte Integrationsmodell ist zudem im Teil des Gutachtens für die Unabhängige Kommission “Zuwanderung“ des deutschen Innenministeriums, wodurch es zumindest im konkreten Rahmen der politischen Integrationskonzepte eine gewisse Definitionsmacht innehaben wird. (Siehe dazu Schily, 2001: 5).
[15] Bei Sen/Sauer/Halm werden als solche Ressourcen Bildung und Zugang zum Arbeitsmarkt verstanden (siehe Sen/Sauer/Halm, 2001: 21-41). Bei Anhut/Heitmeyer sind es „kulturelle[.] und materielle[.] Güter“ (Anhut/Heitmeyer, 2000: 45). Bei Polat werden als Teilhabechancen „Offenheit der sozialen Strukturen und Rechtssicherheit des Aufnahmelandes“, Zugang zu Bildung, Arbeits- und Wohnungsmarkt, sowie die „Möglichkeiten der politischen Mitbestimmung“ genannt (Polat, 1997: 37).
[16] Bei Sen/Sauer/Halm werden z.B. anhand der realen Nutzung des Bildungsangebots und die Position auf dem Arbeitsmarkt sowie Diskriminierungserfahrungen Rückschlüsse auf die Teilhabechancen gezogen (siehe Sen/Sauer/Halm, 2001: 21-41).
[17] Siehe dazu beispielsweise auch die Diskursanalyse „ ‚To be German or not to be…’ - Zur ‚Berliner Rede’ des Bundespräsidenten Johannes Rau“ (Laviziano/Mein/Sökefeld, 2001: 39-53).
[18] Laut Rommelspacher dienen sowohl der „Andere“ als auch der „Fremde“ als „Konstruktion eines Gegenübers“. Sie unterscheiden sich dadurch, dass dem „Fremden gegenüber ein größerer Grad an „Unvertrautheit“ empfunden wird und die Differenz „als symbolische Grenze erfahren wird“ (Rommelspacher, 2000: 11).
[19] Da der Islam eine Religion ist, der man qua Geburt zugehörig ist (obwohl eine Konversion zum Islam für Nicht-Muslime jederzeit möglich ist), trifft dies formell auf die Mehrheit der Türken zu. Allerdings wird oft vernachlässigt, dass sich – primär durch die Atatürk’sche Säkularisierung der Türkei – das Verhältnis der Türken zur islamischen Religion gewandelt hat. Ein generelles Zugehörigkeitsgefühl türkischer Migranten zum Islam kann daher nicht vorausgesetzt werden.
[20] Auch in wissenschaftlichen Studien wird der Islam als ethnisches Spezifikum der türkischen ethnischen Identität behandelt (siehe dazu Sen/Sauer/Halm, 2001: 40).
[21] Die Moscheen und Beträume der türkischen Migranten bestanden in den ersten Jahren des Aufenthalts in den so genannten Hinterhofmoscheen, also profanen Räumlichkeiten, die im Alltag kaum sichtbar waren. Erst mit der Perspektive des längerfristigen Etablierung in der Bundesrepublik wurden repräsentative Moscheen gebaut.
[22] So wurden in den 1990er Jahren durch Themen wie zum Beispiel das Schächten, Moscheenbau, Islamischen Religionsunterricht oder auch die Vereinbarkeit des Kopftuchtragens mit dem Staatsdienst auseinandergesetzt. In den Debatten, die auf allen Diskursebenen geführt wurden, wurden die islamischen Forderungen oftmals als Bedrohung oder Angriff auf die Werte der demokratischen, modernen Gesellschaft diskutiert (siehe dazu Sen/Aydin, 2002: 95-113).
[23] Die Zuschreibung von Irrationalität und Anti-Moderne gilt der Religion im Allgemeinen, wenn von einem Säkularisierungsbegriff ausgegangen wird, der sich als „Rückgang von Religion“ definiert (vgl. Klinkhammer, 2000: 41/42).
[24] Der Frau wird nach Anthias und Yuval-Davis in patriarchalen Gesellschaften die Funktion eines Symbols, eines „marker of cultures“ zugewiesen (Anthias/Yuval-Davis, 1993: o. S. zitiert in Rommelspacher, 2002: 113). Die Instrumentalisierung der Frau als Projektionsfläche der eigenen bzw. der fremden Kultur wird auch bei Schneider und White angesprochen (siehe Schneider, 2001: 19; siehe White, 1997: 757-759).
[25] In Whites Schilderungen werden die vermeintlich patriarchalen Verhältnisse in türkischen Migrantenfamilien von deutscher Seite aus als ein Merkmal eines „ ‚traditional’ Turkish behavior“ wahrgenommen (White, 1997: 759). Da die „typischen türkischen“ Habitusformen in der deutschen Wahrnehmung vornehmlich von der Zugehörigkeit zur islamischen Religion abgeleitet werden, wird der Patriarchalismus wohl auch nicht unbedeutend mit dem Islam assoziiert (siehe ersten Abschnitt in 3.3.).
[26] Die Eltern von Nökels Informantinnen stammen nicht nur aus der Türkei, sondern auch aus der nordafrikanischen und arabischen Region (siehe Nökel, 2002: 18). In diese Arbeit, die sich auf die Musliminnen türkisch-sunnitischer Herkunft konzentrieren wird, werden die Ergebnisse von Nökels Studie dementsprechend differenziert einfließen.
[27] Kurz und knapp kann die traditionalisierende Lebensführung als Religiosität bezeichnet werden, die insbesondere auf die Konservierung und Weiterführung von religiöser Familientradition abzielt und daher auch in erster Linie im familiären Bereich bedeutsam ist. Dagegen fasst Klinkhammer unter der universalisierenden Form die spirituell orientierte Religiosität, in der der Islam ebenso wie in der traditionalisiernden Lebensweise nur in bestimmten Lebensbereichen relevant ist (siehe Klinkhammer, 2000: 286-288).
[28] Die Haltung der Neo-Muslima gegenüber der Gesellschaft, auch mit dem Attribut „westlich“, ist nicht ohne Kritik (vgl. Klinkhammer, 2000: 270). Jedoch berührt dies nicht die Tatsache, dass sie sich als vollkommen integriert, also als Teil dieser Gesellschaft sehen (vgl. Nökel, 2002: 20).
[29] So ändern sich z.B. die beruflichen Aspirationen der Neo-Muslima nicht. Zwar gibt es kein kanonisches Verbot weiblicher Berufstätigkeit im Islam, jedoch wird diese selbst von (männlichen) Vertretern eines modernen Islam als moralisch zweifelhaft angesehen, da die Kindererziehung darunter leiden könne (vgl. Nökel, 2002: 186).
[30] Die Sunna setzt sich aus der Sammlung der Überlieferungen (Ahadith) über das Leben, die Traditionen und Aussagen Mohammeds zusammen (siehe Nökel, 2002: 69).
[31] Bezeichnung vonseiten der Neo-Muslima (siehe Klinkhammer, 2000: 130).
[32] So sind dies zum Beispiel die fünf Säulen des Islam und absolut einzuhaltende Verbote und Verpflichtungen (in den Schriften als haram und wajib bezeichnet), die jenseits der eigenen Deutungsmöglichkeit feststehen. Zu den Verboten (haram) gehört z.B. der Genuss von Schweinefleisch (siehe Nökel, 2002: 68ff.).
[33] Als Beispiel hierfür kann die konsequente Ausführung des namaz, dem täglich fünf- bzw. dreimalig durchzuführenden Ritualgebets angeführt werden. Diese, aufgrund des Tagesrhythmus besonders in nicht-muslimischen Gesellschaften schwer einzuhaltende Pflicht, unterscheidet die Neo-Muslima zudem von ihren „traditionalen“ Eltern, die diese Säule des Islams zumeist nicht konsequent oder gar nicht einhalten (Nökel, 2002: 72)
[34] Ahadith sind die zur Sunna zusammengefassten Überlieferungen über das Leben, die Traditionen und Aussagen Mohammeds.
[35] Dies ist laut Klinkhammer ein Prozess, der jeder religiösen Traditionsbildung zugrunde liegt (vgl. Klinkhammer, 2000: 131).
[36] Die Eltern der türkischen Informantinnen in Nökels Studie sind in der Regel Arbeiter bzw. Arbeiterinnen/ Hausfrauen (siehe Nökel, 2000: 126). Der Bildungsgrad der Eltern ist meist gering, insbesondere unter den Müttern finden sich Analphabetinnen, wodurch die elterliche Unterstützung auf dem Bildungsweg sehr beschränkt bleibt. (siehe Nökel, 2002: 190).
[37] Dies gilt nicht nur für die kleinen, alltäglichen Freiheiten, sondern auch für bedeutendere Ereignisse wie z.B. die Ehestiftung durch Eltern oder Verwandte. Durch die eigene Wahl des Ehemannes, der ein „wahrer“ Muslim mit dem gleichen intellektuellen Potenzial und gleichen Vorstellungen bzgl. der Geschlechterbeziehungen sein soll, und des Zeitpunkts der Eheschließung, wird sowohl das eigene Projekt der Selbstverwirklichung (in Hinsicht auf Ausbildung, Berufstätigkeit und geschlechtlicher Egalität) gesichert als auch die persönlichen Ansprüche an die Qualitäten eines Partners (siehe dazu Nökel, 1999: 138/139).
[38] Wie Klinkhammer aus einer eigenen Gegenüberstellung der relevanten Koransuren folgert, geht keine generelle Vorschrift des Kopftuchs aus den schriftlichen Quellen hervor (siehe Klinkhammer, 2000: 273/274).
[39] Inwiefern dies – nicht zuletzt unter Rücksichtnahme auf die Migrationserfahrung, die verbrachte Lebenszeit in der Emigration, unterschiedliche ethnische Zugehörigkeiten (z.B. kurdisch) etc. – überhaupt zutrifft, ist natürlich fraglich.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt der Arbeit über Islamisierung und Integration?
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis von Islamisierung und Integration innerhalb der zweiten Generation türkischer Einwanderer in Deutschland. Sie analysiert, wie sich bikulturelle, moderne und islamisch geprägte Lebenskonzepte auf individueller Ebene herausbilden und welche Rolle der Islam im Integrationsprozess spielt.
Wer sind die Neo-Muslima und was ist ihre Bedeutung in der Arbeit?
Die Neo-Muslima sind junge, in Deutschland aufgewachsene Töchter türkischer Gastarbeiter, die eine besonders radikal erscheinende Variante des Islams verfolgen. Sie stehen im Fokus der Arbeit, um die Integrationsproblematik der zweiten Generation und individuelle Reaktionen darauf näher zu beschreiben.
Welche historischen Hintergründe werden in der Arbeit beleuchtet?
Die Arbeit geht auf die Geschichte der Etablierung türkischer Migranten seit den Anwerbeabkommen der 1960er Jahre in der deutschen Gesellschaft ein. Dabei werden die kulturelle und religiöse sowie die ökonomische und soziale Etablierung der Gastarbeiter und ihrer Nachkommen betrachtet.
Wie wird die Integrationsproblematik der zweiten Generation in der Wissenschaft behandelt?
Die Arbeit untersucht, wie die zweite Generation in Deutschland in Bezug auf ihre bikulturelle Sozialisation wahrgenommen wird und welche Schwierigkeiten sich daraus für ihre soziale Situierung ergeben. Es wird auch analysiert, inwiefern der Integrationsdiskurs systematische Ausgrenzungen durch die Produktion von "Fremdheit" beinhaltet.
Welche Rolle spielt der Islam im Integrationsdiskurs?
Die Arbeit thematisiert, welche Rolle dem Islam in der Auseinandersetzung zwischen der deutschen Mehrheitsgesellschaft und der türkischstämmigen Bevölkerungsgruppe zugewiesen wird. Dabei wird untersucht, ob der Islam als desintegrativer Faktor wahrgenommen wird und welche Auswirkungen dies auf die Integration der zweiten Generation hat.
Wie beeinflusst die Hinwendung zum Islam die Identität und Integration der Neo-Muslima?
Die Arbeit analysiert, in welcher Beziehung die Hinwendung zur islamischen Religion und Lebensführung zum Selbstverständnis der deutschen als moderne Gesellschaft steht. Sie untersucht, inwiefern die islamisch gerahmten Lebenskonzepte mit den Werten und Vorstellungen fusionieren, die die deutsche Gesellschaft als ihr Eigen bezeichnet. Zudem wird hinterfragt, in welchem Verhältnis die Islamisierung zum "ethnischen Kollektiv" steht.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit bezüglich der Integration und Islamisierung?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die Islamisierung ein sehr heterogenes Phänomen ist, das nicht unter dem Begriff "der Islam" zusammengefasst werden kann. Sie argumentiert, dass die Neo-Muslima eine Form der Synthetisierung eines individualisierten, religiösen Lebensstils praktizieren, der fest im Boden rationalistischen und universalistischen Denkens verwurzelt ist und sich am deutschen Bildungssystem orientiert. Dies ermöglicht eine soziale Anerkennung unter den Prämissen individueller "Andersartigkeit".
Welche Literatur wird in der Arbeit verwendet?
Die verwendete Literatur stammt größtenteils aus der Soziologie, Ethnologie und Politikwissenschaft. Bemerkenswert ist, dass sich die Soziologie in einem sehr viel größeren Maße als die Ethnologie systematisch mit dem Thema Migration auseinandergesetzt hat.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die Islamisierung innerhalb der Zweiten Generation nicht per se eine Auflehnung gegen moderne Werte oder ein Integrationsdefizit darstellt. Sie deutet auf eine Synthese eines individualisierten religiösen Lebensstils hin, der fest im rationalistischen Denken verwurzelt ist und soziale Anerkennung sucht, wobei der Islam eine wichtige Rolle spielt. Die Arbeit stellt die Frage, ob diese Politik der Individuen, das Fremdbild "Islam" neu zu konnotieren, erfolgreich sein kann und ob die erlebte Exklusion nicht als "selbstgemachte Desintegration" wahrgenommen wird.
- Citar trabajo
- Caroline Thon (Autor), 2004, Die Neo.Muslima - Islamische Lebensweisen und gesellschaftliche Integration der Zweiten Generation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109598