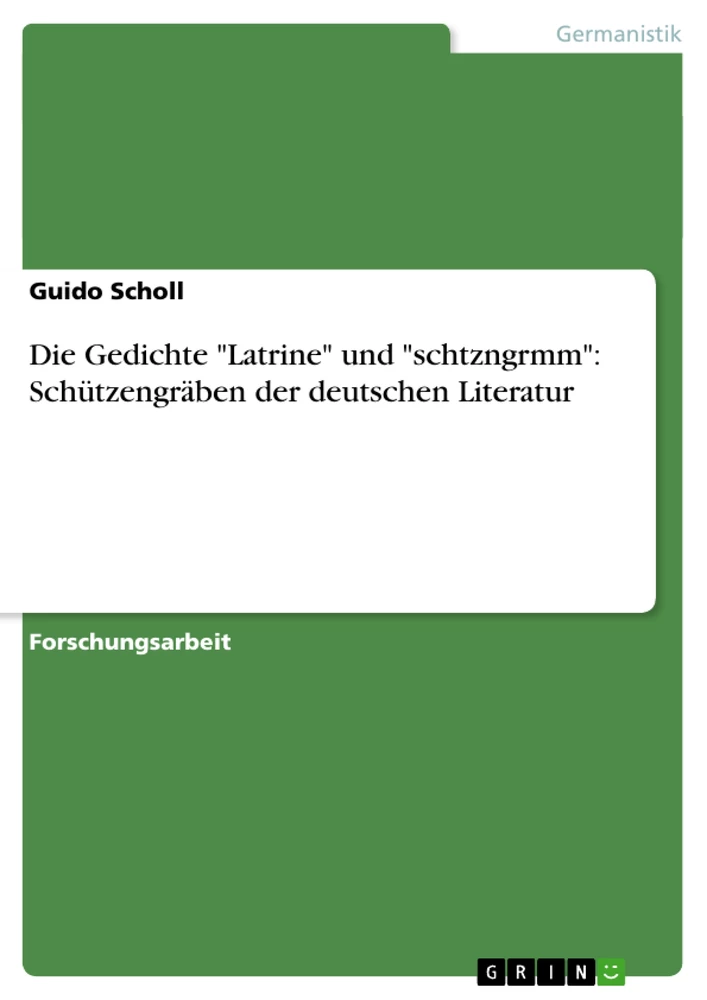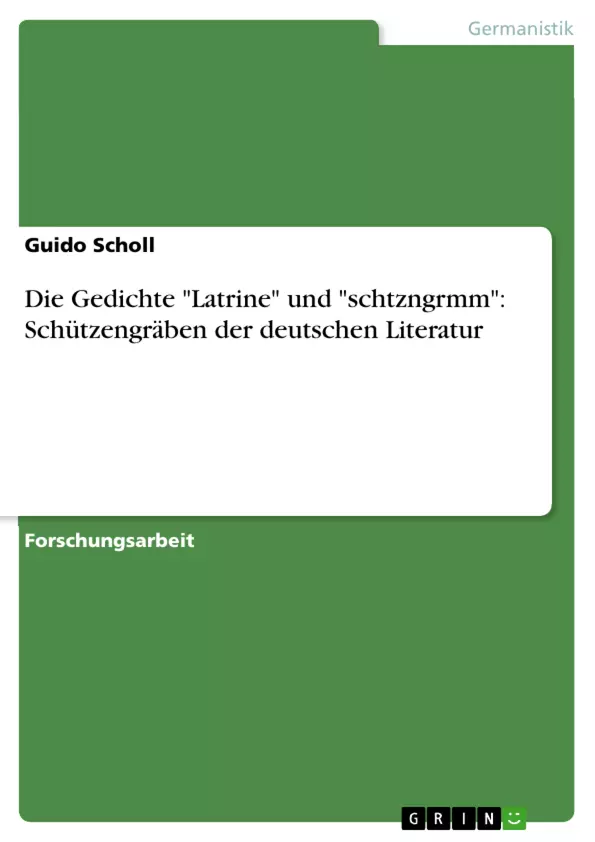1. Einleitung
Das 20. Jahrhundert könnte als das Jahrhundert der Weltkriege in die Geschichte der Menschheit eingehen. Zwar fanden beide Weltkriege bereits in seiner ersten Hälfte statt, aber die Auswirkungen des zweiten Krieges, der seinerseits als Folge des Ersten verstanden werden kann (Hitler bezog sich in seinen Hetzreden oft auf die Versailler Verträge als Grund für die Armut des deutschen Volkes, die wiederum einen Großteil der Bevölkerung zu willigen Gefolgsleuten machte. Ferner wollten viele Nazis die Schuldzuweisung an Deutschland, den Ersten Weltkrieg verursacht zu haben, nicht hinnehmen. Die Scham, die die Niederlage hervorgerufen hatte, machte die „Dolchstoßlegende“ zu einem bevorzugten Propagandawerkzeug gegen Kommunisten und Sozialisten.), reichen weiter als bis in die unmittelbare Nachkriegszeit ab 1945. Eine offensichtliche Folge der auf Hochtouren laufenden Rüstungsindustrie in der gesamten Welt war die Entwicklung der Atombombe und mit ihr der Kernkraftenergie. Auch die Raumfahrt muß als eine Folge der Rüstungsanstrengungen insbesondere des Dritten Reichs verstanden werden, da alle Raumflugkörper bis hin zur ersten Mondlandung von Wernher von Braun (mit-)konstruiert wurden, der von einem Wissen ausging das er erworben hatte während er Hitlers V2 Rakete bauen sollte.
Die politischen Auswirkungen waren ähnlich weitreichend: die Teilung Deutschlands und der eiserne Vorhang in Europa sind noch heute nicht überwunden und erst im vergangenen Jahr konnte endlich ein Beschluß über die Reparationszahlungen an jüdische Holocaust-Opfer verfaßt werden.
Auf kultureller Ebene fällt besonders die Gruppe 47 auf, die in der Nachkriegszeit die Literaturszene im Westen bestimmte, während im östlichen Teil Deutschlands die zurückkehrenden marxistischen Autoren wie Bertolt Brecht, Anna Seghers und Arnold Zweig an die antifaschistische Literatur der Vorkriegszeit anknüpften. Die Gruppe 47 gebrauchte Begriffe wie „Kahlschlagliteratur“ und „Stunde Null“ um einen Neuanfang in der Literatur zu begründen, was einen genau entgegengesetzten Ansatz als den der Autoren der Sowjetischen Besatzungszone darstellt.
Was im ersten Moment wie Verdrängung (Westen) im Unterschied zu Aufarbeitung (Osten) wirkt ist in Wahrheit jedoch viel komplizierter. Ein Neuanfang im sinne einer „Stunde Null“ beinhaltet sehr wohl eine Aufarbeitung der Kriegserlebnisse. Ferner ist die Idee vom radikalen Neuanfang ohnehin problematisch, wie insbesondere die Plagiat-Affäre um den jüdischen Dichter Paul Celan zeigt, der sich in den 50er und 60er Jahren einer Hetzkampagne ausgesetzt sah, die unter anderem (neben Claire Goll) von Personen geführt wurde, die im Dritten Reich führende Geisteswissenschaftler gewesen waren, wie etwa Curt Hohoff.[1]
Zu den Dichtern, die ihre Kriegserlebnisse in ihren Nachkriegstexten weitergeben, zählen auch Günter Eich und Ernst Jandl. Beide nahmen selbst als Soldaten am Zweiten Weltkrieg teil und berichteten auf unterschiedliche Weise davon. Als eine tatsächliche Neuerung in der Literatur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde es zur Normalität, dies auch in lyrischen Texten zu tun, welche vormals mit dem Thema Krieg selten in Verbindung gebracht wurden. Trotzdem stellen Eichs Gedicht „Latrine“ und Jandls „schtzngrmm“ Besonderheiten auch im Bereich der Nachkriegslyrik dar. Beide verkörpern die Sichtweise des jeweiligen Dichters auf einen Schützengraben (des Zweiten Weltkriegs) auf eindrucksvolle Art.
2. Günter Eich
Günter Eich gehört zu den Schriftstellern, die den Weg der sogenannten Inneren Emigration wählten, um während des Dritten Reich existieren zu können. Anders als beispielsweise die Manns, Brecht, Hesse, Remarque, Musil oder Döblin, die in die USA, nach Italien oder in die Schweiz emigriert waren, arbeitete Eich weiter in Deutschland als Schriftsteller, insbesondere als Hörspielautor. Genau wie Gottfried Benn oder Agnes Miegel wurde er später oft des Opportunismus oder sogar der Kollaboration beschuldigt, obwohl sich weder in seiner Biographie noch in seiner Literatur Hinweise auf faschistische oder antisemitische Gesinnungen finden. Zwar wurde sein Hörspiel „Rebellion in der Goldgräberstadt“ gern als faschistisch gleichgeschaltete Propagandaliteratur bezeichnet, bei objektiver Betrachtung fällt es jedoch schwer, dies nachzuvollziehen.
Eich selbst äußerte sich selten zu seiner Tätigkeit zwischen 1933 und 1945. Er war der Ansicht, seine Werke sprächen für sich und beschrieben seine Art des passiven Widerstands deutlich genug.
Während des Kriegs wurde Günter Eich als Soldat im Transportwesen an der Westfront eingesetzt. Seine Aufgaben beschränkten sich auf Truppenversorgung im streng logistischen Sinn, also von Verpflegung über Materiallieferung bis zu medizinischer Hilfe. So kam es, daß er den Krieg unmittelbar aus nächster Nähe erlebte, ohne kriegerische Handlungen selbst vorgenommen zu haben.
Nach dem Fall des Dritten Reichs wurde Eich, nachdem er aus der Kriegsgefangenschaft freigekommen war, Gründungsmitglied der Gruppe 47. Die Auffassung, es müsse einen absoluten literarischen Neuanfang geben, teilte er jedoch nur bedingt. Tatsächlich änderte sich sein Stil weg von dem, was er später als „verspätete Naturlyrik“ oder „verspäteten Expressionismus“ beschrieb[2] und hin zu einer strengen Verknappung des Vokabulars und einer Stimmung von Untergang und Verfall. Zu seiner neuen Diktion heißt es bei Heinz F. Schafroth:
„Die Strophen sind vielfach kunstvoll durch den Verzicht auf jedes Wort, das die Situation nicht wiedergibt sondern ausschmücken würde.“[3]
Eich selbst sagt 1965: „Jedes Gedicht ist zu lang.“[4]. Damit verdeutlicht er seine Ansicht, daß am Gedicht die Prinzipien des Auswählens, des Ausscheidens und der Reduktion angewandt werden müssen. Auch seine Ansicht, der Dichter müsse „alte“ Vokabeln gebrauchen ändert sich in der Nachkriegszeit und er beginnt, zeitbezogene Ausdrücke zu verwenden, was er in den 30er Jahren noch vehement abgelehnt hatte[5].
Eine erste Einschränkung der „Kahlschlag“- oder „Inventur“- Theorie liegt aber bereits darin, daß eine genaue Datierung vieler Texte aus Eichs erster Nachkriegsveröffentlichung nicht möglich ist. Einige Gedichte aus „Abgelegene Gehöfte“ (1948) sind mit Sicherheit vor dem Krieg entstanden.[6] Inhaltlich weicht Eich nach 1945 nicht von seiner Naturmystik ab, die schon seine frühen Werke geprägt hatte. Er knüpft damit eindeutig an romantisches Gedankengut an.[7] Das Mystische in seinen Texten bezieht sich auf ein „adamisches Urwort“, dessen Dechiffrierung im Sinne der Wahrheitsbeschreibung des Dichters Aufgabe ist.
Birner verweist darauf, daß ein Kahlschlag lediglich in den sogenannten „Camp-Gedichten“, die während des Kriegs oder in Gefangenschaft entstanden waren, nachzuweisen ist. Diese Phase war zur Zeit der eigentlichen „Stunde Null“ jedoch für ihn schon wieder vorbei.[8]
Auch formal blieb Günter Eich dem Vertrauten treu:
„...daß es nach dem Krieg leichter war, auf die vertrauten Formen und Themen zurückzugreifen, und daß einige Zeit vergehen mußte, bis wiederum mit der Sprache experimentiert werden konnte.“[9]
Obwohl Titel wie „Fabula Rasa“ oder „Inventur“ der Terminologie der Gruppe 47 zu entsprechen scheinen und auch inhaltliche Bezüge zu der „Kahlschlagliteratur“ gemacht werden können, ist Eichs Werk kein tatsächliches Paradebeispiel für den Versuch eines literarischen Neuanfangs. Das Wortspiel „Fabula Rasa“ im Gegensatz zu „Tabula Rasa“ ist ein erster Hinweis, daß er selbst die „Stunde Null“ als dem Reich der Fabel zugehörig aufgefaßt hat.
3. Ernst Jandl
Auch der österreichische Schriftsteller Ernst Jandl gehört zu denjenigen, die nicht in die Emigration flüchteten, was jedoch auf sein Lebensalter zurückzuführen ist: Jandl machte erst 1943 seinen Schulabschluß. Dies sollte ihm jedoch den Militärdienst nicht ersparen, wurde er doch direkt nach Beendigung seiner schulischen Laufbahn eingezogen und nach kurzer Zeit im Arbeitsdienst tatsächlich in den Kriegsdienst berufen. Trotz verzögerungstaktischer Bewerbungen zu verschiedenen Lehrgängen erhält Jandl im Juli 1944 den Marschbefehl an die Westfront. von wo er kurze Zeit später zu den amerikanischen Truppen überlaufen konnte. Auch er konnte somit wie Eich die militärischen Handlungen minimieren und macht trotzdem die Erfahrung des Lebens an der Front aus nächster Nähe.[10]
Schon während des Kriegs hatte Jandl begonnen, Gedichte zu schreiben und nach Kriegsende nahm er seine akademische Laufbahn wieder auf. 1956 erscheint seine erste Lyrikpublikation „Andere Augen“ die noch weitgehend traditionell aufzufassen ist. Erst 1966, mit dem Gedichtband „Laut und Luise“, begann Ernst Jandl sein typisches lyrisches Werk. Basierend auf einer neuen Literaturauffassung, die von der „Wiener Gruppe“ ausging, experimentiert der Autor mit der Sprache sowohl im akustischen (Laut- und Sprechgedicht, Onomatopoesie) als auch im visuellen Sinn (visuelle Poesie). Den Vertretern dieser Richtungen lag an der Dekomposition von Sprache und Aufbrechen herkömmlicher Bedeutungs- und Wahrnehmungsstrukturen. Dies war der radikalste Versuch, eine „neue“ Literatur zu schaffen, was den Autoren der Gruppe 47 in erster Linie in der Theorie gelungen war. Als Mitglied der „Wiener Gruppe“, einer Dichterformation, die sich dem literarischen Experiment widmete, verfaßte er in den folgenden Jahren Werke, die die Oberbegriffe Dekompositionsakt und antigrammatisches Schreiben passend beschreiben. Nicht die sprachlichen „Höhen“ sondern gerade ihre „Tiefen“ sollten dargestellt werden, was im Gedichtband „der gelbe hund“ (1980) einen weiteren Höhepunkt fand, indem der Autor Gedichte in der „Sprache der Kinder“ und in „Gastarbeiterdeutsch“ („es ist die sprache von leuten, die deutsch zu reden genötigt sind, ohne es je systematisch erlernt zu haben“[11] ).
Eine komplette Abkehr von allem Traditionellem hatte Jandl jedoch nicht im Sinn, vielmehr ging es ihm darum im Verhältnis zur Tradition etwas Innovatives zu erreichen. Er war der Ansicht, „Unbekanntes wird am deutlichsten, wenn es neben Bekanntes tritt“[12] In diesem Sinne verwendet Jandl herkömmliche Titel und Themen, um sie im eigenen Stil zu bearbeiten. So sind seine „calypso“-Verse („ich was not yet/ in brasilien/ nach brasilien/ wulld ich laik du go/...“) eine Anleihe an das Sehnsuchtslied des Zwitterwesens Mignon im „Wilhelm Meister“ und die Zeilen „waasd i red hoed so gean/ drum redia so füü/ skommt drauf aun, mid wem/ oowa woat, boid bini schdüü“ nehmen Goethes „Wanderers Nachtlied“ auf.[13] Auch das Wortspiel „philosophie – o so viel vieh“ könnte durch eine Stelle in Büchners Woyzeck inspiriert sein, an der auch das Morphem „vieh“ zu einem Wortspiel benutzt wird („Viehsionomik – viehdummes Individuum“[14] ),was jedoch spekulativ bleibt, zumal sich Ernst Jandl stets als Meister gerade solcher Art von Wortexperiment erwiesen hat.
Der Eindruck, die experimentelle Lyrik habe rundweg Neues geschaffen ist also durchaus richtig, aber der Gedanke der Eigenständigkeit muß verworfen werden. Eben das Herkömmliche ist es, was das Neue erst zur Geltung kommen läßt und dieser Umstand führte Jandl immer wieder dazu, Traditionelles aufzugreifen, freilich ohne es in irgendeiner Hinsicht zu kopieren oder sich ihm anzubiedern, sondern um gegenüber diesem Vorbild die eigene Dichtung als etwas „Anderes“ wirken zu lassen.
4. Eichs Gedicht „Latrine“
Günter Eichs Gedichtsammlung „Abgelegene Gehöfte“ (1948) beinhaltet das Kriegsgedicht „Latrine“, welches an Deutlichkeit in bezug auf Elendsschilderung schwer zu überbieten ist. Trotz Eichs Vorhaben, die Sprache weitestmöglich zu reduzieren, gelingt es ihm, einen ausführlichen und genauen Eindruck eines Schützengrabens im Zweiten Weltkrieg zu vermitteln.
4.1. „Latrine“ und die „Stunde Null“
Das Gedicht beschreibt einen Menschen, der sich in einem Graben befindet, in dem es nach „Kot“, „Urin“, „Blut“ und „Verwesung“ stinkt. Die Verbindung von „Graben“, „Blut“ und „Verwesung“ vor dem gegebenen zeitlichen Hintergrund legt den Schluß nahe, daß es sich um einen Schützengraben des Zweiten Weltkriegs handelt und der Mensch ein Soldat ist. Verstärkt wird diese Annahme dadurch, daß der Mensch im Graben seinen Blick auf das bewaldete Ufer richtet, was einem Spähen entsprechen könnte, um eine eventuelle Bedrohung frühzeitig zu erkennen. Währenddessen verrichtet der Soldat sein Geschäft („In den Schlamm der Verwesung/
klatscht der versteinte Kot.“) und in seinen Ohren „schallen/
Verse von Hölderlin“.
Formal betrachtet handelt es sich bei „Latrine“ um ein aus vier Strophen zu je vier Zeilen bestehendes Gedicht. Sogar ein Reimschema ist zu erkennen: in den ersten drei Strophen reimen sich jeweils die zweite und vierte Zeile, die vierte Strophe besteht aus einem kompletten Kreuzreim. Während dies auf bis zu den Weltkriegen typische abendländische Dichtung hinweist (etwa die romantische Volksliedstrophe), verhindert genauere Betrachtung die Annahme, Eich bediene sich dieser Elemente um sich tatsächlich an traditionelle Werke anzunähern. Der Titel „Latrine“ macht dies unmöglich. Noch deutlicher wird der Unterschied dadurch, daß sich in den ersten drei Strophen jeweils ein Reimelement ein Exkrement bezeichnet: zweimal handelt es sich um Urin, einmal um Kot. Bezeichnender Weise reimt sich Urin in der dritten Strophe auf Hölderlin, einen der berühmtesten deutschen Dichter, dazu noch Romantiker. Dies zerstreut letzte Bedenken, daß das Hölderlin-Zitat in der letzten Strophe eine genaue Adaption dessen Gedankenguts bedeuten könnte.
Überhaupt legt die Diktion des Gedichts eine völlige Abkehr vom Herkömmlichen nahe. Vokabeln wie „Verwesung“, „Kot“, „Urin“ und „stinkendem Graben“ gehörten vor den Weltkriegen nicht zum Wortschatz deutscher Dichter.
Die Annahme, Eich wolle so den kompletten Bruch mit der Tradition herbeiführen zielt jedoch ebenfalls daneben. Vom Gedanken der „Stunde Null“ oder des „Kahlschlags“ hatte sich Günter Eich ohnehin bald nach 1945 abgewandt(siehe auch 2.):
„Dieser Kahlschlag war aber, kaum hatte man recht davon zu reden begonnen, für Eich bereits wieder vorbei. In den ersten Jahren nach dem Krieg griff er sofort wieder auf sein Werk der dreißiger Jahre zurück.“[15]
Er kehrte also nach dem Krieg zu einem Werk zurück, daß er als nach eigenen Worten „verspäteter Expressionist und Naturlyriker“[16] verfaßt hatte. Ein Indiz dafür, daß schon in „Abgelegene Gehöfte“, dessen Gedichte zum Teil schon während des Krieges entstanden waren, eine Verknüpfung mit der Vorkriegslyrik beabsichtigt war, eben aber nicht im Sinne einer schwärmerischen Rückbesinnung auf eine imaginäre „gute, alte Zeit“, sondern vielmehr als ein krasses „in Kontrast setzen“ zum Greuel des Kriegs.
Wenn überhaupt von einer „Stunde Null“ bei Eich gesprochen werden kann, so hat sie sich in den Kriegsgedichten (Birner spricht von „Camp-Gedichten“) in „Abgelegene Gehöfte“ vollzogen.
„Die ‚Camp-Gedichte‘ sind tatsächlich so etwas wie ein Kahlschlag, was sich ohne Zweifel in der entmystifizierten Wertung der Natur zeigt.“[17]
Von Naturmystik nimmt Eich zwar zunächst Abstand, aber der Hölderlin-Kontext und die Volksliedähnliche Form zeigen, daß er nach einem Weg sucht, lyrisch tätig sein zu können ohne den „Kahlschlag“ zum übermächtigen Inhalt seines Werks zu machen. Während die meisten „Gruppe 47“-Lyriker hauptsächlich politische Lyrik verfaßten, grenzte Eich sich davon weitgehend ab. Seine „Stunde Null“ war eine „Inventur“ (Titel eines Gedichts in „Abgelegene Gehöfte“), in der aber „die Bleistiftmine“ erfaßt wird. Der Hinweis „Tags schreibt sie mir Verse“ deutet daraufhin, daß der Dichter bereits während der „Inventur“ sicher ist, auch weiter als solcher arbeiten zu können.
Der „Vorwurf des Ausweichens in die Innerlichkeit“[18], der angesichts der Rückbesinnung und der politischen Enthaltung auf den Plan gerufen wird, kann so nach Schafroth so erklärt werden, „daß es unmittelbar nach dem Krieg leichter war, auf die vertrauten Formen und Themen zurückzugreifen, und daß einige Zeit vergehen mußte, bis wiederum mit der Sprache experimentiert werden konnte.“[19] Dies bedeutet also kein Ausweichen oder Zurückweichen von einer Problemstellung, sondern quasi einen taktischen Rückzug auf sicheren, vertrauten Grund, um das Geschehene verarbeiten zu können. Die Sprache, bevor mit ihr experimentiert werden kann, muß als etwas Vertrautes dienen, als Werkzeug, um begreiflich zu machen, was zunächst noch unbegreiflich erschien, denn die Situation nach der Entmachtung des Naziregimes war völlig einzigartig. Man konnte thematisch auf nichts Vertrautes zurückgreifen, also mußte wenigstens formal ein fester Boden geschaffen werden auf dem sich ein Schriftsteller bewegen konnte.
Mittels des also traditionell begriffenen Werkzeugs „Sprache“ gelang es Günter Eich in „Latrine“ zumindest den Eindruck eines Schützengrabens zu vermitteln. Ohne radikale formale Neuheiten zu präsentieren erfaßt er ein neuartiges Thema gerade dadurch, daß er eine traditionelle Form gebraucht: was aussieht wie ein romantisches Volkslied beschreibt Ekel und Greuel. Die Annäherung an das „Alte“ schafft eine umso krassere, brutalere Verdeutlichung dessen, was der Dichter im Krieg erlebt hatte. Die Nähe zu Hölderlin schafft so gleichzeitig Abstand zu der Zeit vor den Weltkriegen. Aber, ähnlich wie in „Wiepersdorf, die Arnimschen Gräber“ (Abgelegene Gehöfte, 1948), ist das Gedankengut der Zeit nicht vergraben oder vergessen.[20]
Die Thematik der Reime fügt sich ebenfalls in dieses Schema. Reime symbolisieren normalerweise die Vollkommenheit der Dichtung. In „Latrine“ werden sie mit Worten wie „Kot“ und „Urin“ gebildet wodurch ebenfalls ein starker Kontrast gebildet wird. Dies offenbart allerdings noch ein anderes Konzept, nämlich das der „Ungereimtheit“.
„In beiden Fällen ist mittels der Zitate die Absurdität, mittels der Reime die fürchterliche ‚Ungereimtheit‘ der Situation gestaltet.“[21]
Das Traditionelle dient also auch in diesem Kontext dazu, einen besonders widerlichen Umstand zu beschreiben. Während ein Reim eigentlich Harmonie darstellen soll führt er sich hier selbst ad absurdum und ist bei genauerem Betrachten ungereimt. Das herkömmliche Stilmittel ist also nur noch streng formal präsent und im Prinzip handelt es sich um ein „neues“ Stilmittel: einen „ungereimten Reim“.
4.2. Die Bedeutung des Hölderlin-Zitats
Die Nennung Hölderlins als solche verwundert bei Günter Eich nicht, da er sich stets als von den Romantikern beeinflußt sah. Der Kontext in dem er genannt und zitiert wird ist allerdings irritierend. Man könnte vermuten, daß auf das Unzeitgemäße der Beschäftigung mit seinem Werk hingewiesen wird, wenn sein Name sich auf Urin reimt. Dies erscheint um so naheliegender, wenn man bedenkt, daß für Hölderlin die für ihn typische Hellenisch-Christliche Götterwelt trostspendend und ermutigend gewesen ist („Die Welt des Freundlichen, Tröstenden und Versöhnenden wird immer wieder mit Hölderlins Göttergedanken verbunden.“[22] ), ein Gedanke, der mit Günter Eich in der unmittelbaren Nachkriegszeit kaum zu vereinbaren gewesen sein dürfte.
Wie aber schon beschrieben war es nicht Eichs Anliegen, sich von allem, was vor den Weltkriegen gewesen war, loszusagen. Auch der Schluß, der Effekt der Hölderlin-Anspielung soll das Ekelhafte in „Latrine“ lediglich in einen besonders deutlichen Kontrast setzen greift zu kurz.
Der Gedanke an Friedrich Hölderlin ist in mehreren Gedichten aus „Abgelegene Gehöfte“ vorhanden. In „Truppenübungsplatz“ etwa spielt „Wacholderharz“ auf den Dichter an und auch der Titel „Puy de Dôme“ weist auf den Zusammenhang zwischen Hölderlins Bordeauxreise und Eichs Stationierung in derselben Gegend hin.[23]
Das Zitieren des Romantikers im direkten Umfeld von Verwesung und Exkrementen erscheint auch nicht als völliger Widerspruch, da das Zitat im Original in einem ähnlichen Kontext steht. In „Andenken“ spricht Hölderlin von „Grabsteinen“, „Moore“, „Torf“ und „Schwarzen Staub“. Inhaltlich handelt es von der Vergänglichkeit des Lebens.[24]
Es ist anzunehmen, daß sich in den letzten beiden Strophen ein wichtiger Teil Eichscher Poetik manifestiert. Für sich genommen ist „Latrine“ zunächst der Versuch Empfindung in Sprache zu fassen und unter Umständen weiterzuvermitteln. Bei Sigurd Martin heißt es:
„Für Eich erlangen die Dinge erst durch das Schreiben Wirklichkeit, nicht allerdings durch beliebiges Schreiben, sondern durch das Schreiben von Gedichten“[25]
Eich selbst bezeichnet seine Gedichte als Orientierungspunkte oder „trigonometrische Punkte“[26], die die Wirklichkeit erfaßbar machen sollen:
„Eichs Gedichte sind Chiffren der Wirklichkeit, die den geistigen Gehalt der Dinge offenbaren (...) Im Gedicht versucht Eich aus jener Sprache zu übersetzen, ‚in der das Wort und das Ding zusammenfallen’. Die Übersetzung nähert die Sprache dem Urtext an“[27]
Der Urtext stellt in diesem Fall die tatsächliche Situation im Schützengraben dar, die Sprache, ‚in der das Wort und das Ding zusammenfallen‘ bezeichnet die Empfindung, die der Dichter von dieser Situation zurückbehalten hat und das Gedicht „Latrine“ steht schließlich für den Übersetzungsversuch aus dieser Sprache. Diese Sichtweise eigener Dichtertätigkeit ist der Hölderlins ähnlich:
„Der Dichter (ahndet), auf jener Stufe, wo er auch aus einer ursprünglichen Empfindung, durch entgegengesetzte Versuche, sich zum Ton, zur höchsten reinen Form derselben Empfindung emporgerungen hat und ganz in seinem ganzen inneren und äußeren Leben mit jenem Tone sich begriffen sieht, auf dieser Stufe ahndet er seine Sprache, und mit ihr die eigentliche Vollendung für die jetzige und zugleich für alle Poesie.“[28]
Zwar spricht Eich nicht von einer höchsten Form einer Empfindung, eine solche Darstellung klänge jedoch auch wie Hohn angesichts der zeitlichen Umstände. Gleich Hölderlin ist er sich aber bewußt, daß es der dichterischen Übersetzung der Empfindung, die sich in der ursprünglichen, „adamischen“ Sprache gestaltet, bedarf, um sie in eine Sprache zu fassen, die der ursprünglichen Empfindung möglichst nahe ist. Diese stellt schließlich das Gedicht dar.
Der Hölderlin-Bezug hat somit eine dreistufige Bedeutung für „Latrine“: Als erstes ist der Gedanke an den Dichter unstreitbar Teil der ursprünglichen Empfindung, denn es heißt ja: „Irr mir im Ohre schallen/
Verse von Hölderlin“(dies ist nicht Teil der Situation als solcher, da für ein anderes Individuum die Situation nicht unbedingt Verse von Hölderlin hervorrufen würde). Auf zweiter Ebene dient Hölderlin als Stilmittel, um die „furchtbare Ungereimtheit der Situation“ (siehe 4.1.) zu beschreiben durch starkes Kontrastieren mit dem Elend. (Dies wird überdeutlich, wenn direkt im Anschluß an die dritte Strophe folgt: „In schneeiger Reinheit spiegeln/
Wolken sich im Urin.“ Über den Reim hinaus ist ein weiterer Gegensatz erkennbar: weiße Wolken, dazu noch schneeig-reine spiegeln sich im Urin, einem Exkrement. Die Symbolik weißer Wolken und „schneeiger Reinheit“ steht der Symbolik von Exkrementen gegenüber.) Die dritte Stufe der Bedeutung des Hölderlin-Kontexts ist die Beziehung von dessen poetologischen Gedanken zu Eichs eigener Poetik. Das Gedicht ist demnach Ergebnis einer dichterischen Übersetzung einer Empfindung aus der Sprache, „in der das Wort und das Ding zusammenfallen“. Um diesen Gedanken zu verdeutlichen erschien es Eich wahrscheinlich angemessen, diesen für ihn so wichtigen Dichter namentlich in sein Werk zu übernehmen. Andererseits kann man auch den Rückschluß zur ersten Bedeutungsstufe machen: Wenn Hölderlins Verse in seinen Ohren schallten, waren sie Teil seiner Empfindung und müssen schlußendlich seiner Poetik zufolge auch im Gedicht stehen, um der ursprünglichen Empfindung so nah wie möglich zu sein.
5. Ernst Jandls „schtzngrmm“
Folgt man Ernst Jandls Aufteilung von Gedichten in vier Typen, nämlich Gedichte in Normalsprache, Lautgedichte, visuelle Gedichte und Sprechgedichte, gehört „schtzngrmm“ zu der Gruppe der Sprechgedichte. Erst durch den Sprechakt beim Vorlesen/-tragen wird aus der Reihe von Konsonanten das Wort „Schützengraben“ hörbar. Dies erfolgt gerade aus der namengebenden Eigenschaft der Konsonanten (ein Konsonant ist demnach ein Buchstabe, der mit etwas zusammen klingt, der nicht allein klingt): spricht man die Buchstabenreihe konsekutiv und in normaler Geschwindigkeit, so klingen andeutungsweise auch die dem Wort „Schützengraben“ zugehörigen Vokale mit.
5.1. „schtzngrmm“ vor dem Hintergrund Jandlscher Poetik
Die Interpretation Jandlscher Gedichte sieht sich elementaren Problemen gegenüber. Zum einen lehnte der Autor es stets ab gebrauchsfreundliche Interpretationen zu seinen Gedichten abzuliefern, zum anderen verstand er sich auch nicht in einer exponierten Autor-Position, von der aus er der Leserschaft mittels eines definierten Konzeptes seine eigene Welterfahrung nahebringen wollte[29]. Diese Sichtweise war selbst unter anderen „konkreten Poeten“ nicht selbstverständlich:
„Gomringers Essay über ‚konkrete dichtung‘ weist dem konkreten Dichter, dem heimlichen Erben der Frühromantik, seinen Platz an der vordersten Stelle einer ‚entwicklungstendenz unserer gesellschaft, ihres denkens und tuns‘ zu, ‚die in ihrem kern eine neue ganzheitsauffassung enthält‘. Chris Bezzels ‚2tes Manifest für eine akustische Poesie‘ endet mit der glänzenden Aussicht aus eine exponierte Künstlerpersönlichkeit, die sich ‚identisch weiß mit einem Universum, in dem alle Möglichkeiten offen und alle Gewißheiten augenblickshaft‘ seien. Als ein ‚zu immer radikalerer Widersprüchlichkeit verpflichteter Beitrag zur gegenwärtigen Kultur‘ versteht Jochen Gertz die visuelle Poesie.“[30]
Die „Augenblickhaftigkeit“ hätte sicher auch Ernst Jandl gesehen, ansonsten läßt er den Leser aber weitgehend allein was das Interpretieren seiner Dichtung angeht. Dies verwundert um so mehr, da er durchaus poetologische Texte („Die schöne Kunst des Schreibens“) verfaßt und Vorträge („Das Röcheln der Mona Lisa“) gehalten hat. In ihnen verzichtete er jedoch auf das Vermitteln eines tieferen Sinns seiner Werke. Vielmehr war er gerade darauf bedacht, den Arbeitsbereich des Schreibens gegen jeden übergeordneten Sinn abzugrenzen und sich gezielt darauf wie auch auf den Sprechakt (wie der band „Das Öffnen und Schließen des Mundes“ zeigt) zu konzentrieren.[31] Auch in dieser Hinsicht kann man sagen, das seine Poesie durchaus augenblickhaft ist, besonders im Falle der Sprech-und Lautgedichte.
Versucht man also das Sprechgedicht „schtzngrmm“ im herkömmlichen Stil zu interpretieren, also nach einem tieferen Sinn zu suchen, wird man zu den Schluß kommen, das es sich nicht interpretieren läßt. Auch eine Autor-Werk Beziehung (etwa eine autobiographische) ist problematisch. Sicher kann man nicht von der Hand weisen , daß es sich bei allen unter der Kapitelüberschrift „Krieg und so“ (im Gedichtband „Laut und Luise“) zusammengefaßten Texte um aus Jandls persönlichen Kriegserinnerungen entstandene Gedichte handelt. Man muß genauso annehmen, daß er den Krieg verabscheut, denn das wird in seiner Biographie mehr als deutlich. Wäre es also sein Ziel gewesen, seine persönliche Abscheu gegenüber dem Krieg dem Leser zu vermitteln, hätte er mit den Zeilen „schtzngrmm/ schtzngrmm/ t-t-t-t/ t-t-t-t/grrrmmmmm/...“ sicherlich wenig Erfolg gehabt. Ein abschreckendes, desillusionierendes Werk (wie Eichs „Latrine“) hätte so ausgesehen wie sein Versuch aus dem Februar 1944 (ohne Titel):
„Kotverkrustet, ausgemergelt,
wankt in wundenmüdem Tritt
graues Heer durch graue Straßen
und ich wanke mit..
Lippen, schmerzensmüd zerbissen,
Haar zerrauft und stur der Blick,
lumpeneingehüllt, zerrissen –
stumm wanke ich mit..
Weiter geht es. Endlos, ewig
pulst der gleiche dumpfe Schritt
durch die Menschen aller Zeiten.
Doch ich – geh nicht ewig mit.“[32]
Hier gibt sich der junge Jandl noch wortreich und ausführlich beschreibend. Anders als in Eichs „Latrine“ wirken allerdings die Adjektive (ausgemergelt, wundenmüde, lumpeneingehüllt usw.) trotz ihrer durchweg negativen Konnotationen fast ein wenig ausschmückend Besonders augenscheinlich wird dies an dem Adverb „schmerzensmüd“ in Zeile 5. Ob die Lippen schmerzensmüd zerbissen wurden oder aus einfacher Wut oder Trauer ist für den eigentlichen Zustand nicht wichtig. Hier zeigt sich der Einfluß von August Stramm, den der junge Jandl verehrte. Stramm, seinerseits durchaus fortschrittlich, verfaßte nach dem Ersten Weltkrieg Gedichte, in denen er auf eindringliche und wortreiche Weise seine Kriegserfahrungen verarbeitete. Bei ihm heißt es „glutverbißnen Lippen“ („Untreu“), „Klebrige, zitternde Glieder, verfallene Gesichter“ („Lazarett“) oder „wie Puppen liegen die Toten zwischen den Fronten“ („An der Front“)[33]. Eine solch adjektivreiche und metaphorische Sprache war dem älteren Jandl fremd und entsprach auch nicht mehr seinem dichterischen Standpunkt.
Da es Ernst Jandl also kaum darum gegangen sein wird, das Elend des Kriegs zu beschreiben, aber trotzdem der Einfluß desselben durchaus vorhanden gewesen ist, kann man eine humoristische Herangehensweise ebenfalls ausschließen. Ähnlich wie in „falamaleikum“ (Laut und Luise, 1966), das sich zu „fallnamalsooovielleutum“ steigert und schließlich die Frage aufwirft, ob nach dem Krieg nicht alle wieder da wären („oderfehlteiner?“), scheint es so, als nähme Jandl den Krieg nicht sonderlich ernst und ihm sei seine eigene Erfahrung nicht nahe gegangen. Doch man muß seine Haltung, daß für ihn der Schreib-und Sprechvorgang im Vordergrund steht im Auge behalten. Es geht hier nicht darum, individuelle Biographie in Kunstformen umzusetzen. Den Krieg als Antrieb dieser Gedichte zu vermuten mag nicht falsch sein, Jandl selbst sagt jedoch:
„Ich schreibe, weil ich schreibe und wenn mir das genügt, als Motiv, muß es allen genügen; niemand muß, was ich schreibe, genügen, aber allen muß genügen, was ich davon sage, warum. Warum jemand liest was ich schreibe, falls jemand es tut, ist seine Sache; warum ich schreibe, was ich schreibe, meine“[34]
Wenn dies auch recht zugespitzt und provokativ klingt muß man es trotzdem ernst nehmen. Daraus folgt nämlich, daß es bei Jandlschen Gedichten nicht um das „warum“ und „wozu“ geht sondern in erster Linie um das „wie“ und „mit welchen Mitteln“.
5.2. Interpretationsversuch
In Anbetracht der oben genannten Einschränkungen sind einige textimmanente Botschaften doch vorhanden, denn, auch wenn ein „tieferer“ Sinn abgelehnt wird, ein Sinn-loses Gedicht ist „schtzngrmm“ auch wieder nicht.
Bei der formalen Analyse wird deutlich, daß neben des durchklingenden „Schützengrabens“ noch andere Elemente des Kriegs dargestellt werden. Das Motiv „t-t-t-t“, daß in Zeile 3 zuerst auftritt und mehrere Male (zweimal in der Variation „t-t-t-t-t-t-t-t-t-t“ und einmal als „t-tt“) wiederholt wird könnte für das stakkatoartige Maschinengewehrfeuer stehen.
In Zeile 5 wird mit „grrrmmmmm“ ein weiteres Frontgeräusch eingeführt, das wohl schwereren Geschützen entspricht, wie etwa einer Panzerkanone. Auch hier findet man verschiedene Abwandlungen: „grrt“ (auch „grrrrrt“ und „grrrrrrrrrt“), „tzngrmm“ und „grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr“. Alle Geräusche kann man als „rollende“ oder „grummelnde“ Klänge beschreiben.
Außerdem wird in Zeile 7 eine weitere Art Geräusch vorgestellt die als „zischend“ beschrieben werden kann: „s c h“ steht wohl für ein Fluggeräusch, genau wie die Variationen „tssssssssssssssssssss“, „scht“ und „schtzn“. Ein langer Bindestrich erzeugt also eine längere Dauer des Geräusches, kurze Bindestriche erzeugen einen Stakkato-Charakter.
Alle diese Morpheme werden ausschließlich aus den Konsonanten gebildet, die in „schtzngrmm“ vorhanden sind, durch beliebige Kombination und Anzahl (es handelt sich um die fünf Alveolar-Phoneme t, s, z, n, r, um das Bilabial-Phonem m, das Palatal-Phonem sch und das Velar-Phonem g). Die so gebildeten Morpheme können also in 3 Gruppen eingeteilt werden, wie in der folgenden Tabelle:
| Klangtyp | Beispiele | Beschreibung |
|---|---|---|
| Stakkato-Geräusche | t-t-t-t, t-t-t-t-t-t-t-t-t-t, t-tt | Kurze, repetitive Laute (z.B. Maschinengewehr) |
| Rollende/Grummelnde Geräusche | grrrmmmmm, grrt, grrrrrt, grrrrrrrrrt, tzngrmm, grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr | Längere, tiefere Laute (z.B. schwere Geschütze, Panzer) |
| Zischende/Fluggeräusche | s c h, tssssssssssssssssssss, scht, schtzn | Luftbewegungsgeräusche (z.B. Flugobjekte, Geschosse) |
Die unterschiedlichen Variationen lassen jeweils andere Assoziationen zu. Das langgezogene
„s c h“ stellt ein anderes Fluggeräusch dar als „tssssssssssssssssssss“: das Erste könnte ein großes Flugobjekt darstellen, das über den Wahrnehmenden hinwegfliegt, das Zweite müßte dementsprechend ein kleineres Flugobjekt beschreiben (das scharfe „s“ ist vom Klang her heller als ein „sch“ und suggeriert daher das Fluggeräusch eines kleinere Körpers), das aber auch über den Wahrnehmenden hinausfliegt. Die Variante „scht“ legt nahe, das ein großer Flugkörper mit schnellerer Geschwindigkeit fliegt, während „schtzn“ zusätzlich einen Einschlag in einiger Entfernung des Wahrnehmenden beschreiben könnte, das “zn“ entspräche dem Geräusch, das das Ende der Flugbewegung anzeigt.
In der Gruppe der „rollenden Geräusche“ entscheidet nicht ein langer Bindestrich über die Länge eines Klangs sondern sie Anzahl der Konsonanten (der „r“) wie auch beim „tssssssssssssssssssss“. Die Helligkeit eines Geräusches wird durch einen zusätzlichen Konsonanten am Ende bestimmt: das „t“ in „grrt“ macht es heller, das „m“ in „grrrmmmmm“ macht es dunkler. Der Auftakt „tzn“ bei „tzngrmm“ könnte einem Abschuß in der Nähe des Wahrnehmenden oder einem Vorüberfliegen am Wahrnehmenden entsprechen. Außerdem schwingt in „grmm“ auch das Wort „Grimm“ mit, was sogar bedeuten könnte, daß hier eine menschliche Empfindung beschrieben wird.
Die „stakkatoartigen Geräusche“ bestehen nur aus mehreren „t“ und dazwischenliegenden kurzen Bindestrichen. Der Eindruck wird erweckt, das hier der Klang der Waffe des Wahrnehmenden erklingt, da die Helligkeit des Tons auf größtmögliche Nähe hinweist, Ein weiter entferntes Schnellfeuergewehr entspräche so den unterschiedlichen „grrt“-Klängen.
Abgesehen von der variierenden Länge, angezeigt durch unterschiedliche Anzahl der „t“, fällt auf, daß am in der letzten Zeile ein Doppel-t ohne Bindestrich das Gedicht beendet. Einerseits könnte hier die Lautstärke des letzten Klangs erhöht worden sein, andererseits könnte jedoch auch anhand der Kürze der Buchstabenreihe (es handelt sich um die kürzeste Zeile des Textes) das Verstummen des Maschinengewehrs dargestellt sein. Angenommen, es handelt sich tatsächlich um die Waffe des Wahrnehmenden, liegt nahe, daß dieser ums Leben gekommen ist. Diese Annahme wird unterstützt durch den visuellen Eindruck, den die übrigen „t-t-t-t“-Reihen vermitteln: sie wirken wie Gräberreihen eines Soldatenfriedhofs, auf dem jedem Toten in jeweils gleichem Abstand ein Holzkreuz (im Gedicht ein „t“) gewidmet ist. Dies hieße zwar, das Jandl die Regeln des Sprechgedichts mit denen des visuellen Gedichts vermischt hätte, da er jedoch generell jegliche formale Regel ablehnte, erscheint das nicht unbedingt als Widerspruch.
Der anzunehmende Tod des Wahrnehmenden in „schtzngrmm“ bedeutet eine weitere Entfernung von der Vorstellung, es handele sich um autobiographische Kriegserinnerungen. Überhaupt gibt es bei Ernst Jandl kein lyrisches Ich. Dieses Charakteristikum experimenteller oder konkreter Poesie entwickelte sich bei Jandl schon während seines ersten Gedichtbands „Andere Augen“. Im Gedicht „November“ heißt es:
„Ich, der Kasten.
Ich, der Schreibtisch.
Ich, das Sofa.
Ich, das Bett.
Das ist meine Gegenwart.
Das sind meine Erinnerungen.“[35]
Das lyrische Ich tritt hier in direkte Verbindung mit seiner Umwelt/ Umgebung und gibt seine Individualität auf, was zu dem Eindruck führt, das alles Erlebte nicht subjektiv sondern objektiv wahrgenommen wurde. Die Gedichte sollen also größtmögliche Objektivität wiedergeben und nicht die individuell-subjektiven Erfahrungen eines Einzelnen beschreiben. Die Abkehr vom lyrischen Ich ist der Einstieg zu diesem Experiment. In „schtzngrmm“ soll Objektivität noch dadurch verstärkt entstehen, das selbst die Elemente der Sprache auf einen „kleinsten gemeinsamen Nenner“ gebracht werden: Jandl verwendet nicht ganze Sätze, er verwendet nicht Ganze Worte, er verwendet nicht einmal Vokale, einzig die Gruppe der Konsonanten ist vorhanden und hier auch nur die, die in „Schützengraben“ vorkommen (auch aus dieser Gruppe streicht er noch das „b“).
Das Leid des Krieges wird so zwar nicht besonders explizit dargestellt, doch das nüchterne Ende, das den Tod bedeutet, weist darauf hin, das dem Autor auch dies am Herzen lag. Er beschränkt sich auf eine karge Zustandsbeschreibung anstatt auf wortreiches Lamentieren. Der Schluß erinnert an das süffisante „oderfehlteiner?“ in „falamaleikum“. Daß dies jedoch keineswegs eine Verharmlosung oder Belustigung darstellt wird an der Kargheit deutlich. Man ist geneigt zu sagen, dem Dichter fehlen die Worte, deshalb gebraucht er abstrakte Buchstabenreihen. Den persiflierenden Ton Ernst Jandls kann man beispielsweise in „wien : heldenplatz“ (Laut und Luise, 1966) lesen: „der glanze heldenplatz zirka/ versaggerte in maschenhaftem männchenmeere/“. Hier wird auf die blumenreiche, glorifizierende Sprache beispielsweise der Massenmedien oder auch der Propagandisten angespielt. Obwohl sie wortreich und hochtrabend beschreiben, bleibt ihre Sprache doch ungenau und unverbindlich.
„schtzngrmm“ ist nicht nur „nicht wortreich“ sondern geradezu „wortlos“. Hier wird nicht persifliert sondern ein Zustand dargestellt, der für viele der damaligen Zeit einmal Realität gewesen ist. Dieser Realität versucht der Dichter mit Hilfe der ausgewählten Stilmittel gerecht zu werden.
6. „Latrine“ und „schtzngrmm“ im Vergleich
So unterschiedlich beide Texte auf den ersten Blick auch sein mögen, sie haben inhaltlich eine essentielle Gemeinsamkeit: den Schützengraben. Noch dazu stammen die zugrundeliegenden Erinnerungen aus derselben Zeit. Darum ist ein Vergleich der beiden Gedichte durchaus sinnvoll.
Der vielleicht wichtigste Unterschied zwischen „Latrine“ und „schtzngrmm“ liegt in der Rolle des lyrischen Ichs. Jandl verzichtet darauf ganz, während es bei Eich von zentraler Wichtigkeit ist. Für Günter Eich ist „Latrine“ die dichterische Manifestation seiner Empfindung der Situation im Schützengraben. In ihr kann das lyrische Ich nicht fehlen, wenn eine Poetik wie die Eichsche zugrunde liegt (Eich: „Die Wandlungen des Ichs sind das Problem des Lyrikers“[36] ). Zwar gibt auch Jandl seine Empfindungen wieder, aber er sieht seine Dichtung nicht auf die gleiche Weise:
„Freilich ist fast jedes Gedicht, für seinen verfasser, noch von bestimmten Erinnerungen umlagert, und von diesen kann er etwas sagen, was kaum ein anderer sonst sagen kann; fraglich ist, ob er damit etwas sagen kann, was zu dem Gedicht gehört, denn alles, was zu dem Gedicht gehört müßte das Gedicht selbst enthalten.“[37]
Wie schon der zeitliche Abstand des Gedichts zu seinem Inhalt zeigt, kann es dem Dichter nicht um emotionale Verarbeitung des Erfahrenen gehen, was bei Eich sicherlich der Fall war. Der Verzicht auf eine „exponierte Autor-Position“ (siehe 5.1.) legt auch nahe, daß es nicht Ernst Jandls Ziel war, einen lehrreichen, aufklärenden Beitrag zum Thema Krieg zu leisten. Er stellt die Dinge dar, wie sie sind und zwar möglichst originalgetreu in Sprache übersetzt. Dies scheint der Eichschen Poetik zwar sehr ähnlich, allerdings handelt es sich nicht um eine Innensicht wie in „Latrine“ (die Hölderlinverse im Kopf können nur eine Innensicht bedeuten), sondern um eine Außensicht: es wird beschrieben, was um den Wahrnehmenden herum passiert, nicht aber, was für Emotionen er dabei hat (einzige Ausnahme könnte der Anklang an „Grimm“ sein).
Die unterschiedliche Sichtweise der Rolle des Dichters scheint also für die extreme Unterschiedlichkeit der Beschreibung an sich sehr ähnlicher Situationen verantwortlich zu sein. Eich sieht die Innerlichkeit, die subjektive Empfindung für zentral. Ernst Jandl beschränkt sich hingegen auf eine Äußerlichkeit und schließt subjektive Empfindungen weitgehend aus.
Der Gegensatz beider Werke könnte also als das Verhältnis von Subjektivität zu Objektivität bezeichnet werden. Jandl schildert Krieg, wie er objektiv für jeden erfahrbar ist. Die Konsonantengebilde, aus denen „schtzngrmm“ besteht, sind ein stark reduziertes Konzept und eben durch diese Reduktion kann es als „kleinster gemeinsamer Nenner“ der unterschiedlichen Kriegswahrnehmungen bezeichnet werden: jedes Individuum nimmt den Krieg auf Lautbasis so wahr, wie Jandls Gedicht es wiedergibt (Der Anklang an „Grimm“ wäre mit diesem Gedanken durchaus vereinbar). Eich hingegen beschreibt subjektiv Erfahrbares. Der Gedanke an Hölderlin wäre einem beliebigen anderen Individuum wohl eher fremd, statt dessen wären in ihm vielleicht Gedanken an Familie und Heimat präsent (wie in Remarques „Im Westen nichts Neues“ dargestellt). Ihm ist damit das lyrische Ich unentbehrlich. Nicht, daß der Hauptaspekt seines Gedichts die eigene Person ist, deren Kriegserlebnisse eine Sonderstellung einnehmen, aber sein Schreibmotiv ist nun mal die Übersetzung der eigenen ursprünglichen Empfindung in Dichtersprache. Jandl ist dieser Aspekt des „Eigenen“ nicht so wichtig. Er stellt eine allgemeinere Sichtweise in den Vordergrund.
Ernst Jandl beschränkt sich (vom „Grimm“ und dem visuellen Effekt der „t-t-t-t“-Reihen einmal abgesehen) auf die Wiedergabe akustischer Eindrücke. Dies verträgt sich besonders gut mit der Konzeption von Laut-und Sprechgedichten, bei denen der Vortrag ja von ähnlicher Bedeutung ist wie der Schreibprozess. Überhaupt stehen diese beiden Bereiche, im handwerklichen Sinn begriffen, im Zentrum seiner Poetik(siehe 5.1.). Hier liegt ein weiterer grundlegender Unterschied beider Ansätze, Gedichte zu verfassen. Günter Eich sah seine Tätigkeit nicht (oder nur am Rande) als einen handwerklichen Prozeß. Das fixieren „trigonometrischer Punkte“ zur „Orientierung in der Wirklichkeit“, die eine „unbekannte Fläche“ ist( siehe 4.2.), beschreibt ein metaphysisches Vorgehen, bei dem naturgemäß das Handwerk eher Nebensächlich ist. Um sich so in der Wirklichkeit orientieren zu können, spielt dann auch eine breitere Palette von Sinneswahrnehmungen eine Rolle: der Geruchssinn („Über stinkendem Graben“), der Sehsinn („den Blick auf bewaldete Ufer“), der Gleichgewichtssinn („Unter schwankenden Füßen“) und der Hörsinn („irr mir im Ohre schallen“) werden explizit in „Latrine“ genannt, wenn auch der Hörsinn hier „innerlich“ wahrnimmt, was wohl in der Vergangenheit präsent ist (nämlich die Hölderlinverse).
7. Schluß
Die jeweilige dichterische Verortung beider Künstler ist ebenso schwierig wie überflüssig. Ein Dichter wie Jandl entzieht sich jeder Epochenzugehörigkeit und auch Eich spielt eine Sonderrolle in der deutschen Literatur, da er zwar zur Gruppe 47 gehörte, aber trotzdem zuvor im Dritten Reich schriftstellerisch aktiv gewesen ist (und nicht offenkundig widerständlerisch) und sich im Anschluß an diese Zeit nicht literarisch-politisch engagierte. Hier haben beide Schriftsteller einen interessanten Berührungspunkt. Ernst Jandls Werk läßt sich ebenfalls kaum politisch auslegen.
So verschieden die beiden poetischen Ansätze sind, so verschieden sind die Resultate. Es ist hier sehr offensichtlich nachzuvollziehen, wie sich die Poetik beider Dichter im Werk manifestiert. Jandl setzt in „schtzngrmm“ größtmögliche Objektivität der Erfahrung um. In „Latrine“ verwirklicht Eich die Übersetzung seiner subjektiven Erinnerung, die in einer ursprünglichen Sprache nur ihm zugänglich ist, durch die Übersetzungstätigkeit des Dichters aber einen Punkt zur Orientierung in der Wirklichkeit darstellt.
Ob Eichs Einwand, daß „jedes Gedicht eigentlich zu lang“ sei[38], auch vor Ernst Jandls Werken, die ja teilweise nur aus einer Zeile bestanden, Gültigkeit hätte, bleibt ungeklärt. Zwar bemühte sich auch Eich um eine weitgehende Reduktion von Sprache auf das absolut Notwendige und einen Verzicht auf alles Verzierende (siehe auch 2.):
„Die Strophen sind vielfach kunstvoll durch den Verzicht auf jedes Wort, das die Situation nicht wiedergibt, sondern ausschmücken würde.“[39]
In Verbindung mit der Fokussierung des Ichs kann er allerdings nicht so weit reduzieren, wie Ernst Jandl es getan hat. Es ist überhaupt die Errungenschaft der literarischen Bewegung der Experimentellen Literatur (sei es nun konkrete Poesie, visuelle Poesie, Onomatopoesie, Lautgedicht, Sprechgedicht, oder Mundartliches), ein Werk bis auf eine einzige sinnliche Ebene zu reduzieren. Das Gesprochene oder das Geschriebene kann unabhängig von anderen Faktoren ein literarisches Werk ausmachen. Ob nun beim Lesen, Sehen oder Hören solcher Werke nicht doch auch das Subjektive, der Erfahrungshorizont oder das Individuelle des jeweiligen Konsumenten eine objektiv für jeden gleiche Erfahrbarkeit unmöglich macht ist dabei uninteressant. Fest steht, daß jeder Konsument zunächst vom gleichen Standpunkt ausgeht ohne schon im Gedicht durch Subjektivitäten beeinflußt zu werden. Wenn dann jeder auch die gleichen Impressionen hätte, stellte sich die Frage, warum es dann überhaupt verschiedenartige Dichtungsarten gibt. Natürlich macht die eigene Subjektivität auch ein Gedicht wie „schtzngrmm“ für jeden Leser oder Hörer zu einem individuellen Erlebnis. Trotzdem hat der Versuch, dieses Individuelle im Schreib-und Sprechakt zunächst auszuklammern, genauso seine Rechtfertigung wie der Versuch, eine persönliche Erfahrung möglichst nah am Ursprünglichen in Dichtersprache zu übersetzen, wie es Eich in „Latrine“ getan hat. Es macht die literarische Welt umso reicher, wenn zwei einander so nahestehende Erlebnisse sich auf so unterschiedliche Weise ausdrücken wie in „schtzngrmm“ und „Latrine“.
Literaturverzeichnis:
-
Jandl, Ernst:
Laut und Luise.
Darmstadt, 1966. -
Ohde, Horst (Hrsg.):
Günter Eich. Werke.
Frankfurt a.M., 1973 -
Birner, Heinrich Georg:
Naturmystik, Biologischer Pessimismus, Ketzertum.
Günter Eichs Werk im Spannungsfeld der Theodizee.
Bonn, 1978. -
Martin, Sigurd:
Die Auren des Wort-Bildes.
Günter Eichs Maulwurf-Poetik in der Theorie des versehenen Lesens.
St. Ingbert, 1995. -
Schafroth, Heinz F.:
Günter Eich.
München, 1976. -
Riedel, Ingrid (Hrsg.):
Hölderlin ohne Mythos.
Göttingen, 1973. -
Arnold, Heinz Ludwig (Hrsg.):
Text + Kritik: Ernst Jandl.
München, 1996. -
Siblewski, Klaus:
a komma punkt. Ernst Jandl: Ein leben in Texten und Bildern.
München, 2000. -
Knapp, Gerhard P.(Hrsg.):
Georg Büchner: Gesammelte Werke.
Augsburg, 1998. -
Wiedemann, Barbara:
Paul Celan: Die Goll-Affäre.
Frankfurt a.M., 2000.
[...]
- [1] Wiedemann, Barbara. „Paul Celan: Die Goll-Affäre“. Frankfurt, 2000. S. 410-412
- [2] Schafroth, Heinz F.: Günter Eich. München, 1976. S. 17
- [3] ebenda. S.53
- [4] ebenda.
- [5] ebenda. S. 18
- [6] Birner, Heinrich Georg: Naturmystik, Biologischer Pessimismus, Ketzertum. Bonn, 1978. S. 50
- [7] ebenda. S. 48
- [8] ebenda. S. 56
- [9] Schafroth, Heinz F.: Günter Eich. München, 1976. S. 54
- [10] Siblewski, Klaus: a komma punkt. Ernst Jandl – Ein Leben in Texten und Bildern. München, 2000. S. 50-54
- [11] Riha, Karl. „Orientierung“. In: Text + Kritik. Ernst Jandl. Hrsg.: Heinz Ludwig Arnold. München, 1996. S. 15
- [12] ebenda. S. 13
- [13] ebenda. S. 13
- [14] Knapp, Gerhard P. (Hrsg.): Georg Büchner. Gesammelte Werke. Augsburg, 1998. S. 165
- [15] Birner, Heinrich Georg: Naturmystik, Biologischer Pessimismus, Ketzertum. Bonn, 1978. S. 56
- [16] Schafroth, Heinz F.: Günter Eich. München, 1976. S. 17
- [17] Birner, Heinrich Georg: Naturmystik, Biologischer Pessimismus, Ketzertum. Bonn, 1978. S. 56
- [18] ebenda. S. 44
- [19] Schafroth, Heinz F.: Günter Eich. München, 1976. S. 54
- [20] Birner, Heinrich Georg: Naturmystik, Biologischer Pessimismus, Ketzertum. Bonn, 1978. S. 49
- [21] Schafroth, Heinz F.: Günter Eich. München, 1976. S. 52
- [22] Prang, Helmut: Hölderlins Götter-und Christus-Bild. In: Hölderlin ohne Mythos. Hrsg.: Ingrid Riedel. Göttingen, 1973. S. 49
- [23] Martin, Sigurd: Die Auren des Wort-Bildes. St. Ingbert, 1995. S. 233
- [24] ebenda. S. 234
- [25] ebenda. S. 236
- [26] ebenda. S. 236
- [27] ebenda. S. 236
- [28] ebenda. S. 235
- [29] Korte, Hermann: „stückwerk ganz“. In: Text + Kritik: Ernst Jandl. Hrsg.: Heinz Ludwig Arnold. München, 1996. S. 69
- [30] ebenda. S. 71
- [31] ebenda. S. 71/72
- [32] Siblewski, Klaus: a komma punkt. Ernst Jandl – Ein Leben in Texten und Bildern. München, 2000. S. 53
- [33] ebenda. S. 45
- [34] Korte, Hermann: „stückwerk ganz“. In: Text + Kritik: Ernst Jandl. Hrsg.: Heinz Ludwig Arnold. München, 1996. . S. 71
- [35] Riha, Karl. „Orientierung“. In: Text + Kritik: Ernst Jandl. Hrsg.: Heinz Ludwig Arnold. München, 1996. S. 11
- [36] Schafroth, Heinz F.: Günter Eich. München, 1976. S. 18
- [37] Korte, Hermann: „stückwerk ganz“. In: Text + Kritik: Ernst Jandl. Hrsg.: Heinz Ludwig Arnold. München, 1996. . S. 70
- [38] Schafroth, Heinz F.: Günter Eich. München, 1976.
- [39] ebenda.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptfokus dieses Textes?
Dieser Text analysiert die Gedichte "Latrine" von Günter Eich und "schtzngrmm" von Ernst Jandl im Kontext der Nachkriegszeit und der literarischen Bewegung der Gruppe 47. Er untersucht, wie diese Dichter ihre Kriegserlebnisse verarbeitet und in ihren Werken dargestellt haben.
Wer sind Günter Eich und Ernst Jandl?
Günter Eich (1907-1972) war ein deutscher Schriftsteller, der zur Gruppe 47 gehörte. Er wählte während des Dritten Reichs die "Innere Emigration" und schrieb nach dem Krieg Gedichte, die oft von Untergang und Verfall geprägt waren. Ernst Jandl (1925-2000) war ein österreichischer Schriftsteller, der für seine experimentelle Lyrik und seine Mitgliedschaft in der "Wiener Gruppe" bekannt war. Er experimentierte mit Lautgedichten, visueller Poesie und antigrammatischem Schreiben.
Was ist das Gedicht „Latrine“ von Günter Eich?
„Latrine“ ist ein Kriegsgedicht von Günter Eich, das in seiner Gedichtsammlung „Abgelegene Gehöfte“ (1948) veröffentlicht wurde. Es beschreibt einen Soldaten in einem Schützengraben während des Zweiten Weltkriegs, der inmitten von Elend und Verwesung Verse von Hölderlin hört. Das Gedicht wird im Text im Kontext der „Stunde Null“ der deutschen Literatur diskutiert, wobei der Bezug zu Hölderlin eine besondere Rolle spielt.
Was ist das Gedicht „schtzngrmm“ von Ernst Jandl?
„schtzngrmm“ ist ein Lautgedicht von Ernst Jandl, das in seinem Gedichtband „Laut und Luise“ (1966) erschien. Es besteht hauptsächlich aus Konsonanten und imitiert die Geräusche des Krieges, insbesondere eines Schützengrabens. Das Gedicht wird im Text im Kontext von Jandls experimenteller Poetik und seiner Abkehr von traditionellen literarischen Formen untersucht.
Wie werden „Latrine“ und „schtzngrmm“ im Text verglichen?
Der Text vergleicht „Latrine“ und „schtzngrmm“ hinsichtlich ihres Inhalts (Schützengraben), ihrer Entstehungszeit und der unterschiedlichen Herangehensweise der Dichter. Während Eich in "Latrine" seine subjektiven Empfindungen durch das lyrische Ich und den Hölderlin-Bezug zum Ausdruck bringt, verzichtet Jandl in "schtzngrmm" auf ein lyrisches Ich und konzentriert sich auf eine objektive, akustische Darstellung der Kriegserfahrung.
Was bedeutet die „Stunde Null“ in Bezug auf die deutsche Literatur?
Die „Stunde Null“ bezeichnet den Versuch eines literarischen Neuanfangs in der deutschen Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Gruppe 47 prägte diesen Begriff, um einen radikalen Bruch mit der Tradition zu signalisieren und eine neue, unvoreingenommene Literatur zu schaffen. Der Text diskutiert, inwiefern Eich und Jandl diesen Anspruch umgesetzt oder abgelehnt haben.
Welche Rolle spielt Hölderlin in Eichs Gedicht „Latrine“?
Der Bezug zu Friedrich Hölderlin in „Latrine“ hat mehrere Bedeutungen. Zum einen ist der Gedanke an den Dichter Teil der ursprünglichen Empfindung des lyrischen Ichs im Schützengraben. Zum anderen dient Hölderlin als Stilmittel, um die "furchtbare Ungereimtheit der Situation" durch einen starken Kontrast zum Elend zu beschreiben. Schließlich wird Hölderlin als Bezugspunkt für Eichs eigene Poetik herangezogen, die sich an dessen Idee einer dichterischen Übersetzung der Empfindung orientiert.
Was sind die wichtigsten Merkmale von Jandls Poetik?
Jandls Poetik ist geprägt von Experimentierfreude, Dekomposition der Sprache und der Ablehnung einer "exponierten Autor-Position". Er konzentriert sich auf den Schreib- und Sprechvorgang selbst und verzichtet weitgehend auf das Vermitteln eines tieferen Sinns oder einer persönlichen Welterfahrung.
Welche Schlussfolgerungen zieht der Text bezüglich der beiden Gedichte?
Der Text kommt zu dem Schluss, dass „Latrine“ und „schtzngrmm“ trotz ihrer thematischen Nähe sehr unterschiedliche Ansätze zur Verarbeitung der Kriegserfahrung darstellen. Eich verwirklicht in "Latrine" die Übersetzung seiner subjektiven Erinnerung, während Jandl in "schtzngrmm" größtmögliche Objektivität der Erfahrung anstrebt. Beide Gedichte bereichern die literarische Welt durch ihre unterschiedlichen Ausdrucksweisen.
Was sind die wichtigsten Stichworte im Text?
Die wichtigsten Stichworte im Text sind: Günter Eich, Ernst Jandl, Latrine, schtzngrmm, Gruppe 47, Stunde Null, Nachkriegszeit, Kriegserlebnisse, Lyrik, Lautgedicht, Experimentelle Literatur, Hölderlin, Poetik, Subjektivität, Objektivität, Sprache, Verwesung, Schützengraben.