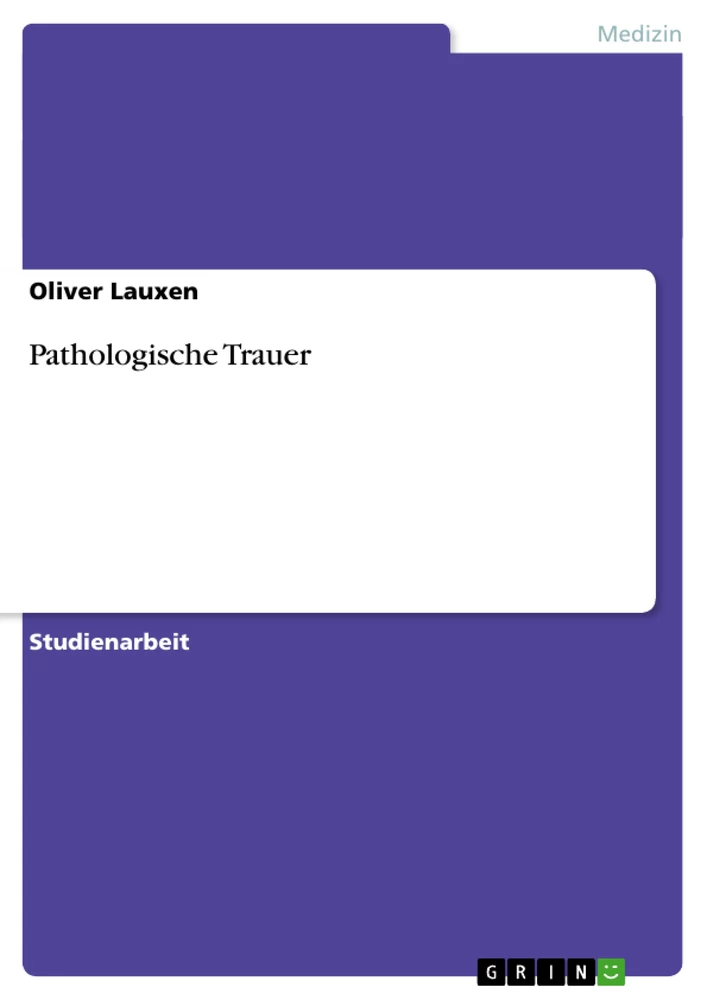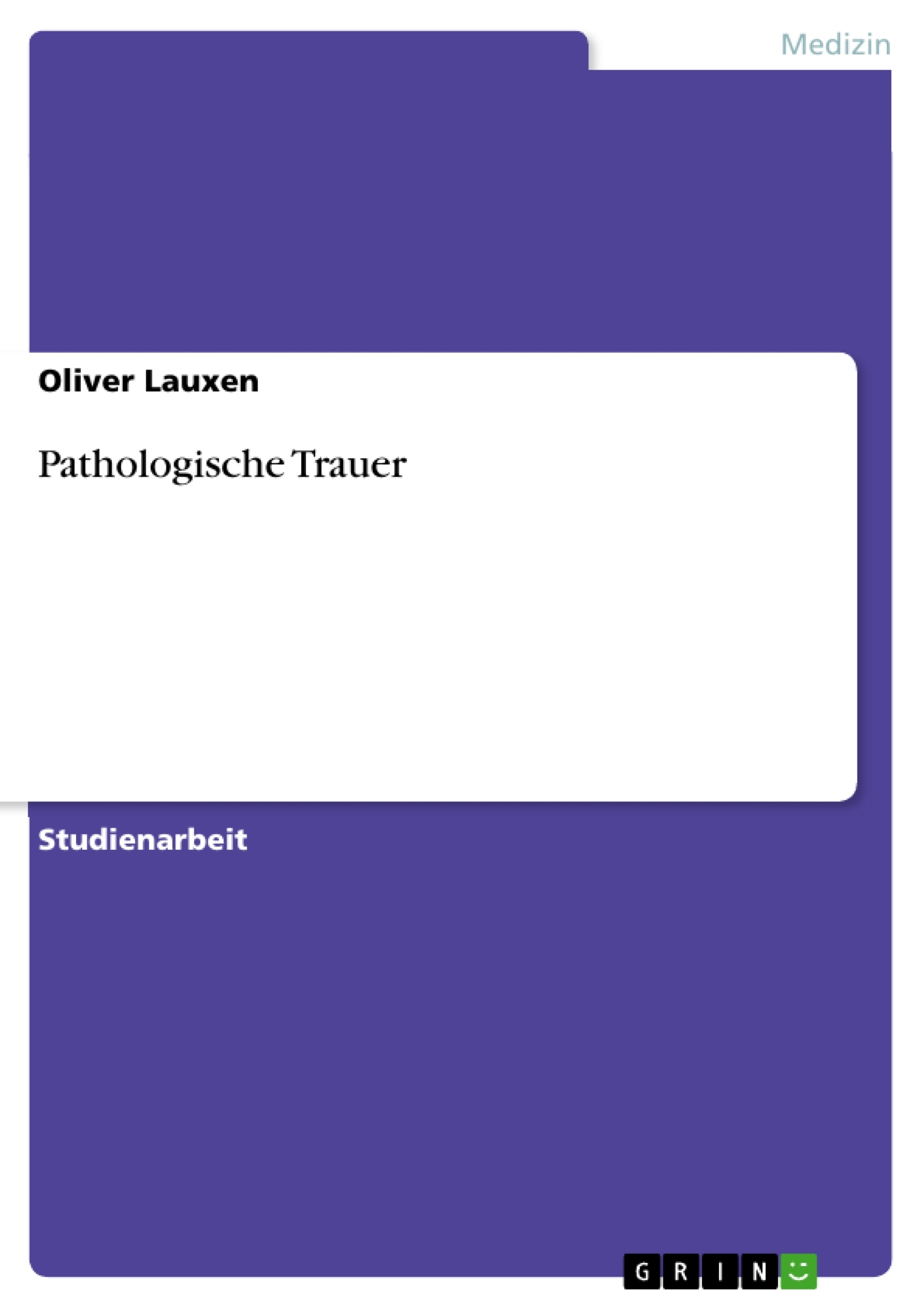Was, wenn Trauer nicht einfach nur ein Gefühl, sondern eine komplexe psychische Belastung sein kann, die das Leben nachhaltig beeinträchtigt? Diese tiefgründige Analyse dringt in die verborgenen Winkel der pathologischen Trauer ein und enthüllt, wie sich normale Trauer von ihren komplizierten, behandlungsbedürftigen Formen unterscheidet. Anhand neuester Forschungsergebnisse und etablierter theoretischer Rahmen, darunter die einflussreichen Arbeiten von Worden, Horowitz und Prigerson, werden die diagnostischen Herausforderungen und die vielfältigen Symptome dieser oft übersehenen Störung beleuchtet. Der Leser erhält einen umfassenden Einblick in die Kriterien zur Diagnose von komplizierter Trauer, die Unterschiede zwischen verschiedenen Diagnoseansätzen und die verfügbaren Messinstrumente, um Betroffenen frühzeitig zu erkennen und zu unterstützen. Doch damit nicht genug: Es werden innovative psychotherapeutische Interventionen vorgestellt, von Wordens psychodynamisch fundierter Hinterbliebenentherapie bis hin zu Shear's kognitiv-verhaltenstherapeutischem "Treatment of Complicated Grief". Die Wirksamkeit dieser Ansätze wird kritisch bewertet, wobei auch die Grenzen und zukünftigen Forschungsrichtungen aufgezeigt werden. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Leitfaden für Psychologen, Therapeuten, Trauerbegleiter und alle, die sich eingehend mit den komplexen Facetten von Trauer auseinandersetzen möchten, um neue Wege der Heilung und des Trostes zu finden. Es wirft ein neues Licht auf die oft missverstandene Erfahrung des Verlustes und bietet praktische Werkzeuge, um Menschen in ihren dunkelsten Stunden beizustehen. Tauchen Sie ein in die Welt der Trauerforschung und entdecken Sie, wie wissenschaftliche Erkenntnisse und therapeutische Innovationen Hoffnung schenken können. Die Auseinandersetzung mit Themen wie Depression, Angststörungen, Bewältigungsstrategien und Resilienz hilft, ein tieferes Verständnis für die menschliche Psyche im Angesicht des Todes zu entwickeln. Lassen Sie sich von diesem Werk inspirieren, Ihr Wissen zu erweitern und Ihre Fähigkeit zur Empathie und Unterstützung trauernder Menschen zu vertiefen, um somit einen wertvollen Beitrag zur psychischen Gesundheit in unserer Gesellschaft zu leisten und neue Perspektiven im Umgang mit Verlust und Trauer zu gewinnen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Kann Trauer pathologisch sein?
1.1 Konzeption pathologischer Trauer nach Worden
1.2 Complicated Grief/ Traumatic Grief..
2 Das Diagnostizieren pathologischer Trauer
2.1 Diagnosekriterien nach Horowitz et al.
2.2 Diagnosekriterien nach Prigerson et al.
2.3 Vergleich der beiden Kriteriensets
2.4 Messinstrumente
3 Psychotherapeutische Interventionen bei pathologischer Trauer
3.1 Hinterbliebenentherapie nach Worden.
3.2 Kognitive Verhaltenstherapie
3.3 Traumatic Grief Treatment
Ausblick
Literaturverzeichnis
Einleitung
In der folgenden Arbeit werden Ergebnisse der Forschung zu pathologischen Trauerreaktionen dargestellt. Dabei werden neben den Erkenntnissen der „modernen“ Trauerforschung der letzten zehn Jahre auch eher psychodynamisch/psychoanalytisch orientierte Ansätze beschrieben. Im Rahmen dieser Arbeit kann kein umfassender Überblick über die Thematik gegeben werden, lediglich ein Einblick, der vielleicht an einigen Stellen mehr Fragen aufwirft als er klären kann.
Eine normale Trauerreaktion kann folgendermaßen definiert werden: „ Trauer ist die emotionale und physische Antwort auf den Tod eines geliebten Menschen. Sie ist mit einer weiten Bandbreite an Emotionen wie Traurigkeit, Wut, Verzweiflung und Schuldgefühlen verbunden, die bei verschiedenen Personen in verschiedenen Kombinationen auftreten“ (Ringold, 2005, Übers. des Verf.). Normalerweise nimmt die Intensität dieser Symptome mit der Zeit ab. Die klinische Praxis hat jedoch gezeigt, dass nicht alle Trauerreaktionen nach diesem Muster ablaufen. Einige Trauernde leiden so sehr, dass sie ihren Alltag nicht mehr ohne Hilfe bewältigen können. Bei ihnen dauern die Symptome besonders lange an und sind besonders intensiv. Man spricht dann von einer pathologischen Trauerreaktion, für die kennzeichnend kann sein, dass der Trauernde den Verlust nicht akzeptieren kann oder ständig an den Tod oder den Verstorbenen denken muss (vgl. Ringold, 2005). In dieser Arbeit wird nun der Frage nachgegangen, wie Psychiater und Psychologen das Phänomen ,pathologische Trauer´ betrachten.
Im ersten Kapitel wird die auf psychodynamischen Annahmen beruhende Konzeption J. W. Wordens vorgestellt und kritisch beleuchtet. Dann wird gezeigt, wie die Trauerforschung der letzten zehn Jahre nachweisen konnte, dass pathologische Trauer sich von Störungen mit ähnlicher Symptomatik unterscheidet und damit eine eigenständige Entität darstellt.
Im zweiten Kapitel werden dann zwei verschiedene Kriteriensets vorgestellt, mit denen pathologische Trauer diagnostiziert werden kann. Im Rahmen dessen werden auch die Symptome näher beschrieben, die diese Störung kennzeichnen. Auch der Frage, wie man Trauerreaktionen messen kann, wird nachgegangen, indem verschiedene Fragebögen betrachtet werden.
Zum Abschluss ist im dritten Kapitel zu überlegen, wie den Trauernden geholfen werden kann, wie die Symptome gelindert werden können. Dazu werden eine psychodynamisch orientierte und eine kognitiv-verhaltenstherapeutische Intervention vorgestellt.
Da die Ergebnisse der Trauerforschung scheinbar fast ausschließlich in nordamerikanischen Zeitschriften und damit in englischer Sprache präsentiert werden, konnte ich keine deutschen Übersetzungen für einen Großteil der Fachbegriffe finden. Weil die Verwendung dieser Begriffe jedoch unvermeidlich ist, habe ich sie, wenn notwendig, übersetzt und dies entsprechend gekennzeichnet. Auch die Symptome in den Kriteriensets (Kapitel 2.1 und 2.2) wurden von mir übersetzt, obwohl dies um der besseren Lesbarkeit willen dort nicht kenntlich gemacht wurde.
Der Begriff ,pathologische´ Trauer, den ich häufig verwende und der auch Titel dieser Arbeit ist, wird in der gesichteten Literatur selten verwendet. Früher bezeichnete man damit alles, was mit unnormalen Trauerreaktionen zu tun hatte (vgl. Glass, 2005), heute werden andere Termini bevorzugt, wie im Hauptteil der Arbeit gezeigt wird. Ich habe mich dennoch für Verwendung des Ausdrucks entschieden, weil er leicht verständlich ist und weil unter den Trauerforschern sowieso noch keine Einigkeit besteht, welcher Begriff am besten geeignet ist, die Störung zu beschreiben.
1. Kann Trauer pathologisch sein?
Sigmund Freud (1917) war einer der ersten Wissenschaftler, der sich systematisch auf der Basis klinischer Beobachtung mit Trauer auseinandersetzte. Für ihn stellte die Reaktion auf den Tod eines geliebten Menschen keinen krankhaften, behandlungsbedürftigen Zustand dar, auch wenn die Erfahrung sehr schmerzhaft und der Zustand des Trauernden sicher nicht als normal zu bezeichnen sind. Die pathologische Form der Trauer nennt Freud stattdessen „Melancholie“, was unserer heutigen Vorstellung einer klinischen Depression entspricht (vgl. Glass, 2005). Die Symptome sind sowohl bei Trauer als auch bei Melancholie die gleichen, nämlich „tief schmerzende Verstimmung“, „vermindertes Interesse an der Außenwelt“, „verminderte Libido“ und „verminderte Leistungsfähigkeit“. Hinzu kommt aber bei der Melancholie eine Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls mit Selbstbeschimpfungen und Selbstvorwürfen, die ein Ausdruck von Zornimpulsen gegen den Verstorbenen sind und die beim normal Trauernden nicht vorkommen. Die Ähnlichkeit der Symptome von Trauer und Depression führte also dazu, dass Freud die psychoanalytische Erklärung depressiver Störungen auf Verlusterlebnisse gründete (vgl. Comer, 2001).
Auch J. W. Worden (1999) beschreibt gemeinsame Kennzeichen und betont wie Freud, dass es bei einer Trauerreaktion höchstens für kurze Zeit zur Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls kommt. Auch kann der Verlust einer geliebten Person zu einer depressiven Störung führen, allerdings ist Worden davon überzeugt, dass es unabhängig davon eine pathologische Form von Trauer gibt, die sich von einer Depression unterscheidet. Er beruft sich auf den Psychiater George Engel, der schon in den 60er Jahren davon sprach, dass Trauer Gegenstand klinischer Forschung sein sollte, und zwar einfach deshalb, weil sie einen nicht normalen Gesundheitszustand darstellt (vgl. Glass, 2005). Er vergleicht den Verlust eines geliebten Menschen mit einer schweren Verwundung: Genauso, wie die Wunde auf verschiedene Weisen heilen kann, so kann auch der Prozess des Trauerns unterschiedlich verlaufen, nämlich normal oder pathologisch. Wie lange dieser Prozess dauert, ist ebenso wie der Grad der Beeinträchtigung interindividuell verschieden (vgl. Worden, 1999).
Mittlerweile gibt es unter Trauerforschern einen breiten Konsens, dass Trauer pathologisch sein kann, auch wenn die theoretischen Ansätze unterschiedlich sind (vgl. Stroebe, Van Son, Stroebe, Kleber, Schut & Van Den Bout, 2000). In der Literatur wird in der Regel der Begriff ,Störung´ (Disorder) verwendet, es wird nicht von pathologischer Trauer als ,Krankheit´ oder ,Erkrankung´ gesprochen. Nach der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen ICD-10 sollen Störungen „ einen klinisch erkennbaren Komplex von Symptomen oder Verhaltensauffälligkeiten anzeigen, der immer auf der individuellen und oft auch auf der Gruppen- oder sozialen Ebene mit Belastung und mit Beeinträchtigung von Funktionen verbunden ist, sich aber nicht auf der sozialen Ebene allein darstellt “ (Dilling, Mombour & Schmidt, 1991, S.19).
Neben verschiedenen Definitionen pathologischer Trauer findet man in der Literatur auch verschiedene Konzeptionen, die wiederum Einfluss auf die Definition haben (vgl. Stroebe et al., 2000). Worden (1999) hat die Störung wie eine Reihe anderer Forscher nach Typen klassifiziert, wohingegen die modernere Trauerforschung dazu neigt, Trauer gegen andere, ähnliche psychische Störungen abzugrenzen. Im Folgenden wird nun zuerst die typologische Klassifikation Wordens und dann die Abgrenzung pathologischer Trauer zu anderen Störungen mit mathematisch-statistischen Methoden dargestellt.
1.1 Konzeption pathologischer Trauer nach Worden
Worden (1999) beschreibt vier Formen pathologischer Trauer, die er „komplizierte Trauerreaktionen“ (S. 69) nennt:
1. chronische Trauerreaktionen: Damit sind solche Trauerreaktionen gemeint, die übermäßig lange anhalten.
2. verzögerte Trauerreaktionen: Die Trauer nach dem Tod reicht nicht aus, um den Verlust angemessen zu verarbeiten. In einer späteren, ähnlichen Verlustsituation kommt es dann zu einer übertriebenen Trauerreaktion.
3. übertriebene Trauerreaktionen: Die Reaktion auf den Verlust fällt extrem intensiv aus und lähmt den Trauernden regelrecht. Irrationale Gefühle von Hoffnungslosigkeit sind kennzeichnend.
4. larvierte Trauerreaktionen: Hier bringt der Trauernde die Symptome, unter denen er leidet, nicht mit dem Verlust in Verbindung. In der Literatur wird dafür auch der Begriff „maskierte Trauer“ (vgl. Enright & Marwit, 2002) verwendet.
Da diese Taxonomie pathologischer Trauerreaktionen zum Großteil auf klinischer Intuition und klinischer Beobachtung und nicht auf empirischen Daten beruht, versuchten Enright & Marwit (2002) ihre Validität empirisch zu prüfen. Dafür legten sie 30 klinischen Psychologen je vier detaillierte Fallgeschichten vor. Jede dieser Fallgeschichten repräsentierte ganz eindeutig eine von Wordens Trauerkategorien. Zum einen (1.Messvariable) wurden den Psychologen nun 9 Items vorgelegt, wobei auf einer 7-stufigen Skala eingeschätzt werden musste, wie gut sie auf den einzelnen Fall zutreffen (Beispiele: „somatische oder psychiatrische Symptome“ oder „unnormal kurze Trauerreaktion“). Nach Worden führen bestimmte Itemkombinationen zur Einordnung in eine der beschriebenen Kategorien.
Als Nächstes (2. Messvariable) mussten die Teilnehmer der Studie für jede Fallgeschichte auf einer 7-stufigen Skala angeben, wie gut die vier Trauerkategorien dazu passen.
Die Ergebnisse der statistischen Auswertung sahen folgendermaßen aus:
a.) 1. Messvariable: Es wurde eine Korrelationsmatrix erstellt, die den Zusammenhang zwischen den einzelnen Items und der jeweiligen Trauerkategorie abbildet. Für die Fallgeschichte zur chronischen Trauer sind die Korrelationen gut, für larvierte und verzögerte Trauer nicht ganz so gut: Hier korreliert nur jeweils ein Item signifikant mit der entsprechenden Trauerkategorie. Gleiches gilt für übertriebene Trauer, wobei hier das entsprechende Item theoretisch gar nicht korrelieren dürfte!
Die Ergebnisse für die 1. Messvariable sprechen also nicht für die Validität von Wordens Taxonomie.
b.) 2. Messvariable: Hier wurden nun für jede Fallgeschichte Mittelwerte gebildet, die zeigten, wie hoch die Psychologen jede Trauerkategorie einschätzten. Erwartungsgemäß müsste z.B. der Wert für chronische Trauer bei der Fallgeschichte zur chronischen Trauer signifikant höher sein als die Einschätzungen für die anderen drei Kategorien. Bei den Fallgeschichten zur chronischen und verzögerten Trauer war dies auch so. Aus dem Mittelwertsvergleich zur übertriebenen Trauer kann geschlossen werden, dass es den Psychologen schwer fällt, zwischen übertriebener und chronischer Trauer zu unterscheiden. Der Mittelwert für übertriebene Trauer unterschied sich nämlich signifikant nur von dem für larvierte und verzögerte Trauer. Was larvierte Trauer angeht, war der entsprechende Mittelwert nicht signifikant höher als die anderen Mittelwerte.
Häufig konnte außerdem beobachtet werden, dass die Teilnehmer zwei oder gar drei Trauerkategorien gleich hoch einschätzten.
Die Ergebnisse legen nach Enright & Marwit (2002) den Schluss nahe, dass Kliniker nicht alle von Worden zugrunde gelegten Variablen in ihr Urteil einbeziehen; von daher erklären sich die nicht gefundenen Korrelationen (1. Messvariable). Nur für chronische Trauer wurden die erwarteten Ergebnisse gefunden. Die Konzepte sind außerdem nicht klar voneinander getrennt, es bestehen Überlappungen; mit Ausnahme der Fallgeschichte zur chronischen Trauer legten die Kliniker sich nicht auf nur eine Kategorie pro Fall fest. Gerade das Konzept der verzögerten Trauer ist in der Praxis problematisch, da dabei gegensätzliche Symptome (anfangs wenig Reaktion, später heftige Reaktion) auftreten. Von daher lässt sich auch die nicht erwartete negative Korrelation mit dem Item „exzessive und intensive Trauerreaktion“ erklären (s. o.). Dass die Psychologen nicht dazu neigen, höhere Werte für übertriebene Trauer zu vergeben, spricht außerdem für die Schwäche dieses Konzepts. Insgesamt scheint die Validität für Wordens Klassifikation äußerst fragwürdig zu sein.
Enright & Marwit (2002) folgern, dass wohl zwei Kategorien anstatt vier ausreichen, pathologische Trauer adäquat zu beschreiben. Zum einen scheinen chronische und übertriebene Trauer zusammenzuhängen, zum anderen verzögerte und larvierte Trauer. Eine Überarbeitung des Klassifikationssystems scheint jedenfalls unabdingbar für die weitere Forschung.
Problematisch ist sicher, dass sich, wie Worden, ein Großteil der Trauerforschung auf klinische Beobachtung beruft. Es gibt allerdings einen starken Trend hin zum systematischen Sammeln von Daten, um die Gefahr von Messfehlern zu minimieren (vgl. Glass, 2005). Die im nächsten Kapitel vorgestellten Forschungsergebnisse sind auf der Basis mathematisch-statistischer Methoden gewonnen worden.
1.2 Complicated Grief Disorder/ Traumatic Grief Disorder
Auch die Trauerforscher, die Trauerreaktionen mit mathematisch-statistischen Methoden untersuchen, konnten sich bisher noch nicht auf einen einheitlichen Begriff einigen. Während einige die Störung „Traumatic Grief“ (traumatische Trauer, Übers. des Verf.) nennen, bevorzugen andere den Terminus „Complicated Grief“, der mit komplizierte Trauer übersetzt werden kann (vgl. Jacobs, Mazure & Prigerson, 2000). Am Begriff „Traumatic“ stört, dass er implizieren könnte, dass die Art des vorangegangenen Todes traumatisch gewesen sein muss (Suizid, Mord…), damit es beim Angehörigen zu einer pathologischen Trauerreaktion kommt (vgl. Glass, 2005). Gemeint ist aber, dass der Zustand des Trauernden traumatisch ist (vgl. Jacobs et al., 2000).
Auch der Terminus „Complicated Grief“ wurde nicht kritiklos akzeptiert: Hier stört die negative Konnotation, die der Begriff ,kompliziert´ hat (vgl. Jacobs et al., 2000). Zur Verwirrung kommt noch dazu, dass einzelne Autoren sowohl die eine als auch die andere Bezeichnung verwenden (s. H. Prigerson, die 1996 von Complicated, 2000 von Traumatic Grief spricht). In dieser Arbeit wird der Begriff, den auch die Forscher, auf die ich mich gerade beziehe, benutzt.
Beide Termini beschreiben jedenfalls das Gleiche, nämlich ein bestimmtes Cluster von Symptomen. Wie diese Symptome genau aussehen, wird in den Kapiteln 2.2 und 2.3 im Rahmen der Probleme beim Diagnostizieren pathologischer Trauer beschrieben. Im Folgenden geht es erst einmal darum, zu zeigen, wie mathematisch-statistisch die Entität Complicated Grief nachgewiesen werden konnte:
Die Forschergruppe um Prigerson leistete Mitte der 90er Jahre Pionierarbeit, als sie dies mittels Faktorenanalyse zeigte (Prigerson, Bierhals, Kasl, Reynolds, Shear, Newsom & Jacobs, 1996): An der Studie nahmen 150 Personen teil, deren Partner verstorben waren; die Trauernden waren selbst nicht in klinischer Behandlung. Neben Depressions- und Angstwerten wurden mit einem Fragebogen die Trauerreaktionen gemessen. Bei der anschließenden Faktorenanalyse zeigte sich eine Drei-Faktoren-Struktur, wobei die drei Faktoren 90% der Varianz erklärten. Alle trauerspezifischen Symptome laden dabei hoch auf Faktor 1, dem Complicated Grief-Faktor und sehr niedrig auf den beiden anderen Faktoren. Depressionssymptome laden auf Faktor 2, dem Depressionsfaktor, hoch und auf den beiden anderen niedrig. Auch die Angstsymptome laden nur auf einem, nämlich dem Angstfaktor hoch und auf den beiden anderen niedrig (s. Tabelle 1, nächste Seite). Die Drei-Faktoren-Struktur und die Tatsache, dass alle Trauersymptome auf den beiden anderen Faktoren niedrig laden, werden so interpretiert, dass Complicated Grief eine eigenständige klinische Entität bildet, die sich von Depression und Angststörungen unterscheidet.
In den Niederlanden fanden Boelen, Van Den Bout & De Keijser (2003) dieselben Ergebnisse bei der Untersuchung einer größeren Stichprobe. Auch hier laden die Symptome auf einem entsprechenden Faktor hoch und auf den beiden anderen Faktoren niedrig. Dies spricht für die Generalisierbarkeit der Ergebnisse.
Ganz unabhängig scheinen die drei Störungen aber dennoch nicht zu sein, denn es wurden mäßige Korrelationen zwischen den Störungen gefunden (vgl. Prigerson et al., 1996):
- Complicated Grief und Depression: 0,15
- Complicated Grief und Angst: 0,33
- Depression und Angst: 0,13
Es gibt natürlich auch kritische Stimmen von Forschern, die versuchten, diese Ergebnisse zu replizieren:
Hogan, Worden & Schmidt (2004) unterzogen die Daten von 166 trauernden Eltern mehreren statistischen Analysen und fanden bedeutend höhere Korrelationen zwischen den Störungen als die oben beschriebenen. Außerdem konnten sie die mehrfaktorielle Struktur mit einem Trauer-, einem Depressions- und einem Angstfaktor bei ihrer Datenanalyse nicht finden.
Bei einem der Testverfahren wurden die Teilnehmer dann danach eingeteilt, ob sie die Kriterien für Complicated Grief erfüllten (N=38) oder nicht (N=128). Schließlich wurden die Depressionsscores für die beiden Gruppen verglichen. Wenn es zwei verschiedene Störungen Depression und Complicated Grief gibt, sollten keine signifikanten Unterschiede in den Depressionswerten gefunden werden können. Diese wurden aber sehr wohl gefunden; die unter Complicated Grief leidenden Trauernden hatten höhere Depressionsscores als die Mitglieder der anderen Gruppe (p<.001).
Auch die Trennung von normaler und pathologischer Trauer (Complicated Grief) wurde in dieser Studie untersucht (vgl. Hogan et al., 2004). Dazu wurden die Korrelationen der Complicated Grief-Symptome mit den Items der Hogan Grief Reaction Checklist, einem Fragebogen, der das Ausmaß normaler Trauerreaktionen erfasst, gemessen: Die Zusammenhänge zwischen den Complicated Grief-Symptomen und den Faktoren normaler Trauer waren signifikant und groß. Dies spricht also auch nicht für die Unterschiedlichkeit von normaler und pathologischer Trauer, obwohl einschränkend zu sagen ist, dass die Stichprobe hier eine ganz andere war als bei Prigerson et al. (1996). Die Teilnehmer hier hatten ein Kind verloren, wohingegen die Teilnehmer der anderen Studie den Verlust eines Partners zu beklagen hatten.
Tabelle 1 zeigt die Faktorenladungen der einzelnen Symptome (Items) auf den drei Faktoren in der Studie von Prigerson et al. (1996):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Trotz vereinzelter kritischer Stimmen gibt es einen Konsens in der Fachliteratur, dass es eine pathologische Form von Trauer gibt (vgl. Stroebe et al., 2000; Glass, 2005); dabei wird immer wieder auf die Studie von Prigerson et al. (1996) verwiesen. Wie die genauen Zusammenhänge mit anderen Störungen aussehen und zu interpretieren sind, wird sicherlich weiterhin Gegenstand der Trauerforschung sein. Im nächsten Kapitel werden nun die Symptome beschrieben, anhand derer die Störung diagnostiziert werden kann.
2. Das Diagnostizieren pathologischer Trauer
Um psychische Störungen einzuordnen, sind verschiedene Klassifikationssysteme entwickelt worden; die gebräuchlichsten sind das Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen (DSM IV) und die Internationale Klassifikation Psychischer Störungen, ein Teil der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10). Psychodynamisch orientierte Psychologen und Psychiater tun sich seit jeher mit solchen Systemen schwer, und dementsprechend stimmen sie in ihren diagnostischen Urteilen oftmals nicht überein, wenn sie denselben Patienten vor sich haben. Die Interrater-Reliabilität ist niedrig, obwohl dieselben Bezeichnungen für die Störungen benutzt werden (vgl. Schneider, Freyberger, Muhs & Schüßler, 1993). Sie kritisieren, dass bei der Entwicklung der oben genannten Klassifikationssysteme mehr Wert auf die Reliabilität denn auf die Validität des diagnostischen Urteils gelegt wurde.
In den Diagnostischen Kriterien zum DSM IV (vgl. Saß, Wittchen, Zaudig & Houben, 1998) findet man unter dem Bereich „Andere klinisch relevante Probleme“ die Diagnose „Einfache Trauer“. Dabei gelten depressive Symptome wie Traurigkeit, Schlaf- und Appetitstörungen nach einem Verlust als „normal“. Wenn diese allerdings länger als zwei Monate bestehen, kann die Diagnose Major Depression vergeben werden. Es wird also zwischen normaler/einfacher Trauer und mit Trauer verbundener Depression unterschieden, ähnlich wie zwischen einer depressiven Verstimmung und einer depressiven Erkrankung. Der plötzliche und unerwartete Verlust einer geliebten Person wird im DSM IV auch als mögliche Ursache für eine Posttraumatische Belastungsstörung angeführt. Die Einordnung in verschiedene Störungsbilder zeigt die Komplexität pathologischer Trauer; eine eigenständige Diagnose gibt es aber bisher nicht.
Einige Forscher würden eine solche sehr begrüßen, da sie die im vorherigen Kapitel angeführten Nachweise für eine eigenständige Trauerkategorie für ausreichend halten (vgl. Glass, 2005). Es bleibt aber die Frage, wo diese Diagnose dann eingeordnet werden müsste, als akute Stressstörung, weil ja ein Umweltfaktor der Auslöser für die Trauerreaktion ist, als Stressorkriterium für die Posttraumatische Belastungsstörung oder wirklich als eigenständige Kategorie (vgl. Stroebe et al., 2000)? Letztere hätte vielleicht den Vorteil, dass der diagnostische Blick vermehrt auch auf Trauerreaktionen gerichtet wird und den Betroffenen schneller geholfen wird. Außerdem würde eine solche Kategorie sicher für weitere Forschung sorgen. Problematisch ist aber, dass die Diagnose möglicherweise zu schnell vergeben wird und damit Gesunde als krank eingestuft werden, weil die Validität der Trauerkategorie noch nicht ausreichend nachgewiesen ist (vgl. Stroebe et al., 2000).
Auch was die Symptome/die Diagnosekriterien angeht, herrscht bisher Uneinigkeit. „ Diagnostik in der Medizin zielt auf das möglichst genaue Erkennen und Abgrenzen einer Krankheit ab “ (Schneider et al., 1993, S. 28). Damit die Diagnosen, die in der klinischen Praxis gestellt werden, valide und reliabel sind, werden in der Regel Kriteriensets benutzt, die dann wiederum als diagnostische Instrumente für die klinische Praxis operationalisiert werden (vgl. Schneider et al., 1993). Meistens werden Interviewleitfäden benutzt, die das diagnostische Gespräch „leiten“. Zwei Kriteriensets für die Diagnose pathologischer Trauer, aus denen solche Instrumente abgeleitet werden können, sind bisher entwickelt worden.
Worden, als ein Vertreter der psychodynamischen Orientierung, glaubt, dass die Einordnung der Trauerreaktion in eine seiner vier Kategorien sowieso ein Leichtes ist, weil die Betroffenen selbst meist genau wissen, was ihnen fehlt. Die andere Möglichkeit ist, dass ein medizinisches oder psychiatrisches Problem im Vordergrund steht und dem Trauernden nicht bewusst ist, dass der Verlust die Ursache dafür ist. Hier ist die Erfahrung des Klinikers gefragt (vgl. Worden, 1999). Er beschreibt zwar ein Set von Anhaltspunkten, nach denen sich der Kliniker richten kann (so könnte beispielsweise das Meiden der Begräbnisstätte ein Anzeichen für eine maskierte Trauerreaktion sein), geht aber dabei nicht systematisch vor, er verlässt sich auf seine klinische Intuition. Er hat zwar seinen vier Kategorien jeweils bestimmte Symptome zugeordnet, wobei deren Validität, wie in Kapitel 1.1 gezeigt, nicht so hoch ist wie erhofft (vgl. Enright & Marwit, 2002). Vielleicht ist es sinnvoll, den diagnostischen Blick weniger auf das Vorhandensein oder Fehlen von Symptomen zu richten, sondern mehr auf Dauer und Intensität der Trauerreaktion (vgl. Worden, 1999; Enright & Marwit, 2002). Dies wird auch in den beiden im Folgenden beschriebenen Kriteriensets betont, wobei weder Dauer noch Intensität als Kriterien bisher genauer untersucht worden sind (vg. Hogan et al., 2004).
2.1 Diagnosekriterien nach Horowitz
Anders als Worden waren Horowitz, Siegel, Holen, Bonanno, Milbrath & Stinson (1997) bestrebt, mit statistischen, mathematischen Methoden die besten Kriterien zum Stellen einer Diagnose Complicated Grief zu finden. Bei der Beobachtung von Trauernden, die nach dem Verlust eine Kurzzeittherapie aufsuchten, fanden sie drei Symptomkomplexe, die kennzeichnend sind für verlängerte Trauerreaktionen, nämlich fehlende Anpassung an den Verlust, Vermeidung und Intrusionen (=zwanghaft wiederkehrende und überwältigende Erlebnisinhalte einer traumatisch erlebten Situation). Diese Symptome wurden mit Hilfe eines Moduls für ein klinisches Interview operationalisiert. Zusätzlich wurden in der Studie Selbsteinschätzungsskalen und das Structured Clinical Interview For DSM III-R (SCID) verwendet. Depressions- und Angstwerte wurden auch erhoben, um Zusammenhänge untersuchen zu können. Die 70 teilnehmenden Trauernden wurden sowohl 6 Monate als auch 14 Monate nach dem Verlust einer geliebten Person untersucht. Der Zeitpunkt 14 Monate wurde deshalb gewählt, weil der Todestag (12 Monate) in der Regel zu zusätzlichen Turbulenzen führt und damit die Ergebnisse verfälscht würden.
Ergebnisse: Insgesamt nehmen sowohl Häufigkeit als auch Intensität der Symptome von 6 nach 14 Monaten ab. Die Trauernden, die nach 6 Monaten hohe Werte hatten, hatten solche aber auch nach 14 Monaten. Die Symptome sind vielseitig, und die Kombinationen interindividuell verschieden. Von daher werden auch 7 Kriterien zur Diagnose genannt, obwohl nach der statistischen Analyse sogar nur 2 ausreichen würden, Complicated Grief nach 14 Monaten verlässlich zu diagnostizieren. Die Autoren schlagen vor, dass mindestens 3 der im Folgenden genannten 7 Symptome vorkommen müssen.
Intrusive Symptome:
1. unerwünschte Gedanken oder wiederkehrende, störende Phantasien hinsichtlich der verlorenen Beziehung
2. starke „emotionale Anfälle“ hinsichtlich der verlorenen Beziehung
3. schmerzende, starke Sehnsucht und der Wunsch, der Verstorbene sei hier
Symptome der Vermeidung und fehlender Anpassung an den Tod:
4. Gefühl, viel zu viel alleine oder innerlich leer zu sein
5. exzessives Fernbleiben von Orten, Personen oder Aktivitäten, die an den Verstorbenen erinnern
6. ungewöhnlich starke Schlafstörungen
7. Verlust an Interesse an der Arbeit, Fürsorgepflichten, sozialen oder Freizeitaktivitäten in einem krankhaften Ausmaß
Von diesen sieben Symptomen müssen nach Meinung der Autoren mindestens drei im letzten Monat in einem Schweregrad aufgetreten sein, so dass das tägliche Funktionieren beeinträchtigt war. Neben diesen Symptomkriterien muss auch noch das so genannte Ereigniskriterium erfüllt sein, nämlich der mindestens 14 Monate zurückliegende Verlust eines Verwandten, Ehe- oder sonstigen Partners. Dann kann die Diagnose „Complicated Grief“ gestellt werden.
Insgesamt war dies bei 41% der 70 Teilnehmer der Fall. Zusammenhänge mit Angststörungen wurden nicht gefunden, dafür scheint Depression eine Rolle zu spielen. Die folgende Tabelle veranschaulicht, wie die Zusammenhänge aussehen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2 (vgl. Horowitz et al., 1997)
21% der Teilnehmer, für die die Diagnose Complicated Grief gestellt werden konnte, hatten gleichzeitig eine Major Depression. Im Vergleich dazu konnte bei keinem der nicht unter der Trauerstörung Leidenden eine Depression diagnostiziert werden. Auch hing die Häufigkeit einer Major Depression im gesamten vorherigen Leben hochsignifikant mit dem Auftreten einer komplizierten Trauerreaktion 14 Monate nach dem Verlust zusammen. Die Depression könnte also die Entstehung pathologischer Trauerreaktionen begünstigen, eine Prädisposition darstellen (vgl. Horowitz et al., 1997). Dies müsste aber noch genauer untersucht werden.
Die Diagnosekriterien der Forschergruppe um Horowitz sind nicht kritiklos angenommen worden. Eine Expertengruppe bestehend aus Psychiatern, Trauma- und Trauerexperten legte etwa zeitgleich ein zweites Kriterienset vor (vgl. Jacobs, Mazure & Prigerson, 2000), das etwas umfangreicher ist und im nächsten Kapitel vorgestellt wird.
2.2 Diagnosekriterien nach Prigerson
Auch dieses Kriterienset stützt sich auf die Ergebnisse der Forschung von Prigerson et al. (1996). Es gibt eine Reihe Gemeinsamkeiten zwischen beiden Sets, aber auch bedeutende Unterschiede, wie sich schon in den Begrifflichkeiten zeigt: Sprechen Horowitz et al. (1997) von Complicated Grief, so halten die Forscher hier den Ausdruck Traumatic Grief zum einen für präziser, dass Phänomen zu beschreiben, zum anderen klingt er nicht so negativ und damit stigmatisierend (vgl. Jacobs et al., 2000).
Es werden zwei Symptomkomplexe genannt, die die Störung kennzeichnen:
1. Separation-Distress-Symptome (=Trennungskummersymptome, Übers. des Verf.): Dazu zählen „schmerzhafte Anfälle von Sehnsucht“, „Versunkensein“, „Einsamkeit“, „Weinen“ und Symptome im Bereich der Wahrnehmung (visuelle, taktile und auditive Halluzinationen).
2. Traumatic-Distress-Symptome (=Traumakummersymptome, Übers. des Verf.): Hierzu zählen „wiederkehrende, störende Gedanken an den Verstorbenen“, „Empfindungslosigkeit“, „Nicht-Glauben des Todes“, „sich betäubt und gelähmt fühlen“ und ein „gestörtes Gefühl von Vertrauen und Sicherheit“.
Damit nun die Diagnose Traumatic Grief gestellt werden kann, müssen die Trauernden vier Kriterien erfüllen:
Kriterium A: 1. Die Person hat einen geliebten Menschen durch Tod verloren.
2. Zur Reaktion darauf gehört die wiederkehrende, störende und schmerz- hafte Beschäftigung mit dem Verstorbenen (Sehnsucht, Suchen,.)
Kriterium B: Als Reaktion auf den Verlust sind die folgenden Symptome kenn- zeichnend und andauernd:
1. häufige Versuche, Erinnerungen an den Verstorbenen zu meiden
2. Gefühl der Sinnlosigkeit/Zwecklosigkeit (bzgl. der Zukunft)
3. subjektives Gefühl, betäubt/losgelöst zu sein oder Fehlen emotionaler Reaktionen
4. sich empfindungslos, betäubt oder schockiert fühlen
5. Schwierigkeiten, den Tod anzuerkennen
6. das Gefühl, das Leben ist leer und sinnlos
7. Schwierigkeiten, sich ein erfülltes Leben ohne den Verstorbenen vorzustellen
8. das Gefühl, ein Stück von einem selbst sei gestorben
9. zerstörtes Weltbild (Vertrauens-, Sicherheits- oder Kontrollverlust)
10. Symptome oder Verhalten des Verstorbenen für sich übernehmen
11. starke Reizbarkeit, Bitterkeit oder Wut bzgl. dem Tod
Kriterium C: Die Symptome dauern mindestens zwei Monate an.
Kriterium D: Die Symptome führen zu klinisch relevanten Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen.
Hogan, Worden & Schmidt (2004) konnten die Validität dieses Kriteriensets nicht nachweisen. Die Zwei-Faktoren-Struktur mit Separation-Distress-Symptomen und Traumatic-Distress-Symptomen wurde nicht gefunden, die beiden Konstrukte korrelierten zu 96%. Allerdings war die Stichprobe hier natürlich eine andere als bei Jacobs et al. (2000), nämlich Eltern, die ein Kind verloren hatten. Valide Schlussfolgerungen über Subgruppen hinweg können bisher also noch nicht gemacht werden (vgl. Hogan et al., 2004). Außerdem sind die Kriterien C und D bisher empirisch noch gar nicht untersucht worden, auch wenn sich für Kriterium C abgezeichnet hat, dass die Trauerreaktion eher lang als kurz ist (vgl. Stroebe et al., 2000).
2.3 Vergleich der beiden Kriteriensets
Trotz der oben genannten Einwände lohnt sich ein Vergleich der beiden vorgelegten Kriteriensets.
Für beide Forschergruppen gilt, dass die Diagnose nur gestellt wird, wenn die Symptome zu klinisch relevanten Beeinträchtigungen führen. Außerdem sind die oben genannten Separation-Distress-Symptome vergleichbar den intrusiven Symptomen bei Horowitz et al., die gemeinsame Basis kann somit als positiv bewertet werden (vgl. Jacobs et al., 2000).
Ein statistisches Problem stellen die Vermeidungssymptome dar. Horowitz et al. (1997) nennen „exzessives Fernbleiben von Orten, Personen oder Aktivitäten, die an den Verstorbenen erinnern“ als Diagnosekriterium, Jacobs et al. (2000) sprechen von „häufigen Versuchen, Erinnerungen an den Verstorbenen zu meiden“. Diese Vermeidungssymptome sind aber ein ganz schlechter Prädiktor für Traumatic Grief (vgl. Jacobs et al., 2000). Sinn könnte es machen, wenn man sie dahingehend interpretiert, dass der Trauernde Orte, Personen und Aktivitäten meidet, weil er so sehr mit seiner Trauer beschäftigt ist, aber nicht, weil er Erinnerungen an den Verstorbenen meiden will. Er ist ja, ganz im Gegenteil, in einem nicht mehr normalen Maße mit seiner Trauer beschäftigt! Das Symptom wurde jedenfalls vorerst im Kriterienset belassen, solange bis dieses definitiv getestet worden ist (vgl. Jacobs et al., 2000).
Auch was die Dauer der Symptome angeht, gibt es Unterschiede: Horowitz et al. (1997) sprechen von mindestens einen Monat andauernden Symptomen 14 Monate nach dem Verlust (vgl. Horowitz et al., 1997), um Complicated Grief diagnostizieren zu können. Die Forschergruppe um Jacobs (2000) tendiert dagegen dazu, schneller zu intervenieren. Hier reicht es aus, wenn die Symptome zwei Monate andauern, ganz egal, wie lange der Todesfall her ist; im frühesten Fall also schon zwei Monate nach dem Verlust. Dies birgt natürlich ein erhöhtes Risiko für falsch positive Diagnosen in sich (vgl. Jacobs et al., 2000).
Schlafstörungen werden bei Jacobs et al. (2000) auch nicht aufgeführt, da kein statistischer Zusammenhang mit Traumatic Grief gefunden werden konnte.
Statistisch betrachtet sind die Symptome unter Kriterium B bei Jacobs et al. (2000) die besten Prädiktoren für das Krankheitsbild, bei Horowitz et al. (1997) finden sich allerdings viele der dort genannten nicht wieder. Damit ist weitere Forschung auf diesem Gebiet unabdingbar, um eine Diagnose Traumatic Grief zuverlässig stellen zu können. Die beiden vorgelegten Kriteriensets bilden eine brauchbare Grundlage dafür (vgl. Jacobs et al., 2000).
2.4 Messinstrumente
Um eine psychische Störung in der klinischen Praxis einfach und sicher diagnostizieren zu können, ist es sinnvoll, die Diagnosekriterien in einen Fragebogen oder einen Leitfaden für ein klinisches Interview zu übersetzen (vgl. Schneider et al., 1993).
In den letzten Jahrzehnten wurden in den USA eine Reihe Instrumente entwickelt, die Zusammenhänge zwischen Trauer und physiologischen und psychologischen Zuständen und Verhalten messen sollen. Der Großteil der entwickelten Messinstrumente bildet allerdings lediglich das Ausmaß/die Intensität normaler Trauerreaktionen ab. Beispiele sind der Texas Inventory of Grief, der Grief Experience Inventory, die Grief Measurement Scales oder die Hogan Grief Reaction Checklist, mit der die Trauernden gut nach Todesart und vergangener Zeit seit dem Verlust diskriminiert werden können (vgl. Hogan, Worden & Schmidt, 2004).
Es gibt außerdem Fragebögen, die Trauerreaktionen in bestimmten Situationen messen: Der Grief Experience Questionaire erfasst beispielsweise Trauerreaktionen nach dem Suizid eines geliebten Menschen. Dann gibt es spezielle Messinstrumente für Mütter, die ihr Baby während der Schwangerschaft verloren haben (Perinatal Grief Scale, Perinatal Bereavement Scale) und die Anticipatory Grief Scale, die vorweggenommene Trauer misst, also Trauerreaktionen, die schon vor dem Tod auftreten.
Um pathologische Trauerreaktionen zu erkennen, sind diese Instrumente aber ungeeignet. Werden die Trauernden beim Texas Inventory of Grief beispielsweise in zwei Gruppen (normal und pathologisch Trauernde) eingeteilt, so findet man im Score trotzdem keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen (vgl. Tomita & Kitamura, 2002).
Um das Ausmaß pathologischer Trauer zu messen, wurde 1995 der Inventory of Complicated Grief (ICG) entwickelt. Er ist bisher das einzige solche Instrument und basiert auf den Forschungsergebnissen von Prigerson et al. (1996), die oben vorgestellt wurden. Die Items sind also auf das entsprechende Kriterienset abgestimmt. Es konnte gezeigt werden, dass besonders ältere, trauernde Menschen mit hohen ICG-Werten mehr körperliche Schmerzen und mehr Einbußen in allgemeinen, sozialen, mentalen und physischen Funktionsbereichen hatten (vgl. Tomita & Kitamura, 2002). Trotzdem und obwohl der ICG einer der wenigen Fragebögen in der Trauerforschung ist, der mittels Faktorenanalyse entwickelt wurde und ein sehr guter Wert für die interne Konsistenz des Fragebogens (Cronbach´s Alpha=.94) angegeben wird, sind Tomita & Kitamura (2002) der Meinung, dass die psychometrische Validität nicht ausreichend ist. Normal Trauernde können von pathologisch Trauernden nicht gut genug unterschieden werden. Außerdem ist die Bestimmung trauerspezifischer Aspekte generell schwierig, weil die Reaktionen auf den Tod eines geliebten Menschen den Symptomen von Depression, Angst, Stress, Alterung, Einsamkeit ähneln. Dies spiegelt sich ja auch in den in Kapitel 1.2 beschriebenen Korrelationen wider (vgl. Tomita & Kitamura, 2002; Hogan et al., 2004) und wirkt sich auf die Treffsicherheit des diagnostischen Urteils aus. Die Frage ist also, ob der Test wirklich nur die Trauerreaktion und nichts anderes und ob er diese auch genau genug misst.
Als weitere Einschränkung kann die Schwere einzelner Items/Symptome vom Ausfüller des ICG nicht gewichtet werden. Erfragt wird entweder der Grad der Zustimmung zu einem Item („stimme voll und ganz zu“ ….. „stimme überhaupt nicht zu“) oder die Häufigkeit des Auftretens eines Symptoms („nie oder selten“ ….. „5-7mal wöchentlich“). Dann wird ein Gesamtscore gebildet. So wird Trauer aber möglicherweise nicht in ihrer ganzen Komplexität adäquat abgebildet, weil nicht alle Symptome für jeden Trauernden gleich bedeutend und gleich störend sind.
Dann stellt sich natürlich auch noch die Frage, ab welchem Score im ICG der Trauernde nicht mehr ein normal Trauernder, sondern ein pathologisch Trauernder ist. Diese Frage wird in der gesichteten Literatur nicht beantwortet; es fällt lediglich auf, dass die Forschergruppen von unterschiedlichen „Grenzwerten“ ausgehen. Die Forschergruppe um Shear & Frank, die eine psychotherapeutische Intervention für pathologisch Trauernde entwickelt haben, halten in ihrem Pilotprojekt (2001) noch einen ICG-Score von >25 für sinnvoll, vier Jahre später (2005) müssen die Trauernden dann einen Wert >30 haben, um als pathologisch trauernd eingestuft zu werden. Warum der Wert hoch gesetzt wurde, wird nicht weiter ausgeführt.
3. Psychotherapeutische Interventionen bei pathologischer Trauer
Forscher schätzen, dass etwa 20% aller Trauernden pathologisch trauern (vgl. Silverman, Jacobs, Kasl, Shear, Maciejewski, Noaghiul & Prigerson, 2000; Shear, Frank, Houck & Reynolds, 2005). Es sind also nicht wenige Menschen, die Hilfe benötigen, wenn man bedenkt, dass allein in den USA jährlich 2.5 Millionen Menschen sterben. Wenn jeder von ihnen im Durchschnitt fünf Trauernde zurücklässt, dann käme man auf eine Million Menschen, die unter einer pathologischen Trauerreaktion leiden (vgl. Shear et al., 2005). Die Wichtigkeit einer effektiven Intervention wird umso deutlicher, wenn man betrachtet, zu welchen gesundheitlichen Beeinträchtigungen die Reaktionen auf einen Verlust führen können. Silverman et al. (2000) verweisen auf Literatur, die nachweist, das es zu vermehrten Angst- und Depressionssymptomen, zu einer höheren Suizidrate und ganz allgemein zu erhöhter Mortalität kommt.
Um die Zusammenhänge zwischen der Diagnose Traumatic Grief, dem subjektiv empfundenen Gesundheitsstatus und dem Funktionieren in verschiedenen Bereichen (physisch, mental, sozial, Rollenverhalten, Schmerz, Energie, Entwicklung der Gesundheit im letzten Jahr, allgemeine Wahrnehmung der eigenen Gesundheit) zu explorieren, untersuchte die Forschergruppe um Silverman (2000) 67 verwitwete Personen. Die Diagnose Traumatic Grief war signifikant korreliert mit niedrigen sozialen Funktionswerten, mit schlechteren mentalen Gesundheitswerten und geringeren Energiewerten; die Diagnostizierten hatten also insgesamt unter einer höheren Qualität an Beeinträchtigungen zu leiden als die Nicht-Diagnostizierten, wobei einschränkend zu sagen ist, dass die gefundenen Zusammenhänge nicht als Kausalitäten zu interpretieren sind.
Weiter ist wichtig zu erwähnen, dass bisher angewendete Interventionen häufig nicht zum Erfolg führten, wie die Therapie mit trizyklischen Antidepressiva und Psychotherapie, die zwar die depressive Symptomatik lindern können, nicht aber trauerspezifische Symptome abschwächen (vgl. Glass, 2005). Einige Patienten durchlaufen sogar mehrere psychotherapeutische Interventionen ohne Erfolg (vgl. Shear, Frank, Foa, Cherry, Reynolds, Bilt & Masters, 2001). Nach der Analyse der Effekte herkömmlicher psychotherapeutischer Interventionen stellten Jacobs & Prigerson (2000) fest, dass Depressive davon in einem viel stärkeren Maß profitieren als Personen, bei denen Traumatic Grief diagnostiziert wurde.
Häufig wurde und wird die Ursache der Symptome auch verkannt: Viele Kliniker achten sehr auf Anzeichen einer Depression, Trauer steht in der Regel nicht im Fokus von Anamnese und Diagnostik (vgl. Glass, 2005). Wenn es aber eine eigenständige Störung Traumatic Grief oder Complicated Grief gibt, dann sollte es auch eine entsprechende psychotherapeutische Intervention geben.
Ich werde zwei unterschiedliche Ansätze vorstellen, mit denen den Trauernden geholfen werden soll: Die Hinterbliebenentherapie von J. William Worden (1999) basiert auf Annahmen der Psychodynamik und der Bindungstheorie, während das von Shear, Frank, Houck & Reynolds (2005) entwickelte „Treatment of Complicated Grief“ eine kognitive verhaltenstherapeutische Intervention darstellt, die entsprechend auf einem kognitiven Modell beruht. Die Effektivität sowohl psychodynamischer als auch kognitiv-verhaltenstherapeutischer Interventionen gilt als nachgewiesen (vgl. Jacobs & Prigerson, 2000).
3.1 Hinterbliebenentherapie nach Worden
Das Modell, das hinter den Annahmen Wordens steckt, basiert auf Freuds früher Arbeit. Dieser spricht von „Trauerarbeit“, die jeder Trauernde leisten muss und verweist damit auf die intrapsychischen Aktivitäten, die nötig sind, den Verlust anzunehmen und sich wieder dem Leben zuzuwenden (vgl. Freud, 1917). Für das Lösen der Bindung an den Verstorbenen wird Energie benötigt, diese ist irgendwann aufgebraucht. Die Bindung kann dann gelöst und die Realität des Verlusts akzeptiert werden. Dies war das primäre Modell im 20. Jahrhundert (vgl. Jacobs & Prigerson, 2000).
Das Ziel der Hinterbliebenentherapie wird von Worden folgendermaßen beschrieben: „Die Hinterbliebenentherapie soll die Trennungskonflikte identifizieren und lösen, die die Bewältigung von Traueraufgaben bei Personen verhindern, bei denen die Trauer ausbleibt, sich verzögert, übertrieben oder in die Länge gezogen wird“ (Worden, 1999, S.84). Worden geht also davon aus, dass jeder Trauernde Aufgaben bewältigen muss. Diese Aufgaben sind, den Verlust als Realität zu akzeptieren, den Trauerschmerz zu erfahren, sich anpassen an eine Umwelt, in der der Verstorbene fehlt und emotionale Energie vom Verstorbenen abzuziehen und in eine andere Beziehung zu investieren (vgl. Worden, 1999). Der gesamte Prozess wird hier als Trauerarbeit bezeichnet.
Ein Grund, warum dies nicht in einer normalen Form funktioniert, könnte laut Worden unterdrückter Zorn sein; Kast (1991) spricht von unterdrückten Aggressionen gegenüber dem Toten, die zu depressiv gefärbter Trauer führen können. Solche unterschwelligen Affekte und die daraus folgenden Konflikte, sollen in der Hinterbliebenentherapie gefunden und gelöst werden. Dazu werden in der Regel 8 bis 10 Sitzungen benötigt (vgl. Worden, 1999). Die Methoden sind das Ausdrücken von Gefühlen und die Konfrontation.
Bestandteile der Therapie:
1. Wenn der Trauernde körperliche Symptome hat, muss zuerst geklärt werden, ob eine physische Krankheit vorliegt.
2. Dann wird ein Vertrag gemacht, ein Bündnis geschlossen. Damit erklärt sich der Trauernde bereit, die Beziehung zum Verstorbenen zu explorieren.
3. Vor allem positive Erinnerungen an den dahingegangenen Menschen werden wiederbelebt, damit ein Ausgleich besteht für die negativen Affekte (Zorn, Aggression), die während der Therapie hervortreten können.
4. Der Therapeut muss einschätzen, welche der Traueraufgaben unerledigt ist. Dementsprechend werden die Interventionen gewählt.
5. Umgang mit erinnerungsstimulierendem Affekt oder Affektmangel: Tritt z.B. Zorn auf, so muss der Therapeut dem Betroffenen klarmachen, dass dieser zur Beziehung dazu gehört und die positiven Gefühle nicht auslöscht.
6. Verbindende Objekte explorieren und entschärfen: Kleidungsstücke des Verstorbenen, die der Trauernde aufbewahrt und von denen er sich nicht trennen will, wären z.B. ein solches Objekt.
7. Die Endgültigkeit des Verlusts muss anerkannt werden.
8. Eine weitere einfache Methode zur Therapie pathologischer Trauer ist es, den Trauernden darüber phantasieren zu lassen, wie es wäre, wenn die Trauer vorbei wäre.
9. Während der Therapie wird der Trauernde schrittweise ans endgültige Abschiednehmen herangeführt.
Worden führt in seinem Buch „Beratung und Therapie in Trauerfällen“ (1999) keine empirischen Nachweise an, dass diese Form der Therapie den Betroffenen hilft oder wie erfolgreich sie im Vergleich zu anderen Interventionen ist. Ändern die Trauernden ihr Verhalten, macht es ihnen beispielsweise neuerdings nichts mehr aus, das Schlafzimmer des Verstorbenen zu betreten, so ist dies als Therapieerfolg zu werten. Außerdem werden die Verbesserung des subjektiven Empfindens und die Linderung von Symptomen als Bewertungen für den Erfolg der Therapie vorgeschlagen. Diese Ergebnisvariablen werden aber nicht weiter operationalisiert.
3.2 Kognitive Verhaltenstherapie
Ganz abgesehen von den mangelnden empirischen Belegen für den Erfolg der Hinterbliebenentherapie gibt es Kritik an den theoretischen Annahmen, die dahinter stecken: So kritisieren Jacobs & Prigerson (2000), dass es bei der Anpassung an den Verlust nicht um die Loslösung vom Verstorbenen geht, sondern darum, wie dieser in das weitere Leben integriert werden kann. Also reichen auch das Ausdrücken von Affekten und Konfrontation als Therapietechniken wohl nicht aus. Ein Coping, das sich ausschließlich auf Konfrontation stützt, scheint sogar zu mehr Schmerzen zu führen; vielleicht ist ein gewisses Maß an Vermeidungsverhalten sinnvoll (vgl. Matthews & Marwit, 2004).
Stroebe & Schut haben ein kognitives Modell entwickelt, das den Prozess der Anpassung an einen Verlust beschreibt und die oben genannten Einwände mit einbezieht, das duale Prozessmodell adaptiven Copings (vgl. Matthews & Marwit, 2004): Es sind mehrere Prozesse, die beim Trauern simultan ablaufen. Manchmal konfrontiert sich der Trauernde mit den emotionalen und kognitiven Prozessen des Trauerns, manchmal meidet er sie. Zugleich werden verschiedene Coping-Strategien eingesetzt: Zum einen konzentriert der Trauernde sich auf Teile des Verlusts und arbeitet diesen damit durch, zum anderen muss er neue Herausforderungen wie die Reorganisation des Lebens oder Anpassung an eine neue Rolle meistern.
3.3 Complicated Grief Treatment
Shear, Frank, Houck & Reynolds (2005) haben auf der Basis des oben beschriebenen kognitiven Modells eine Intervention entwickelt, die sie Complicated Grief Treatment (im Folgenden CGT abgekürzt) nennen und die im Durchschnitt 16 Sitzungen dauert. Der Therapeut erklärt dabei das duale Prozessmodell adaptiven Copings und damit, dass die Trauer sich optimal entwickelt, wenn die Aufmerksamkeit zwischen Verlust und Reorganisation wechselt. Dementsprechend wird nicht nur über den Verlust, sondern auch über die persönlichen Lebensziele des Trauernden gesprochen. Die trauerspezifischen Symptome werden über Konfrontationsübungen angesprochen: Der Trauernde erzählt mit geschlossenen Augen die Geschichte des Todes, als passiere dieser jetzt. Davon wird eine Audioaufnahme gemacht, die der Trauernde sich auch zuhause anhören muss. Außerdem soll er in den Sitzungen mit geschlossenen Augen mit dem Verstorbenen sprechen, so als könnte dieser ihn hören und dann selbst die Rolle des Verstorbenen übernehmen und antworten; so kann ein Gefühl von Verbundenheit geschaffen werden.
Was die Reorganisation betrifft, so kann der Therapeut wie in der Hinterbliebenentherapie Wordens fragen, was der Trauernde sich wünschen würde, wäre die Trauer nicht mehr so stark. Mit dieser Technik können Lebensziele erkannt werden, an deren Umsetzung in der Therapie gearbeitet wird.
Um den Effekt der beschriebenen Intervention zu testen, haben Shear et al. (2005) eine randomisierte, klinische Studie durchgeführt, wobei der Erfolg von CGT mit herkömmlicher Interpersonaler Psychotherapie (IPT) verglichen wurde. Potentielle Teilnehmer mussten einen Score von mindestens 30 im Inventory of Complicated Grief aufweisen, der sich, damit die Therapie als Erfolg gelten kann, um mindestens 20 Punkte bessern muss, was zwei Standardabweichungen entspricht. Außerdem schätzten unabhängige Kliniker die Teilnehmer vorher und nachher mit der Clinical Global Improvement Scale ein. Hier wurde eine „sehr starke“ (very much improved) oder eine „starke“ (much improved) Verbesserung als Erfolg gewertet.
Ergebnisse: Eine objektiv als Erfolg eingeschätzte Verbesserung konnten 51% der CGT-Teilnehmer, aber nur 28% der IPT-Teilnehmer erreichen. Auch in der subjektiven Einschätzung verbesserten sich die Teilnehmer der trauerspezifischen Intervention auf jeder verwendeten Skala mehr als die Vergleichsgruppe. Interessanterweise wurde die Tendenz gefunden, dass die zusätzliche Einnahme von Antidepressiva den Erfolg noch weiter verbessert, was aber noch weiter untersucht werden müsste (vgl. Shear et al., 2005). Außerdem ist der Erfolg für Eltern, die ein Kind verloren haben mit 17% sehr gering.
Die Autoren bewerten die Ergebnisse prinzipiell als positiv. Auch wenn nur 51% auf die Therapie ansprechen, so wirkt sie jedenfalls besser als herkömmliche Psychotherapie. Eine von mehreren Einschränkungen, die die Autoren anführen ist die Heterogenität der Stichprobe, wodurch Subgruppen die Ergebnisse stärker beeinflussen als dies in der Gesamtpopulation der Fall ist (die Eltern, deren Kind gestorben ist). Außerdem sind 12% der Teilnehmer mit der Begründung aus der Complicated Grief-Therapie ausstiegen, sie sei zu schwierig. 10% der Teilnehmer wollten nicht alle Übungen mitmachen. Besonders die Konfrontationsübungen führten zu Widerstand.
Die Forschung ist hier sicher erst am Anfang. Glass (2005) schlägt beispielsweise nach seiner Bewertung der in dieser Untersuchung gefundenen Effekte vor, einmal zu untersuchen, ob eine längere Therapiedauer zu besseren Ergebnissen führt. Außerdem fragt er sich, wie gut CGT in der Praxis funktionieren kann, da die Anforderung an den Therapeuten dabei sehr hoch sind.
Ausblick
Den beschriebenen psychodynamischen Ansätzen fehlt häufig die empirische Grundlage, und bei entsprechender Evaluation können die theoretischen Annahmen oftmals nicht bestätigt werden (s. die Untersuchung der Annahmen Wordens). Von daher möchte ich mich im Ausblick auf die Forschung beschränken, die „festen Boden unter den Füßen hat“ und in die im Rahmen dieser Arbeit nur ein kleiner Einblick gegeben werden konnte.
Die meisten Trauerforscher sind sich mittlerweile einig, dass es eine psychische Störung Complicated oder Traumatic Grief gibt, die sich von normaler Trauer auf der einen und von anderen psychischen Störungen auf der anderen Seite unterschiedet. Sie haben dies mit den Ergebnissen systematischer Datenanalyse untermauern können.
Die Verwendung von zwei verschiedenen Begriffen für ein und dieselbe Störung ist natürlich störend, auch wenn die Argumente sowohl für den einen als auch für den anderen Begriff einleuchten. Außerdem herrscht weiter Unklarheit, wie und wo die Störung in den bestehenden Klassifikationssystemen untergebracht werden kann und über eine genaue Definition. Diese ist wiederum von der grundlegenden Konzeption pathologischer Trauer abhängig, wie von Stroebe et al. (2000) ausführlich beschreiben wird. Die von mir vorgestellten Ansätze – Konzeption nach Typologien (Worden) und Konzeption mittels Abgrenzung zu anderen psychischen Störungen (Prigerson et al., Horowitz et al.) – sind auch nur zwei von vielen Möglichkeiten, wie Trauerforschung aussehen kann.
Was die beiden Kriteriensets zur Diagnosestellung betrifft, so können diese eine solide Basis für weitere Forschung in dieser Richtung sein, obwohl es bedeutende Unterschiede zwischen beiden gibt. Die beiden Kriterien Dauer und Intensität sind bisher noch gar nicht untersucht worden, was vielleicht am meisten stört. Besonders eine Festlegung der Zeitkomponente dürfte sich aber auch schwierig gestalten, da für die Einschätzung der „normalen“ Trauerzeit interindividuelle und interkulturelle Unterschiede berücksichtigt werden müssen.
Als ein Verdienst der Trauerforschung gilt die Entdeckung der Tatsache, dass herkömmliche psychotherapeutische Maßnahmen und die Behandlung mit Antidepressiva bei pathologischer Trauer nicht erfolgreich sind. Was das von Shear et al. (2005) speziell für pathologisch Trauernde entwickelte Treatment of Complicated Grief angeht, so ist die Erfolgsquote aber auch nicht so hoch wie erwartet und gewünscht. Erstaunlicherweise zeigt sich auch die Tendenz eines besseren Therapieeffekts, wenn die Teilnehmer zusätzlich mit Antidepressiva behandelt werden. Der Bedarf an weiterer Forschung ist hier wahrscheinlich am größten. Bisher gibt es meines Wissens nach aber noch keine anderen Interventionsformen, die untersucht worden sind.
Der positive Effekt des Treatments of Complicated Grief ist wohl höher einzuschätzen als in der Studie von Shear et al. (2005) gezeigt. Weil die Intervention den Eltern, die ein Kind verloren haben, nicht besonders gut hilft, verzerrt dieser Teil der Stichprobe die Ergebnisse. Auch die Kritik von Hogan et al. (2004) an der modernen Trauerforschung gründet sich auf Daten, die an einer Stichprobe von trauernden Eltern gewonnen wurden. Vielleicht gibt es hier also Zusammenhänge, die bisher noch keiner versucht hat zu klären.
Eine letzte interessante Frage, die einige Forscher bisher auch nur am Rande beschäftigt hat, ist die Frage nach Determinanten und Prädiktoren pathologischer Trauer. Worden (1999) hat einige Ideen dazu, doch fehlt wieder die empirische Grundlage, die prospektive oder auch retrospektive Studien bieten könnten. Horowitz et al. (1997) vermuten, dass eine depressive Erkrankung in der Vorgeschichte eine pathologische Trauerreaktion begünstigt. Dies könnte vielleicht die Zusammenhänge zwischen beiden Störungen erklären, ist aber noch nicht weiter untersucht worden. Ansonsten habe ich in der gesichteten Literatur keine konkreteren Vermutungen dazu gefunden, warum es gerade bei Herrn Müller zu pathologischer Trauer kommt und bei Herrn Meier nicht. Mit der nahe liegenden Vermutung, dass ein im besonderen Maße belastender Todesfall (Suizid, Mord, Unfall…) mit größerer Wahrscheinlichkeit zu einer Trauerstörung führt, wird vorsichtig umgegangen, wahrscheinlich, weil ansonsten die Abgrenzung zur Posttraumatischen Belastungsstörung schwierig würde.
Literaturverzeichnis
BOELEN, P.A./ VAN DEN BOUT, J./ DE KEIJSER, J. (2003): Traumatic Grief As A Disorder Distinct From Bereavement-Related Depression And Anxiety: A Replication Study With Bereaved Mental Health Care Patients. In: American Journal Of Psychiatry, Jg. 2003, Vol. 160, S. 1339-1341
COMER, R.J. (2001): Klinische Psychologie. Heidelberg/Berlin, 2. Deutsche Auflage
DILLING, H./ MOMBOUR, W./ SCHMIDT, M.H. (Hg.) (1991): Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F). Klinisch-diagnostische Leitlinien. Bern/ Göttingen/ Toronto
ENRIGHT, B.P./ MARWIT, S.J. (2002): Diagnosing Complicated Grief: A Closer Look. In: Journal of Clinical Psychology, Jg. 2002, Vol. 58, S. 747-757
FREUD, S. (1917): Trauer und Melancholie. In: Sigmund Freud. Studienausgabe. Band III. Psychologie des Unbewußten. Frankfurt a.M.. Limitierte Sonderausgabe, S. 193-213
GLASS, R.M. (2005): Is Grief A Disease? Sometimes. In: The Journal of the American Medical Association, Jg. 2005, Vol. 293, S. 2658-2660
HOGAN, N.S./ WORDEN, J.W./ SCHMIDT, L.A. (2004): An Empirical Study Of The Proposed Complicated Grief Disorder Criteria. In: Omega, Jg. 2004, Vol. 48, S. 263-277
HOROWITZ, M.J./ SIEGEL, B./ HOLEN, A./ BONANNO, G.A./ MILBRATH, C./ STINSON, C.H. (1997): Diagnostic Criteria For Complicated Grief Disorder. In: The American Journal Of Psychiatry, Jg. 1997, Vol. 154, S. 904-910
JACOBS, S./ MAZURE, C./ PRIGERSON, H. (2000): Diagnostic Criteria For Traumatic Grief. In: Death Studies, Jg. 2000, Vol. 24, S. 185-199
JACOBS, S./ PRIGERSON, H. (2000): Psychotherapy Of Traumatic Grief: A Review Of Evidence For Psychotherapeutic Treatments. In: Death Studies, Jg. 2000, Vol. 24, S. 479-495
KAST, V. (1991): Trauern. Phasen und Chancen des psychischen Prozesses. Stuttgart, 12. Auflage
MATTHEWS, L.T./ MARWIT, S.J. (2004): Complicated Grief And The Trend Toward Cognitive-Behavioral Therapy. In: Death Studies, Jg. 2004, Vol. 28, S. 849-863
PRIGERSON, H.G./ BIERHALS, A.J./ KASL, S.V./ REYNOLDS, C.F./ SHEAR, M.K./ NEWSOM, J.T./ JACOBS, S. (1996): Complicated Grief As A Disorder Distinct From Bereavement-Related Depression And Anxiety: A Replication Study. In: The American Journal Of Psychiatry, Jg. 1996, Vol. 153, S. 1484-1486
RINGOLD, S. (2005): Grief. In: Journal Of The American Medical Association, Jg. 2005, Vol. 293, Nr. 21, S. 2686
SASS, H./ WITTCHEN, H.-U./ ZAUDIG, M./ HOUBEN, I. (1998): Diagnostische Kriterien des Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen DSM IV. Deutsche Bearbeitung. Göttingen/ Bern/ Toronto/ Seattle
SCHNEIDER, W./ FREYBERGER, H.J./ MUHS, A./ SCHÜßLER, G. (Hg.) (1993): Diagnostik und Klassifikation nach ICD-10 Kap. V. Eine kritische Auseinandersetzung. Göttingen/Zürich
SHEAR, K./ FRANK, E./ FOA, E./ CHERRY, C./ REYNOLDS, C.F./ VANDER BILT, J./ MASTERS, S. (2001): Traumatic Grief Treatment. A Pilot Study. In: American Journal Of Psychiatry, Jg. 2001, Vol. 158, S. 1506-1508
SHEAR, K./ FRANK, E./ HOUCK, P.R./ REYNOLDS, C.F. (2005): Treatment Of Complicated Grief. A Randomised Controlled Trial. In: The Journal of the American Medical Association, Jg.2005, Vol. 293, S. 2601-2608
SILVERMAN, G.K./ JACOBS, S.C./ KASL, S.V./ SHEAR, M.K./ MACIEJEWSKI, P.K./ NOAGHIUL, F.S./ PRIGERSON, H.G. (2000): Quality Of Life Impairments Associated With Diagnostic Criteria For Traumatic Grief. In: Psychological Medicine, Jg. 2000, Vol.30, S. 857-862
TOMITA, T./ KITAMURA, T. (2002): Clinical And Research Measures Of Grief: A Reconsideration. In: Comprehensive Psychiatry, Jg. 2002, Vol. 43, Nr. 2., S. 95-102
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema der Arbeit über pathologische Trauer?
Die Arbeit befasst sich mit Forschungsergebnissen zu pathologischen Trauerreaktionen, wobei sowohl Erkenntnisse der modernen Trauerforschung als auch psychodynamisch/psychoanalytisch orientierte Ansätze betrachtet werden. Sie gibt einen Einblick in die Thematik und wirft möglicherweise mehr Fragen auf, als sie beantwortet.
Wie wird eine normale Trauerreaktion definiert?
Trauer wird als die emotionale und physische Antwort auf den Tod eines geliebten Menschen definiert, verbunden mit einer Bandbreite an Emotionen wie Traurigkeit, Wut, Verzweiflung und Schuldgefühlen. Normalerweise nimmt die Intensität dieser Symptome mit der Zeit ab.
Was ist pathologische Trauer?
Pathologische Trauer bezieht sich auf Trauerreaktionen, bei denen die Betroffenen so stark leiden, dass sie ihren Alltag nicht mehr ohne Hilfe bewältigen können. Die Symptome dauern besonders lange an und sind besonders intensiv. Kennzeichnend kann sein, dass der Trauernde den Verlust nicht akzeptieren kann oder ständig an den Tod oder den Verstorbenen denken muss.
Welche Konzepte von pathologischer Trauer werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die auf psychodynamischen Annahmen beruhende Konzeption von J. W. Worden sowie die Abgrenzung pathologischer Trauer von anderen Störungen mit ähnlicher Symptomatik, wie sie in der modernen Trauerforschung der letzten zehn Jahre nachgewiesen wurde.
Welche Kriteriensets zur Diagnose pathologischer Trauer werden vorgestellt?
Es werden zwei verschiedene Kriteriensets vorgestellt, mit denen pathologische Trauer diagnostiziert werden kann: die Diagnosekriterien nach Horowitz et al. und die Diagnosekriterien nach Prigerson et al. Im Rahmen dessen werden auch die Symptome näher beschrieben, die diese Störung kennzeichnen.
Welche psychotherapeutischen Interventionen bei pathologischer Trauer werden behandelt?
Es werden eine psychodynamisch orientierte Intervention (Hinterbliebenentherapie nach Worden) und eine kognitiv-verhaltenstherapeutische Intervention (Traumatic Grief Treatment) vorgestellt.
Was sind die vier Formen pathologischer Trauer nach Worden?
Worden beschreibt vier Formen komplizierter Trauerreaktionen: chronische Trauerreaktionen, verzögerte Trauerreaktionen, übertriebene Trauerreaktionen und larvierte Trauerreaktionen.
Was ist Complicated Grief/Traumatic Grief Disorder?
Complicated Grief/Traumatic Grief Disorder beschreibt ein bestimmtes Cluster von Symptomen, das sich von Depression und Angststörungen unterscheidet und als eigenständige klinische Entität betrachtet wird. Es ist eine pathologische Form von Trauer.
Welche Messinstrumente werden zur Messung von Trauerreaktionen erwähnt?
Es werden verschiedene Messinstrumente erwähnt, darunter der Texas Inventory of Grief, der Grief Experience Inventory, die Grief Measurement Scales, die Hogan Grief Reaction Checklist und der Inventory of Complicated Grief (ICG).
Was ist die Hinterbliebenentherapie nach Worden?
Die Hinterbliebenentherapie nach Worden basiert auf Annahmen der Psychodynamik und der Bindungstheorie und zielt darauf ab, Trennungskonflikte zu identifizieren und zu lösen, die die Bewältigung von Traueraufgaben verhindern.
Was ist Complicated Grief Treatment (CGT)?
Complicated Grief Treatment (CGT) ist eine kognitive verhaltenstherapeutische Intervention, die auf einem dualen Prozessmodell adaptiven Copings basiert und sowohl Konfrontationsübungen als auch die Reorganisation des Lebens des Trauernden umfasst.
Wie effektiv ist Complicated Grief Treatment (CGT)?
Eine randomisierte, klinische Studie hat gezeigt, dass Complicated Grief Treatment (CGT) effektiver ist als herkömmliche Interpersonelle Psychotherapie (IPT) bei der Behandlung von pathologischer Trauer.
Was sind einige offene Fragen in der Trauerforschung?
Offene Fragen in der Trauerforschung sind unter anderem die genaue Definition und Klassifizierung der Störung, die Festlegung der Zeitkomponente für die Einschätzung der "normalen" Trauerzeit und die Identifizierung von Determinanten und Prädiktoren pathologischer Trauer.
- Quote paper
- Oliver Lauxen (Author), 2005, Pathologische Trauer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109692