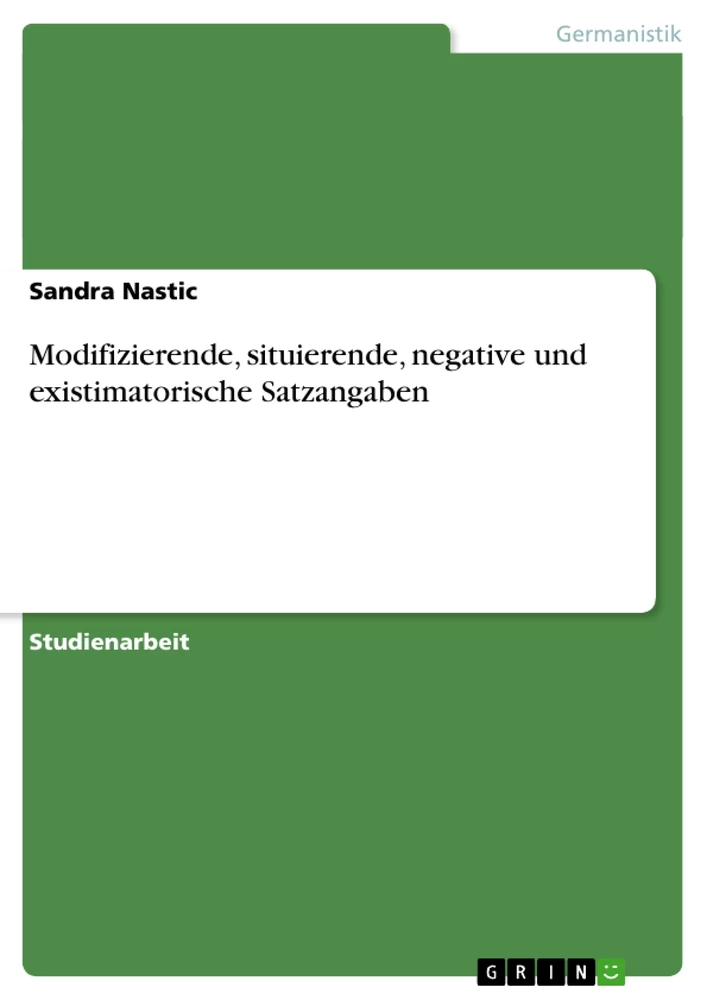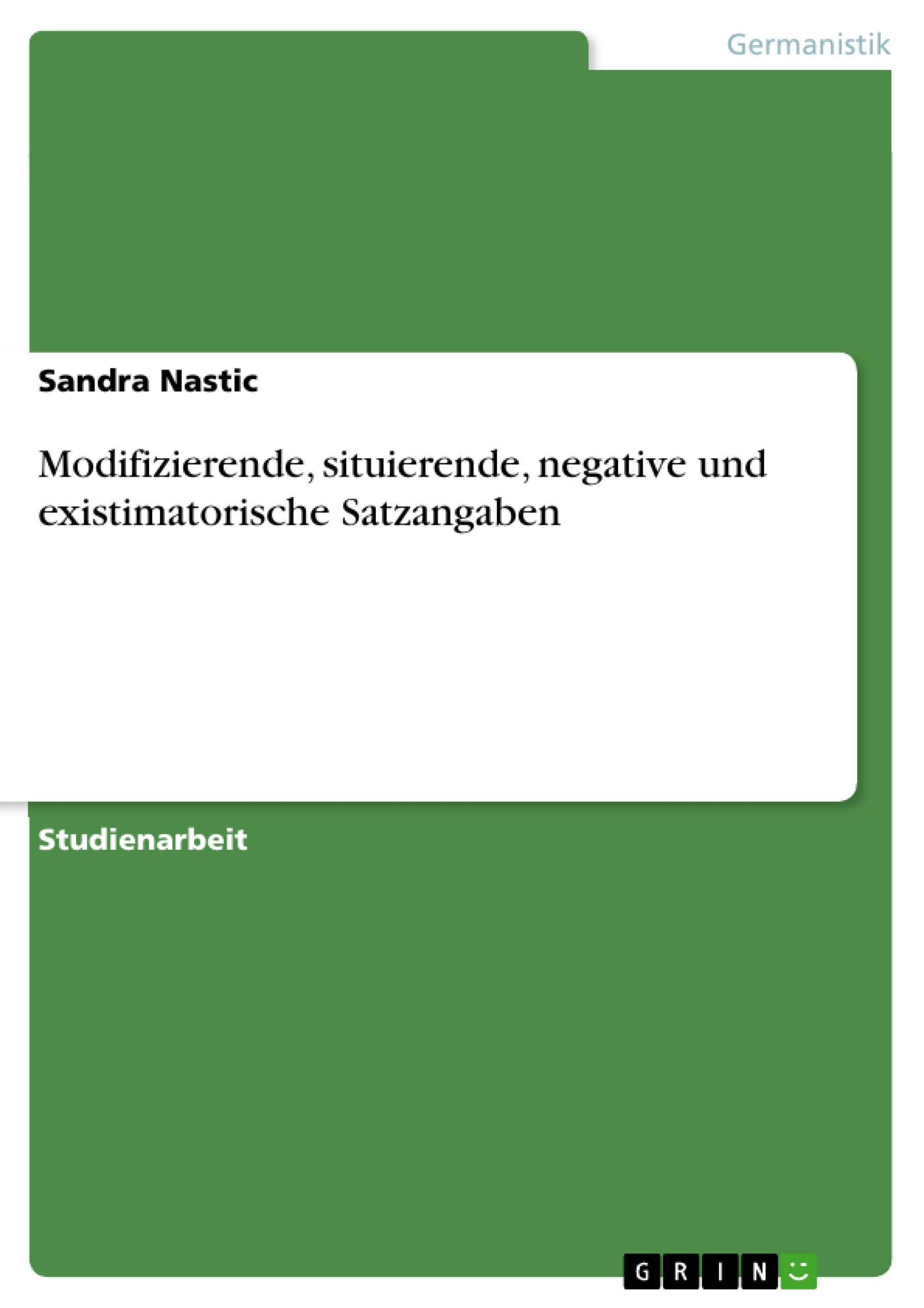Was sind die unsichtbaren Fäden, die unsere Sätze zusammenhalten, und wie formen sie unsere Kommunikation? Tauchen Sie ein in eine faszinierende Analyse der deutschen Grammatik, die sich den oft übersehenen, aber entscheidenden Satzangaben widmet. Diese tiefgründige Untersuchung enthüllt die vielfältigen Rollen, die Angaben in unserer Sprache spielen, von der Modifizierung von Verben bis hin zur Kontextualisierung ganzer Sätze. Entdecken Sie die vier Hauptkategorien – modifizierende, situierende, negative und existimatorische Angaben – und ihre zahlreichen Unterklassen, die jeweils fein abgestimmte Nuancen in unsere sprachlichen Äußerungen einbringen. Erforschen Sie, wie Temporalangaben unseren Sätzen eine zeitliche Dimension verleihen, Lokalangaben den Raum definieren und Kausalangaben die Gründe für Handlungen offenbaren. Lassen Sie sich von der subtilen Kunst der Konditional-, Konsekutiv-, Konzessiv- und Finalangaben verzaubern, die unseren Sätzen eine zusätzliche Ebene der Komplexität verleihen. Untersuchen Sie, wie Instrumental-, Restriktiv- und Komitativangaben unsere Aussagen präzisieren und verfeinern. Diese umfassende Analyse bietet nicht nur ein tiefes Verständnis der deutschen Syntax, sondern auch eine neue Perspektive auf die Art und Weise, wie wir denken und kommunizieren. Von der Negation von Sachverhalten durch negative Angaben bis zur subjektiven Einschätzung des Sprechers durch existimatorische Angaben, dieses Buch ist ein unverzichtbarer Leitfaden für alle, die ihre Sprachkenntnisse vertiefen und die feinen Unterschiede der deutschen Sprache meistern möchten. Tauchen Sie ein in die Welt der Kautiv-, Selektiv-, Ordinativ-, Judikativ- und Verifikativangaben, entdecken Sie die Macht der Abtönungspartikel und verstehen Sie die ironische Verwendung des Dativus Ethicus. Egal, ob Sie Sprachwissenschaftler, Student oder einfach nur ein Liebhaber der deutschen Sprache sind, diese detaillierte Analyse wird Ihnen neue Einblicke und ein tieferes Verständnis für die komplexen Mechanismen der deutschen Grammatik vermitteln und Ihnen helfen, Ihre kommunikativen Fähigkeiten auf ein neues Level zu heben, indem Sie die feinen Unterschiede und subtilen Nuancen der Satzangaben verstehen und gekonnt einsetzen. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihr Wissen zu erweitern und Ihre sprachliche Kompetenz zu perfektionieren – eine lohnende Investition für jeden, der die deutsche Sprache wirklich verstehen will. Die präzisen Definitionen, klaren Beispiele und die umfassende Darstellung machen dieses Werk zu einem wertvollen Nachschlagewerk und einem unverzichtbaren Begleiter für jeden, der sich intensiv mit der deutschen Sprache auseinandersetzt.
INHALTSVERZEICHNIS
Einleiting
(1)Modifizierende Angaben
(2)Situierende Angaben
1. TEMPORALANGABEN
2. LOKALANGABEN
3. KAUSALANGABEN
4. KODITIONALANGABEN
5. KONSEKUTIVANGABEN
6. KONZESSIVANGEBN
7. FINALANGEBEN
8. INSTRUMENTALANGABEN
9. RESTRIKTIVANGABEN
10. KOMITATIVE ANGABEN
(3)Negative Angaben
(4)Existimatorische Angaben
1. KAUTIVE ANGABEN
2. SELEKTIVE ANGABEN
3. ORDINATIVE ANGABEN
4. JUDIKATIVE ANGABEN
5. VERIFIKATIVE ANGABEN
6. ABTÖNUNGSPARTIKEL
7. DATIVUS ETHICUS
Literaturverzeichnis
Es ist schon ein viertel Jahrhundert vergangen, seitdem man versuchte, Ergänzungen und Angaben zu definieren , aber bis heute ist man noch zu keinem einstimmigen wissenschaftlichen Ergebnis gekommen. Die Termini Ergänzungen und Angaben gibt es schon sehr lange. Angaben sind jedoch im Gegensatz zu den Ergänzungen , nach Meinungen der Grammatikern , älter. Auch muss man ins Auge fassen, das von Grammatiker zu Grammatiker Angaben anders genannt werden: Tesnier nannte sie Circonstant also Umstände ,Helbig nennt sie freie Angaben und Engel wiederum nennt sie Satzangaben , doch trotz der verschiedenen Termini beziehen sich alle auf die Grundbedeutung der Angaben. Sie ist unveränderbar ! Was die Details angeht, so können diese verschieden aufgefasst werden , so dass es zu Unstimmigkeiten kommen kann.
Was mein Thema angeht , so basiert das auf der Grundbedeutung , das gleichzeitig die Basis für meine Seminararbeit ist.
GRUNDBEDEUTUNG: Satzangaben sind nicht valenzbedingt , das heißt, dass jeder Satz oder satzartiges Konstrukt durch Elemente erweitert werden kann, dass nicht vom Verb ausgewählt worden ist. Das heißt also, das Satzangaben frei hinzufügbar sind , also immer fakultativ. Sie beziehen sich, wie Tesnier schon hingewiesen hat , auf einen Umstand, also innerhalb von Zeit, Raum , Ort und etc.
Was die Elemente angeht , die hinzugefügt werden können . Sie treten in verschiedenen Formen auf. Zum Beispiel in Form von: Adverbien, Adjektiven, Präpositionalphrasen, Nebensätzen u.s.w..
Je nach dem , um welchen Beziehungsbereich es sich handelt , denn nicht alle Angaben können alle diese Formen nutzen.
Engel hatte zunächst eine Aufteilung in sechs Klassen von Angaben: (Cirkumstanten-der Terminus wurde in freier Anlehnung an Tesnier gewählt, Valuativa, Existimatoria, Modifikativa, Negationsangaben, adjung- tierte Adverbiale)[1]. Diese Aufteilung wurde von Engel später auf vier reduziert . Ich lehne an die Neuere an , da sie übersichtlicher ist.
Die Klassifizierung an sich wurde nach der Gruppierung der zusammengehörigen Sachverhalte durchgenommen.
Diese vier Klassen der Angaben werden wiederum in Subklassen eingeteilt.
Die vier Großklassen von Angaben sind folgende:
(1) verbbezogene oder modifizierende (modifikative) Angaben
(2) satzbezogene oder situierende (situative) Angaben
(3) negative Angaben
(4) äußerungabezogene oder existimatorische Angaben [2]
(1)Modifizierende Angaben
Diese Angaben beziehen sich immer auf das Hauptverb. Deshalb stehen sie meistens nahe dem Hauptverb, außer sie müssen etwas unterstreichen oder hervorheben , dann stehen sie am Satzanfang. Sie modifizieren teilweise den genannten Sachverhalt und teilweise den durch das Verb bescriebenen Vorgang.
Ausdrucksformen sind:
a) Adverb
Schumi hat sich in diesem Punkt extrem gewandelt.[3]
b) Präpositonalphrase
Alles in meinem Leben habe ich mit großem Eifer getan.[4]
c) wie-Phrase
Er variierte nicht seinen Gruß, bevor er ging , er trat wie immer auf den dämmrigen Flur, rief gegen die geschlossene Türen...[5]
d) Als ob-Sätze
Alle liefen davon , als ob sie der Teufel verfolgt hätte.[6]
(2) Situierende Angaben
Diese Klasse von Angaben wird als die Umpfangreichste beschrieben. Sie hat zur Aufgabe, innerhalb des Satzes verschiedene Sachverhalte zu beschreiben, also Sachverhalte in verschiedenartige Zusammenhänge einzuordnen.
Man unterscheidet folgende Unterklassen der situierenden Angaben: temporale,lokale, kausale, konditionale,konsekutive,konzessive,finale,in-strumentale,restriktive und komitative Angaben. Es sind insgesamt zehn.
(1)Temporalangaben
Diese Art von Angaben beschreibt einen Sachverhalt in der Zeit. Temporalangaben können apsolut sein, das bedeutet dass sie in ihrem Auftreten genaue Angaben über das Datum, den Monat und das Jahr geben. Benutzt werden sie auch in verschiedenen Sprechsituationen und literarischen Texten wo sie sich meist auf etwas Vorheriges beziehen.
(z.B. damals , gestern, letztens u.s.w.)
Temporalangaben können im Satz gedeutet werden, indem wir sie erfragen mit wann, seit wann oder bis wann. Innerhalb des Satzes haben sie keine gefässtigte Position und können deshalb am Ende, in der Mitte oder am Anfang stehen.
Z.B.
(a) Nachts kannst du ruhig nach Hause gehen.[7]
(b) Im Jahre 1933 machte er den großen Rausch nicht mit , setzte sich gegen die Hillerleute zur Wehr, wurde verhaftet und vermutlich schmachvoll behandelt , denn nach der Entlassung erlitt er einen Nervenzusammenbruch und wurde kurzerhand in eine Irrenanstalt gesteckt.[8]
(c) Gegen Mittag war alles geregelt.[9]
(2) Lokalangaben
Die Lokalangaben beschreiben einen Sachverhalt innerhalb des Raumes. Auch die Lokalangaben können apsolut sein, wenn sie exakt einen Raum beschreiben. Genutzt werden sie in verschiedenen Sprechdsituationen und Texten. Hierbei müssen sie nicht den exakten Raum beschreiben, sondern können darauf deuten. (z.B. dort drüben, auf der anderen Hälfte u.s.w.) Lokalangaben deuten wir durch die Erfragung mit wo.
Beispiele:
(a) Oft ertappe ich mich dabei, daß ich neidisch die Kaninchen betrachte die es sich unter dem Tisch gemütlich machen und seelenruhig an Mohrrüben herumknabbern und der stupide Blick des Nilpferd, das in der Badewanne die Schlammbildung beschleunigt, veranlaßt mich, ihm manchmal die Zunge herauszustrecken.[10]
(b) Dort blieb sie stehen und spähte in eine mächtige Baumkrone, die mit Absicht oder durch ein Unwetter, vom Stamm gerissen war.[11]
Lokalangaben sind nicht positioniert und deshalb sind sie verschiebbar.
(3) Kausalangaben
Diese Klasse von situierenden Angaben charakterisieren einen Sachverhalt, indem sie ihm einen Grund oder eine Ursache beschreiben, als dessen Folge oder Auswirkung. Erfragt werden Kausalangaben mit warum ,weshalb, wieso, aus welchelm Grund. Sie können apsolut sein wenn sie den Sachverhalt präzise beschreiben. (z.B.Weil draußen die Temperatren unter null grad liege fällt Schnee und nicht Regen.) Die Position der Kausalangaben ist nicht fest festgelegt also sind sie verschiebbar.
Beispiele:
(a) Aus diesem Grund zählen wir solche Sätze nicht zu den konsekutiven Angabesätzen , sondern zu den Attributsätzen.[12]
(b) Einige Wörter gab es auch , die man besser nicht verwendet, weil sie im Grunde nichts besagen, Wörter wie„ gut ” und „ schlecht ”, „ schön ” u.s.w.[13]
(4) Konditionalangaben
Die Konditionalangaben beschreiben im Satz den Sachverhalt einer Bedingung. Erfragt werden sie, durch unter welchen Bedingungen und durch wann. Sie sind verschiebbar. Sie können auch absolut sein wenn sie eine Bedingung präzise umschreiben. Auch können Konditionalangaben sich auf einen im Text vorangegangenen Sachverhalt beziehen.
Beispiel:
(a) Sie hatten eine sehr große Wohnstube auf Bleckenwarf, einen nicht allzu hohen aber breiten und vielfenstrigen Raum, in dem mindestens neunhundert Hochzeitsgäste Platz gehabt hätten, und wenn nicht die, dann aber doch sieben Schulklassen einschließlich ihrer Lehrer, und trotz der ausschweifenden Möbel, die dort herumstanden mit ihrer hochmütigen Raumverdrängung.[14]
(b) Gewiß dachte er zuweilen an seine Gattin , wenn er nicht einfach zu müde war, und hätte ihr wohl auch geschrieben, doch schreiben war nicht erlaubt.[15]
(5) Konsekutivangaben
Die Konsekutivangaben sind schwer definierbar. Sie beschreiben im Satz einen Sachverhalt, dessen Folge im Satz weitergeführt wird. Gerade weil sie eine Folge beschreiben, stehen sie niemals am Anfang eines Satzes und sehr selten beziehen sie die Mittelstellung. Ihre Position liegt fast immer am Ende des Satzes.
Die Erfragung nach den Konsekutivangaben ist umständlich.
Beispiel:
(a) Freilich, im noch tieferen Grund war ich vergnügt, und darum hab ich bereits zwischen den Büschen im Vorgarten auf ihn gewartet, so daß es uns, kaum daß er aus dem Haus war, ohne Verzug, ohne ein einziges Wort blitzgleich in den Kuß gestürzt hat. [16]
(b) Damit nimmt er meine Hände und küßt sie, aber Handwurzel und nicht dort, wo sie rot sind, und da hab ich gewußt, wieviels geschlagen hat, so daß ich nur noch `Fahr los` sagen hab können, sonst hätt ich zu sehr geweint. [17]
(c) Der alte Mann lag auf einem schmalen Holzbrett unter vielen Decken , aber die Fenster standen offen, so daß es kalt war.
(6) Konzessivangaben
Die Konzessivangaben beschreiben einen unzureichenden Gegengrund, das er eine Situation oder Geschehnis verhindern soll, dem aber nicht gewachsen ist und deshalb scheitert.
Sie sind verschiebbar ,jedoch nicht leicht erfragbar. Unterscheidungscharakter und zugleich Deutungsmerkmale sind Subjunktoren ,wie z.B. obwohl, auch wenn, wenn auch, u.s.w.
Beispiele:
(a) Sich au seinen Decken und Fellen herausarbeitend, stieg er vom Schlitten, und den Arm auf den gestützt, ging er trotz der Warnung des Kutschers vor der Kälte, zu der Stelle zurück, wo das Huhn lag.[18]
(b) Selbst die Lust, die ich genossen hab, ist ein Raum ohne Wetter geworden, obwohl mir die Dankbarkeit für das Lebendige geblieben ist, es schwinden mir die Namen und die Gesichtszüge, die mir ernstens Lust und sogar Liebe bedeutet haben, mehr und mehr daran, schwinden in eine Glasdankbarkeit hinein, die keinen Inhalt mehr hat.[19]
(c) Totzdem vertrug er es nicht, immer befragt zu werden, wo er gewesen wäre.[20]
(7) Finalangaben
Die Finalangaben geben den Sachverhalt eines Ziels oder Zwecks an. Verschiebungen sind möglich. Sie werden erfragt mit wozu, wofür und zu welchem zweck.
Beispiele:
(a) Die Wissenschaft durchforschte das Universum, alles, was es auf Erden gab, Pflanzen, Tiere, Boden, Wasser, Luft, damit mehr Nutzen daraus gezogen werden konnte. [21]
(b) Mein Herz und mein Sinn waren von Kindheit an für das zarte Gefühl des Wohlwollens; selbst große Handlung zu verrichten, dazu war ich immer aufgelegt.[22]
(8) Instrumentalangaben
Sie räprensentieren das Instrument, das notwendig ist, um ein Ziel zu erreichen. Verschiebungen sind möglich. Und erfragt werden Instrumentalangeben durch womit, wodurch.
Beispiele:
(a)Und damit,wackelte sie weiter, eilends, damit sie nicht die Grabrede versäume.[23]
(c) Die Nacht verlief gut, dank der medikamentösen Behandlung, mit der ich gestern mein Rhintis ziemlich rigoros bekämpft habe, bin ich nur zwei mal aufgewacht.[24]
(9) Restriktivangaben
Diese Klasse von situativen Angaben beschreibt eine Einschränkung der Bedingung einer Situation, innerhalb eines geschlossenen Geltungsrahmens. In diesem Rahmen legt sich der Sachverhalt fest. Gewöhnlich sind Restriktivangaben betont und deshalb findet man sie immer am Satzanfang. Erfragt werden sie durch in welcher Hinsicht, inwiefern. Sie können aber auch verschoben werden.
Beispiele:
(a) Was mein Fach betrifft, ist diese Methode die wichtigste Sache in diesem Experiment.[25]
(b) Hinsichtlich seiner Arbeit, war er der erfolgreichste Student seines Jahrgangs.[26]
(c) Gesundheitsmäßig musste er was unternehmen.[27]
(10) Komitative Angaben
Diese Unterklasse von situativen Angaben nennen innerhalb eines Sachverhalts einen fehlenden oder einen gegenwärtigen Umstand. Sie sind verschiebbar. Was bei der Befragung charakteristisch ist, ist dass sie nur erfragt werden können wenn eine Person der begleitende Umstand ist . Und zwar mit wem. Bei anderen, also leblosen Begleitumständen ist die Erfragung nicht möglich.
Beispiele:
(a) Als sie fertig war nahm sie ihn bei der Hand und ging resulut mit ihm zur Tür hinaus.[28]
(b) Der Junge folgte ihm eifrig mit der Kiste.[29]
(3) NEGATIVE ANGABEN
Negative Angaben negieren Sachverhältnisse, und stehen im Satz hinter und vor dem verbbezogenen Angaben. Zuerst haben wir die Negation NICHT, aber auch seine Konkurenyformen: KEINESFALLS, KEINESWEGS , verstärkte Formen: DURCHAUS NICHT und Negationsangaben mit situativer Komponente: NIERGENDS, NIEMALS. Die Negation NICHT kann im Satz verschiedene Plätze einnehmen.
Beispiel:
Die Aufgabe ist schwer, aber keinesfalls unlösbar.[30]
Ihr Einfluss darf keinesfalls unterschätzt werden.[31]
Um Himmels willen ! Wie kannst du über zwei Dinge schreiben, die du nie gehabt hast?[32]
(4) EXISTIMATORISCHE ANGABEN
Existimatorische Angaben geben einen Sachverhalt durch den Sprecher wieder. Sie beziehen sich auf die ganze Äußerung, aber sie können auch auf die einzelne Satzteile orientiert sein. Das Wort `existimatorisch` kommt aus dem Latein und bedeutet einschätzen.
Nach der zusätzlichen Art ihrer Orientierung sind existimatorische Angaben in sieben Subklassen eingeteilt. Wir haben folgende Subklassen:
(1) kautive Angaben
(2) selektive Angaben
(3) ordinative Angaben
(4) judikative Angaben
(5) verifikative Angaben
(6) Abtönungspartikel
(7) Dativus ethicus
(1) KAUTIVE ANGABEN
Diese Angaben stammen von dem lateinischen Wort `cauto`ab, das `vorsicht ` bedeutet. Diese Angaben gebraucht der Sprecher, wenn er sich vom Ausdruck distanzieren will. Er spricht mit Vorsicht über etwas.
Ausdrucksformen :
(a) mit Gradpartikeln: fast, geradezu, gewissermaßen, sozusagen, teilweise
(b) das unflektierte Adjektiv: einfach
(c) Ausdrücke wie: im allgemeinen, in gewisser weise, ich möchte sagen
Beispiele:
Michael Schumacher, der reichste Formel 1-Star, ist einfach vollkommen.[33]
Das tat ihrer Würde keinen Abbruch, sondern erhöhte sie noch gewissermaßen. [34]
Sie sind teilweise gefahren und teilweise zu Fuß gegangen.[35]
(2) SELEKTIVE ANGABEN
Diese Elemente betonen einen Ausdruck und verbinden diesen Ausdruck mit einem anderen möglichen Sachverhalt .
Ausdrucksform:
(a) die Gradparikel: allein, bereits, besonders, eben, gerade, insbesondere, sogar
(b) die unflektierten Adjektive: ausgerechnet, vornehmlich
(c) Ausdrücke wie: vor allem
Beispiele:
Die Anegdoten wollen vor allem denjenigen, der sie liest, unterhalten.[36]
Sie mag die Blumen sehr gern , insbesondere Rosen.[37]
Sie ging sogar selbst hin.[38]
Das vornehmliche junge Publikum war begeistert.[39]
(3) ORDINATIVE ANGABEN
Diese Angaben beziehen sich auf die anderen Äußerungen bzw.sie überschreiten die Satzangaben.
Ausdrucksformen:
(a) die Partikel: allerdings, allenfalls, außerdem, beispielsweise, einerseits, erstens, ferner, freilich, immerhin, jedenfalls, jedoch, nämlich, mindestens, schließlich, sowieso, übrigens, vielmehr, wohl, zudem, zugleich, zwar
(b) die unflektierten Adjektive: gewiss, sicher, tatsächlich, wirklich
(c) Ausdrücke wie: auf der anderen Seite, im übrigen, in erster Linie, zum Beispiel
Beispiele:
Freunde machten schließlich darauf aufmerksam, und der Dichter entschloss sich zu einer Probe.[40]
Und im übrigen kennst du Tante Emily.[41]
Er flöste mir Mitleid und Respekt zugleich ein.[42]
Ich habe nämlich zwei Tage nichts gegessen.[43]
Das war heute zum Beispi e l ein schöner Tag.[44]
Außerdem bin ich gewohnt, abends unerwarteten Besuch vorzufinden.[45]
Das dicke Kind kam an einem Freitag oder Samstag, jedenfalls nicht an dem zum Ausleihen bestimmten Tag.[46]
(4) JUDIKATIVE ANGABEN
Diese Angaben finden wir nur in Mitteilungen wieder. Sie zeigen wie der Sprecher den Sachverhalt schätzt und orientiert sich auf den Satz, derden Sachverhalt darstellt. Hier haben wir meistens die Partikel mit dem Suffix- weise:
(a) annerkannterwiese ,ärgerlicherweise, charakterweise, enttäuschenderweise, erfreulicherweise, legitimerweise, glücklicherweise
(b) Ausdrucke wie: Gott sei dank, zum Glück,
(c) Nebensätze: was mir sehr leid tut, was ich bedauerlich finde
Beispiele:
Ich rede also sinnvollerweise von der Wohltat für Robert.[47]
Zum Glück bin ich mit dem Frühstück gerade fertig geworden.[48]
Nach vier Jahren Ehe mit ihrer Jugendliebe Schlagerstar Jürgen Drews musste sie , was ihr sehr leid tat, ihn verlassen.[49]
Darüber ist sie verständlicherweise böse.[50]
(5) VERIFIKATIVE ANGABEN
Diese Elemente formen den Realitätsgrad eines Sachverhalts um.
Sie sind auf Äußerungen orientiert, bzw. auf das Verb. Wir finden diese Angaben in Aussagen und manchmal in Fragen.
Ausdrucksformen:
(a) die Partikel: anscheinend, bekanntlich, gewissermaßen, hoffentlich, logischerweide, möglicherweise, vielleicht, zweifellos, zweifelsohne
(b) die unflektiertn Adjektive: an sich, im Grunde, mit Sicherheit, ohne Frage, ohne Zweifel
(c) Nebensätze: wie sich leicht nachweisen läßt, wie ich hoffe
Beispiele:
Dann sage ich dir natürlich auch nicht, was ich hier im Korb habe.[51]
Hoffentlich hast du recht.[52]
Das sind, ohne Zweifel, seine Kaninchen.[53]
Er war angeblich verstorben.[54]
(6) ABTÖNUNGSPARTIKEL
Der Sprachgebrauch dieser Elemente und ihre Bedeutungen ist sehr schwer zu erklären. Sie sind auf das Verb orientiert. Diese Partikel formen die Redeabsicht um. Sie können das Verb verstärken oder abmindern.Hier haben wir folgende:
aber, also, auch, bloß, bitte, denn, doch, durchaus, eben, eigentlich, einfach, etwa, gleich, halt, ja, lediglich, mal, nicht, noch, nun, nur, ruhig, schnell, schon, vielleicht, wohl
Beipiele:
Bei einer Abendgesellschaft entzündete sich ein Streit über die Frage: ob es nun in Europa mehr Mönche oder Soldaten gebe.[55]
Du schläfst hier wohl, was?[56]
Ich kann einfach meine erste Liebe nicht vergessen.[57]
Du bist aber hübsch geworden.[58]
Hast du dir auch alles gemerkt?[59]
Was würde denn ich machen?[60]
Kannst du mir vielleicht den Regenschirm leihen?[61]
(7) DATIVUS ETHICUS
Dativus ethicus wird immer im ironischen Sinne gebraucht als Aufforderung, Ermahnung, Vorwurf etc.
Beispiele:
Du bist mir ein Arzt![62]
Du bist mir einer![63]
LITERATURVERZEICHNIS:
- Engel, Ulrich: Syntax der dt. Gegenwartssprache; Verlag-Berlin.-1997.
- Engel, Ulrich: Deutsche Grammatik.- Julius Groos Verlag.- Heidelberg, 1988.
- Petronjijević, Bo žinka i Popović, Branislava: Zbirka tekstova iz savremene nemačke proze., treće pregledano izdanje, filološki fakultet.,- izdavač je narodna knjiga.- 2000.
- Weder, Maria: Das Geisterhaus.- Verlag.- Mannheim, 1974.
- Göök, Roland: Menschen die, die Welt veränderten, Schicksale. Taten- Wirkungen.; -Verlag.- Berlin- Darmstadt- Wien, 1989.
- Duden, Konrad: Deutsches Universalwörterbuch.
- Dr. Stefan Schank: Die besten Anegdoten.- 1998.
- Helbig, Gerhardt und Schenkel, Wolfgang: Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben.;-Max Niemayer Verlag.- Tübingen, 1997.
[...]
[1] Syntax der deutschen Gegenwartssprache von Ulrich Engel,Verlag Berlin 1997 S.185
[2] Ulrich Enge `Deutsche Grammatik`,Julius Groos Verlag 1988 Heidelberg S.219
[3] Reutlinger General-Anzeiger,Sportüberblick S.22 Donnerstag, 12.Oktober 2001
[4] ebd.S.22
[5] Božinka Petronjijević i Branislava Popović,`Zbirka tekstova iz savremene nemačke proze`,3 pregledano Izdanje filološki fakultet,narodna knjiga 2000 ,Siegfried Lenz-Das Malverbot S.163
[6] Maria Weder -Das Geisterhaus ,- Verlag Mannheim 1974 S.45
[7] B.P.i B.P.,Zbirka tekstova iz savremene nemačke proze’ narodna knjig 2000 filološki fakultet.,Wolfgang Borchert’Nachts schlafen die Ratten doch’ S.16
[8] ebd.Hermann Hesse’Ein Maulbronner Seminarist’ S.105
[9] ebd.Lens Rinser’Ein alter Mann stirbt’ S.35
[10] ebd.Heinrih Böll,’Unberechenbare Gäste’ S.11
[11] ebd.Anna Seghers,’Das Versteck’,S.51
[12] Ulrich Engel,`Deutsche Grammatik`,1988 Julius Groos Verlag Heidelberg ,S.224
[13] B.P. i B.P.,`Zbirka tekstova savremene proze`,treće pregledano izdanje ,filioški fakultet narodna knjiga 2000.,Bertolt Brecht ,`Das Experiment`,S.75
[14] ebd.Siegfried Lenz,`Das Malverbot
[15] ebd., Max Frisch,`Geschichte von Isidor`,S.83
[16] ebd.,Hermann Broch,`Die Erzählung der Magd Zerline`,S.145
[17] ebd.,Hermann Broch ,`Die Erzählung der Magd Zerline`,S.147
[18] ebd.,Bertolt Brecht ,`Das Experiment`,S.77
[19] ebd.,Hermann Broch,`Die Erzählung der Magd Zerline`,S.146
[20] ebd.,Max Frisch ,`Geschichte von Isidor`,S.82
[21] ebd.,Bertolt Brecht,`Das Experiment`,S.76
[22] Menschen ,die die Welt veränderten,Schicksale –Taten-Wirkungen,herausgegeben von Roland GöökVerlag Berlin Darmstadt Wien 1989,S.172
[23] B.P. i B.P.,`Zbirka testova….Bertolt Brecht ,`Das Experiment`,S.75
[24] ebd.,Gabriel Wohmann,`Ein schöner Tag`,S.55
[25] Menschen die ,die Welt veränderten,Schicksale-Taten-Wirkung,Herausgegeben von Roland Göök ,Berlin –Darmstadt-Wien 1989.S.82
[26] ebd.,S.76
[27] ebd.,S.77
[28] B.P. i B.P.`Zbirka tekstova savremene….`,Bertolt Brecht ,`Das Experiment`,S.81
[29] ebd.Bertolt Brecht,`Das Experiment` ,S.80
[30] `Deutsches Universalwärterbuch`,Duden
[31] `Deutsches Universalwörterbuch`,Duden
[32] `Die besten Anegdoten`, Dr. Stefan Schank
[33] `Deutsches Universalwörterbuch`,Duden
[34] ebd.
[35] ebd.
[36] `Die besten Anegdoten`,Dr. Stefan Schank
[37] `Deutsches Universalwörterbuch`, Duden
[38] ebd.
[39] ebd.
[40] `Die besten Anegdoten`, Dr. Stefan Schank
[41] Božinka Petronjijević i Branislava Popović,`Zbirka tekstova iyz savremene proze`, 3 pregledano iydanje filološki fakultet, narodna knjiga 2000, `Ein alter Mann stirbt`, Luise Rinser
[42] ebd.
[43] Ebd.
[44] Ebd.`Ein schöner Tag`. Gabriele Wohmann
[45] ebd.`Unberechenbare Gäste`, Heinrich Böll
[46] ebd.,`Das dicke Kind`, Luise M.Kaschnitz
[47] ebd.`Ein schöner Tag `,Gabriele Wohmann
[48] ebd.
[49] ´Presse`
[50] `Deutsches Universalwörterbuch`,Duden
[51] `Nachts schlafen die Ratten doch`,Wolfgang Borchert
[52] ebd.
[53] ebd.
[54] ebd.
[55] `Deutsches Universalwörterbuch`, Duden
[56] `Nachts schlafendie Ratten doch`,Wolfgang Borchert
[57] `Die Erzählung der Magd Zerline`,Hermann Broch
[58] ebd.
[59] ebd.
[60] Ebd.
[61] `Deutsches Universalwörterbuch`,Duden
[62] `Deutsches Universalwörterbuch`, Duden
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptthemen des Dokuments?
Das Dokument behandelt hauptsächlich Satzangaben im Deutschen, insbesondere deren Klassifizierung und Funktion. Es werden verschiedene Arten von Angaben detailliert beschrieben und mit Beispielen aus der Literatur illustriert. Die Einteilung erfolgt in vier Hauptklassen: modifizierende, situierende, negative und existimatorische Angaben.
Welche Arten von situierenden Angaben werden im Detail behandelt?
Das Dokument geht ausführlich auf verschiedene Arten von situierenden Angaben ein, darunter: Temporalangaben, Lokalangaben, Kausalangaben, Konditionalangaben, Konsekutivangaben, Konzessivangaben, Finalangaben, Instrumentalangaben, Restriktivangaben und Komitative Angaben. Jede dieser Kategorien wird definiert und durch Beispiele verdeutlicht.
Was sind modifizierende Angaben und wie werden sie ausgedrückt?
Modifizierende Angaben beziehen sich auf das Hauptverb und modifizieren den genannten Sachverhalt oder den durch das Verb beschriebenen Vorgang. Sie können durch Adverbien, Präpositionalphrasen, wie-Phrasen oder Als ob-Sätze ausgedrückt werden.
Wie werden existimatorische Angaben klassifiziert?
Existimatorische Angaben, die einen Sachverhalt durch den Sprecher wiedergeben, werden in sieben Subklassen unterteilt: kautive Angaben, selektive Angaben, ordinative Angaben, judikative Angaben, verifikative Angaben, Abtönungspartikel und Dativus Ethicus.
Was sind negative Angaben und welche Formen können sie annehmen?
Negative Angaben negieren Sachverhältnisse und können verschiedene Formen annehmen, darunter "nicht", "keinesfalls", "keineswegs", "durchaus nicht" sowie Negationsangaben mit situativer Komponente wie "nirgends" und "niemals".
Welche Autoren und Werke werden im Dokument zitiert?
Das Dokument zitiert verschiedene Autoren und Werke der deutschen Literatur, darunter Siegfried Lenz, Maria Weder, Hermann Hesse, Heinrich Böll, Anna Seghers, Bertolt Brecht, Max Frisch, Hermann Broch, Luise Rinser, Gabriele Wohmann und Wolfgang Borchert. Es werden Beispiele aus ihren Werken verwendet, um die verschiedenen Arten von Satzangaben zu illustrieren.
Was bedeuten die Begriffe "Ergänzungen" und "Angaben" im Kontext des Textes?
Ergänzungen und Angaben sind linguistische Termini, die sich auf Satzglieder beziehen. Ergänzungen sind valenzbedingt und vom Verb gefordert, während Angaben nicht valenzbedingt sind und frei hinzugefügt werden können.
- Quote paper
- Sandra Nastic (Author), 2003, Modifizierende, situierende, negative und existimatorische Satzangaben, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109927