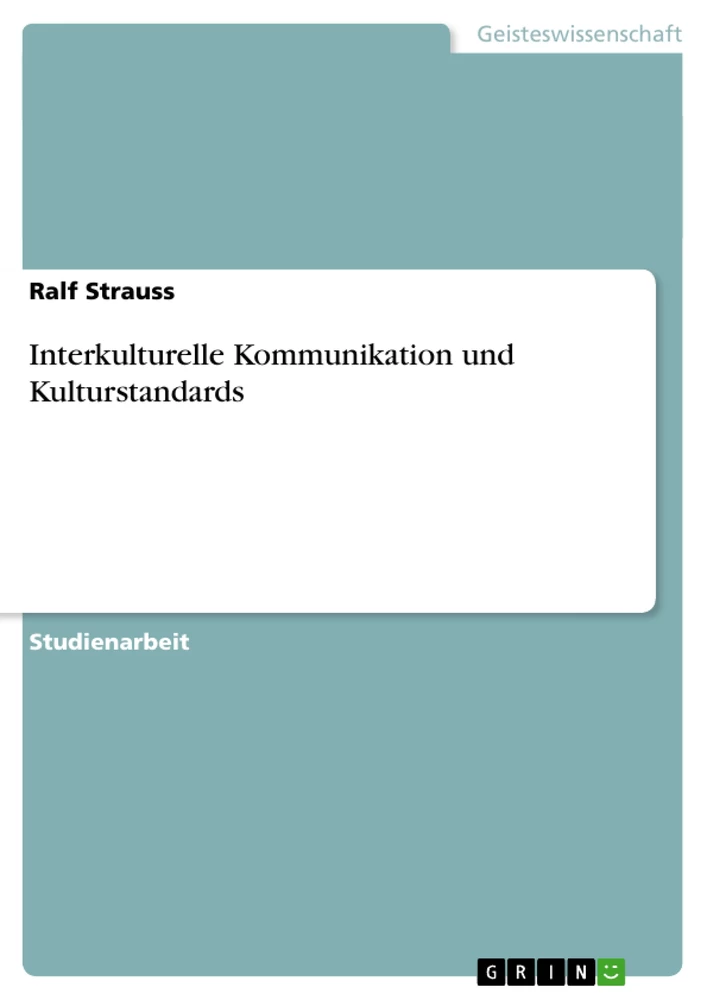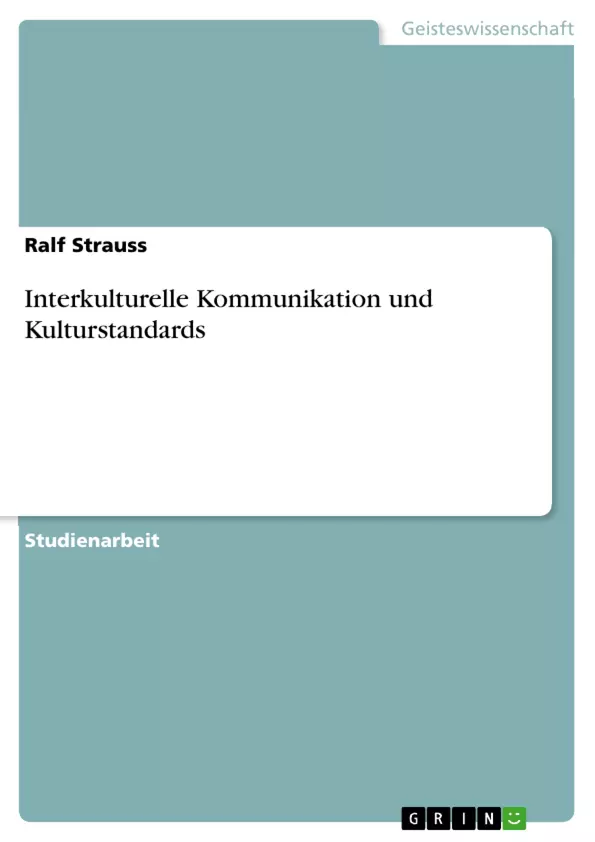„Ich möchte vorausschicken, daß ich das Problemfeld noch nicht ausführlich und tiefgehend genug untersucht habe. Ich möchte an dieser Stelle nur einige oberflächliche Meinungen äußern, die möglicherweise falsch sind. Für Unzulänglichkeiten und Fehler in meinen Äußerungen bitte ich um Kritik und Verbesserungsvorschläge.“1
Das Zitat soll nicht als entschuldigender Beginn dieser Arbeit verstanden werden, schließlich sind bei einer wissenschaftlichen Hausarbeit längere Recherchen und abgewogene Äußerungen gefragt. Doch auch als Einstieg in einen öffentlichen Vortrag, zum Beispiel bei einem Referat, scheinen die obigen Sätze nicht geeignet. Sie müßten in einer derartigen Situation entweder als leicht durchschaubares fishing for compliments und daher als nicht angemessen erscheinen, oder, die nicht minder bessere Alternative, sie treffen tatsächlich zu. Dann aber ist dem Referenten vorzuwerfen, daß er seine ihm gestellte Aufgabe nicht adäquat lösen konnte, denn wer öffentlich etwas von sich gibt, hat gut vorbereitet zu sein und seine Äußerungen müssen korrekt sein.
Die oben zitierte Einleitung ist in China allerdings der übliche Beginn eines öffentlichen Vortrags. In Deutschland hingegen würde durch diesen Beginn das Anspruchsniveau der Zuhörer stark nach unten getrieben, da, wer sich schon im Vorhinein für das entschuldigt, was er sagen wird, es besser ganz bleiben läßt, sich öffentlich zu äußern. Nun haben Chinesen, wenn sie obige Eröffnung wählen, sicherlich kein Interesse daran, ihre Zuhörer gleich zu Beginn der Rede zu enttäuschen und es ist überhaupt fraglich, ob sie wirklich so schlecht vorbereitet sind, wie sie es scheinbar zum Ausdruck bringen. Ihre (chinesischen) Zuhörer indes werden an dieser Redeeröffnung keinen Anstoß nehmen, ganz im Gegenteil: Wählte man einen bei uns üblichen Einstieg, würde dieser „bei chinesischen Zuhörern dagegen häufig den Eindruck des unhöflichen, schlecht erzogenen sozialen Barbaren“2 hinterlassen.
Als über das Thema der interkulturellen Kommunikation im Seminar zu referieren war, wurde, als kleines Experiment, die „chinesische Vortragseröffnung“ gewählt. Wie erwartet reagierten die Zuhörer überrascht. Es wurde gesagt, der Referent solle doch einfach beginnen, man werde dann schon sehen. Andere äußerten ihre Verwunderung über diesen „gehemmten“ Beginn.
Die Reaktionen zeigen die Schwierigkeit von Kommunikation beim Vorliegen unterschiedlicher Voraussetzungen [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Interkulturelle Kommunikation - was ist das?
- a) Kommunikation
- b) Kultur
- c) Interkulturelle Kommunikation
- 3. Kulturstandards - ein Modell
- a) Kultur
- b) Standard
- c) Kulturstandard
- 3.1. Wie entstehen Kulturstandards?
- 3.2. Wie lernt man Kulturstandards?
- 4. Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Herausforderungen interkultureller Kommunikation, insbesondere im Kontext unterschiedlicher Kulturstandards. Ziel ist es, das Modell der Kulturstandards als Werkzeug zur Reflexion kultureller Handlungsmuster zu beleuchten und die Bedeutung interkulturellen Lernens hervorzuheben.
- Die Komplexität von Kommunikation und ihre kulturelle Bedingtheit
- Das Modell der Kulturstandards und seine Anwendung
- Der Entstehungsprozess und Erwerb von Kulturstandards
- Die Rolle von Werten und Normen in der interkulturellen Kommunikation
- Die Vermeidung interkultureller Missverständnisse durch Reflexion kultureller Handlungsmuster
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einem Zitat, das in China üblich ist, in Deutschland aber als unangemessen empfunden wird. Dieser Kontrast verdeutlicht die kulturspezifischen Unterschiede in Kommunikationsnormen und -erwartungen und führt direkt in die Thematik der Arbeit ein: die Herausforderungen der interkulturellen Kommunikation, insbesondere die Rolle von unterschiedlichen kulturellen Handlungsmustern. Das Beispiel der „chinesischen Vortragseröffnung“ dient als anschauliche Einführung in die Problematik.
2. Interkulturelle Kommunikation - was ist das?: Dieses Kapitel analysiert den komplexen Begriff der interkulturellen Kommunikation, indem es die einzelnen Komponenten – Kommunikation und Kultur – untersucht. Es erläutert, dass Kommunikation, selbst innerhalb einer Kultur, anfällig für Missverständnisse ist, da verbale und nonverbale Äußerungen nie eindeutige Zeichensysteme darstellen. Der Abschnitt zur Kultur verdeutlicht, wie tief verwurzelt kulturelle Logiken im individuellen Denken und Handeln sind und wie diese unbewusst die Wahrnehmung und Interpretation von Kommunikation beeinflussen.
3. Kulturstandards - ein Modell: Dieses Kapitel präsentiert ein Modell von Kulturstandards, das als Methode zur Reflexion kultureller Handlungsmuster dient. Es analysiert die Entstehung und den Erwerb von Kulturstandards und betont deren Bedeutung für die erfolgreiche Bewältigung interkultureller Kommunikationssituationen. Der Fokus liegt auf der praktischen Relevanz des Modells zur Vermeidung von Missverständnissen und zur Förderung interkulturellen Lernens.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Kommunikation, Kulturstandards, Kommunikation, Kultur, Missverständnisse, Handlungsmuster, interkulturelles Lernen, deutsch-chinesischer Vergleich, Werte, Normen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Interkulturelle Kommunikation und Kulturstandards"
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich mit den Herausforderungen interkultureller Kommunikation, insbesondere im Kontext unterschiedlicher Kulturstandards. Sie untersucht ein Modell der Kulturstandards als Werkzeug zur Reflexion kultureller Handlungsmuster und betont die Bedeutung interkulturellen Lernens. Die Arbeit enthält eine Einleitung, eine Definition interkultureller Kommunikation, eine detaillierte Erläuterung des Modells der Kulturstandards, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Komplexität von Kommunikation und ihre kulturelle Bedingtheit; das Modell der Kulturstandards und seine Anwendung; den Entstehungsprozess und Erwerb von Kulturstandards; die Rolle von Werten und Normen in der interkulturellen Kommunikation; und die Vermeidung interkultureller Missverständnisse durch Reflexion kultureller Handlungsmuster. Ein deutsch-chinesischer Vergleich dient als illustratives Beispiel.
Was ist das Modell der Kulturstandards?
Die Seminararbeit präsentiert ein Modell von Kulturstandards als Methode zur Reflexion kultureller Handlungsmuster. Dieses Modell dient als Werkzeug, um kulturelle Unterschiede im Denken und Handeln zu verstehen und Missverständnisse in der interkulturellen Kommunikation zu vermeiden. Die Arbeit analysiert die Entstehung und den Erwerb dieser Standards und betont deren praktische Relevanz für erfolgreiches interkulturelles Handeln.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: eine Einleitung, die den Fokus auf interkulturelle Kommunikation und kulturelle Unterschiede legt; ein Kapitel zur Definition von interkultureller Kommunikation, das die Komponenten Kommunikation und Kultur analysiert; ein Kapitel zum Modell der Kulturstandards, das dessen Entstehung, Erwerb und Anwendung erläutert; und schließlich eine Schlussbetrachtung. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis ist enthalten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Seminararbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Interkulturelle Kommunikation, Kulturstandards, Kommunikation, Kultur, Missverständnisse, Handlungsmuster, interkulturelles Lernen, deutsch-chinesischer Vergleich, Werte und Normen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Zielsetzung der Seminararbeit ist es, die Herausforderungen interkultureller Kommunikation zu untersuchen und das Modell der Kulturstandards als Werkzeug zur Reflexion kultureller Handlungsmuster zu beleuchten. Ein weiterer Fokus liegt auf der Hervorhebung der Bedeutung interkulturellen Lernens zur Vermeidung von Missverständnissen.
Welche Beispiele werden in der Seminararbeit verwendet?
Als Beispiel wird ein in China übliches, in Deutschland aber als unangemessen empfundenes Zitat verwendet, um die kulturspezifischen Unterschiede in Kommunikationsnormen und -erwartungen zu verdeutlichen. Ein "chinesische Vortragseröffnung" dient als anschauliche Einführung in die Problematik der interkulturellen Kommunikation.
- Quote paper
- Ralf Strauss (Author), 2000, Interkulturelle Kommunikation und Kulturstandards, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10993