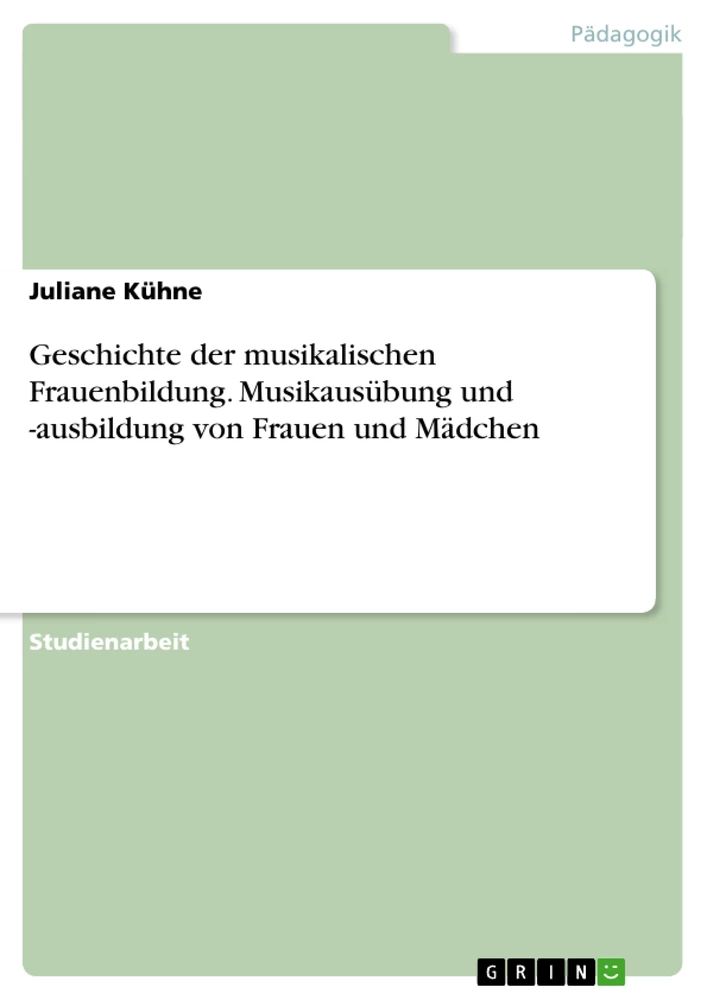Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Geschichte der Musikausbildung und -ausübung von Frauen und Mädchen legt dabei ein besonderes Augenmerk auf die Diskriminierung und Unterdrückung der Frau in diesem Bereich. Dieses Thema ist nach wie vor aktuell – nicht nur in der Musik.
1. EINLEITUNG
In dieser Arbeit möchte ich mich mit der Geschichte der Musikausbildung und -ausübung von Frauen und Mädchen auseinandersetzen und dabei ein besonderes Augenmerk auf die Diskriminierung und Unterdrückung der Frau in diesem Bereich legen. Dieses Thema ist nach wie vor aktuell – nicht nur in der Musik.
Wie sublim diese Diskriminierung sein kann, wie sehr man/frau alten Denkstrukturen verhaftet sein kann, konnte ich schon an mir selbst feststellen: Es war ein Konzert angekündigt, in dem hauptsächlich Kompositionen von Frauen aufgeführt werden sollten. Es lag nicht nur an allgemeiner Motivationslosigkeit und Desinteresse, dass ich das Konzert nicht besuchte. Wenn ich meinen Gedankengängen von damals folge, bemerke ich, dass ich der festen Überzeugung war, diese Werke seien sehr wahrscheinlich oberflächlich, von geringer Qualität und im Zuge der allgemeinen Frauenemanzipation „hochgepuscht“. Tatsächlich hatte ich mich noch nie mit komponierenden Frauen wie Clara Schumann oder Fanny Hensel beschäftigt, geschweige denn je Musik von komponierenden Frauen gehört! Woher kamen meine völlig unbegründeten Vorurteile?
Mit Hilfe der beiden o. g. Bücher möchte ich versuchen, eine Antwort zu finden. Die Lektüre hat meine Sensibilität für Geschlechterrollen und Diskriminierung von Frauen im Alltag verstärkt. Warum z. B. wurden in einer (von mir hospitierten) Früherzeihunhsstu8nde zuerst Jungen aufgerufen, als sie auf einer Handtrommel einen Elefanten nachahmen sollten und bei einer Maus zuerst die Mädchen? Oder: In „Üben und Musizieren“ 2/98 findet sich nach einem Artikel der Zusatz: „Wegen der einfacheren Lesbarkeit möchte der Autor nur die männliche Endung benutzen.“ (Istvanffy, 1998, S.29). Das kann ich voll und ganz verstehen: Es ist immer unbequem, alte, liebgewordene Denkmuster und Gewohnheiten aufzugeben oder z7u verändern. Es wäre sehr interessant zu wissen, wie sich ein Student mit diesem Thema in einer Arbeit auseinandersetzen würde. Ich schreibe absichtlich nicht „ein männlicher Student“. Es mag kleinlich und übertrieben klingen, aber gegenseitige Gleichberechtigung und Achtung zwischen den Geschlechtern muss irgendwo anfangen. Auch mit Kleinigkeiten. Und vor allem: mit Worten. „Menschen beginnen nicht mit Taten, sondern mit Worten, Worten wie diesen. Und Worte spiegeln eine vorhandene Einstellung wider...“ (Leon, 1999, S.60). Wie bedeutend Worte sein können, habe ich bei der Lektüre der beiden Bücher immer wieder gemerkt.
2. DIE INTENTIONEN VON EVA RIEGER UND FREIA HOFFMANN
Das Buch von Eva Rieger erschien 1981. Sie konnte sich nicht auf allzu viele Vorarbeiten zu diesem Thema stützen. Die zu bearbeitende „weiße Fläche“ (Rieger, 1981, S.10) war und ist immer noch sehr groß. Wenn es Publikationen zu diesem Thema gab, waren diese oft „einseitig oder gar verfälschend“ (ebd.). Weitere Schwierigkeiten bestanden darin, dass eine Vielzahl von verschiedenen Fachrichtungen in die Arbeit einbezogen werden mussten, auch wenn sie z. T. nur gestreift werden konnten, z. B: Musikwissenschaft, Musikpädagogik, historische Pädagogik, allgemeine musikpsychologische und musiksoziologische Untersuchungen u. v. m. Die Autorin wollte anfangs nur eine historisch aufbereitete Arbeit über die „Situation des Mädchens im musikpädagogischen Sektor“ (ebd.) schreiben, jedoch wuchs durch die Beschäftigung mit diesem Thema das Interesse an einer weitergreifenden Untersuchung. Das Buch will deswegen nur mehr einen allgemeinen Überblick geben, ist dadurch aber auch „zwangsläufig unvollständig“(Rieger, 1981, S.10). Trotzdem ist es sehr informativ und kann bereichernd sein für den eigenen Umgang mit der heutigen Musikkultur.
Eva Rieger beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Ausmaß der Vormachtstellung des Mannes in der musikalischen Kultur – um den Preis der gewaltsamen Unterdrückung der Frau (Rieger, 1981, S.16). Sie forscht nach, wo die Gründe dafür liegen könnten und wie man/frau diesem Zustand begegnen könnte. Sie geht dabei oft tief in psychologische Bereiche hinein, was für mein eigenes. Allgemeines Verständnis der Gesellschaftlichen Beziehungen zwischen Mann und Frau von buchstäblich „grund – legender“ Bedeutung war. Allerdings kann und möchte ich nicht immer allen Erläuterungen Eva Riegers folgen und ebenso nicht den Schlüssen, die sie daraus zieht: die Worte „Potenz“, „Impotenz“, „Phallussymbol“ oder „Gebärneid“ usw. scheinen mir etwas zu oft und zu leicht als Erklärung von männlichem Verhalten herangezogen worden zu sein (besonders bei ihrem „Exkurs: verräterische Sprache“, S.83 bis 89). Das is6t allerdings ein Bereich, in dem ich keinerlei Kenntnisse besitze, also auch kein begründetes Urteil abgeben kann. Leider wurde in diesem Buch keine Angaben zu Eva Riegers Lebenslauf und Ausbildung gemacht, so dass ich nicht weiß, in welchem Maße sie psychologische Kompetenz besitzt.
Eva Rieger beschränkt sich in ihrer Arbeit vor allem auf die Zeit ab 1750; gleichzeitig steht die Frau der bürgerlichen Mittelschicht im Vordergrund und mit ihr die sogenannte E-Musik, da es zur Volksmusik noch weniger Arbeiten und überlieferte Quellen gibt. Auch werden andere Länder als Deutschland weitgehend aus ihren Untersuchungen ausgegrenzt, da diese andere Entwicklungen durchliefen. Sie stellt dar, wie „sich Musikunterricht für Mädchen ausgeprägt hat“, wie „Musik als Trägerin geschlechtsspezifischer Ideologien“ identifiziert wurde, beschreibt einige Frauenschicksale und beschäftig sich im letzten teil mit musikalischen Berufen und „inwiefern sie den Künstlerinnen Verhinderungen entgegenstellen“ (Rieger, 1981, S.17). Letztgenannte Punkte werde ich jedoch nicht bearbeiten, da dies den Rahmen der Arbeit sprengen würde. Ich möchte hier hauptsächlich auf historische Entwicklungen eingehen.
Eva Rieger stellt ihrer Studie drei Voraussetzungen voran, die sicherlich auch als zusammengefasstes Ergebnis ihrer Arbeit angesehen werden können. Diese drei Punkte erscheinen eigentlich selbstverständlich, aber gerade deshalb ist es notwendig, sie eindeutig festzumachen – auch als Grundlage für weiterführende Diskussionen:
Es gibt bis jetzt keine wissenschaftlichen Beweise, dass:
- „Frauen ‚unschöpferischer’ sind als Männer,
- Frauen aufgrund ihrer biologischen Reproduktionsfähigkeit zwangsläufig für die Aufzucht von Kindern zuständig sind;
- Frauen aufgrund naturgegebener ‚weiblicher’ Eigenschaften für die emotionale und leibliche Regeneration des Mannes zu sorgen haben. „ (Rieger, 1981, S.18)
Der Schwerpunkt, den Freia Hoffmann in ihrem Buch setzt, lässt sich schon im Titel erkennen. Da das Verhältnis von Frauen zu Musikinstrumenten auch heute noch vielfach problematisch ist (sei es im Orchester oder beim Gespräch in der Musikschule, was für ein Instrument das Kind lernen soll), versucht die Autorin Gründe dafür zu finden und die Vorgeschichte aufzuarbeiten. Dabei ist ihr „die Analyse der herr -schenden (Hervorhebung: J.K.) Wahrnehmungsmuster“ wichtig, aber auch „die Tradition des weiblichen Widerstandes, des praktischen Ungehorsams gegen das Diktat der ‚Schicklichkeit.’“ (Hoffmann, 1991, S.11) Sehr positiv fiel mir dabei auf, dass Freia Hoffmann die Frau ni9cht in eine passive Opferrolle drängt. Sie sieht ihr Buch nicht als eine „Anklage gegen die Beschränkungen und Zurichtungen, die man der Frau abverlangt hat“, sondern sagt und zeigt deutlich, dass Frauen aktiv ihre Lebenssituation veränderten: Dies sei „eine Frage des persönlichen Mutes“ (ebd.). Sie schiebt die Verantwortung für Veränderungen der gesellschaftlichen Situation also nicht allein auf das männliche Geschlecht ab. Auch Freia Hoffmann beschränkt sich auf die Zeit zwischen 1750 und 1850, auf die bürgerliche Frau bzw. auf Deutschland und die E-Musik.
Als (ebenfalls nicht zu reichhaltige) Vorarbeiten, auf die sie sich stützen konnte, nennt sie u. a. gelegentliche Einzeldarstellungen seit Ende des 19. Jahrhunderts, Sophie Drinkers Versuch eines historischen Gesamtüberblicks (1955), Forschungen über Komponistinnen seit 1980 und Eva Riegers Arbeiten. Auch Frau Hoffmann schreibt im Vorwort, dass sie im Laufe der Arbeit immer wieder an Grenzgebiete stieß, und sie darüber nur vorläufige Aussagen und Thesen formulieren konnte. Genauere Darstellungen eines Themas bedürften einer eigenen Arbeit. Sie gesteht, dass sie „historisch nicht zurückverfolgen konnte, warum die musizierende Frau in der bürgerlichen Gesellschaft so eine große Angst und Reglementierung provoziert hat“ (Hoffmann, 1991, S.13). Sie versucht also nicht, wie Eva Rieger, die Ursachen auf dem psychologischen Weg zu klären. Ich finde es ebenfalls schwierig, Ursprung und verständliche Gründe für die damalige/heutige patriarchalische Gesellschaftsordnung zu finden. Wie kann man/frau eine Kultur schaffen, „bei der endlich beide Geschlechter befriedet sind und im gegenseitigen Respekt miteinander arbeiten können“ (Rieger, 1981, S.19)?
3. HISTORISCHER ÜBERBLICK ÜBER DIE MUSIKALISCHE BILDUNG DER FRAU
Eine Aufarbeitung der Geschichte der Musikausbildung und -ausübung von Frauen und Mädchen findet in einem breiteren Maß nur bei Eva Rieger statt. Sie behandelt die (musikalische) Bildung allgemein, sowie den sozialen Status der Frau, der sich auf diese Bildung auswirkte. Dabei geht sie bis ins Mittelalter zurück und versucht von dort her, die sozialen und kulturellen Entwicklungen aufzurollen, die zu der speziellen Situation der Frau im 18./19. jahrhundert geführt haben und heute noch ihre Auswirkungen zeigen.
Im frühen Mittelalter gab es zwischen der Mädchen - und Jungenbildung besonders in den unteren Schichten Unterschiede. Mädchen wurde meistens nur das Notwendigste zum lesen des Katechismus beigebracht; ansonsten wurden sie von früh an zur Arbeit im Haushalt und auf dem Feld angehalten, was ihrer eigentlichen, späteren Rolle entsprach.
Die adligen Töchter dagegen erhielten in Musik und oft auch in den Wissenschaften einen Unterricht, der dem der Knaben gleichgestellt war. Frauenklöster fungierten oft als Erziehungsanstalten. Dabei spielt gerade die Kirche hier eine widersprüchliche Rolle. Einerseits begann hier die Ausgrenzung der Frau von gesellschaftlichen Machtpositionen – sie durfte nicht das Amt eines Priesters bekleiden. Andererseits gingen aus den Klöstern viele Komponistinnen hervor (siehe: Rieger, 1981, S.20ff). Insgesamt waren „die Geschlechter (...) gleichgestellt – eine Erscheinung, die erst rund 1000 Jahre später, in unserem Jahrhundert, wieder auftritt.“ (Rieger, 1981, S.23) „Erst in den darauffolgenden Jahrhunderten wurde mit der Betonung der angeblich schwächeren Konstitution des weiblichen Geschlechts eine Ungleichheit festgeschrieben.“ (ebd.)
Im 12./13. Jahrhundert bemühten sich auch erstmalig bürgerliche Familien um eine gewisse musikalische Bildung ihrer Töchter. Sie eiferten dem Beispiel adliger Kreise nach.
Im 14./15. Jahrhundert wurden Frauen zunehmend aus ihrer Arbeit in speziellen Zünften heraus- und in die neue, eingeschränkte Rolle der Hausfrau und Mutter hineingedrängt. In den unteren Schichten waren Frauen jedoch weiterhin als „Spielweiber und Künstlerinnen, als Gauklerinnen und Tänzerinnen, als Leier- und Harfenmädchen tätig.“ (Rieger, 1981, S.25)
Im 14. bis 16. Jahrhundert differenzierten sich die Gesellschaftsschichten stärker. Es entstand ein Großbürgertum, bestehend vornehmlich aus Kaufleuten und Unternehmern. „Mit dem Aufkommen des Persönlichkeitsideals im 14. Jahrhundert konnte in Italien eine Reihe von Frauen eine vertiefte Bildung genießen,...“; sie wurden „den Männern gleichgestellt und standen in hohem Ansehen.“ (ebd.) Allmählich erfreute sich auch die Gesangstimme im öffentlichen Raum größerer Beliebtheit. In Deutschland war diese Entwicklung allerdings noch nicht zu bemerken. Erst spät im 16. Jahrhundert gewann eine intensive musikalische Bildung an adligen Höfen wieder an Bedeutung. Das Niveau des musischen Unterrichts für Mädchen anderer Schichten kam aber nicht über das Erlernen des Elementarsten hinaus. Es bestand ja auch keine Notwendigkeit, d. h. keine Möglichkeit für Mädchen, öffentlich oder im Rahmen der Kirche aufzutreten (siehe: Rieger, 1981, S.26ff). „Es kommt zu einer rückläufigen Entwicklung: je mehr die Kirche die Vormachtstellung des Mannes betont und der Frau ihren Platz an seiner Seite zuweist, desto rascher verlieren Frauen den eigenständigen Zugang zu Wissenschaft und Kunst.“ (Rieger, 1981, S.29)
Im 17. Jahrhundert verlor die Kirche ihre Vormachtstellung im religiösen Leben. Dagegen verfestigte sich das Großbürgertum und mit ihm die Rolle der Frau als Mutter, Ehefrau und Haushälterin. Sie wurde sozusagen „als Hüterin des erworbenen Besitzes benötigt.“ (Rieger, 1981, S.31) Eine musische und kognitive Ausbildung war dafür nicht notwendig. Im Bereich der Musik bildete sich allmählich der Zweig des Berufsmusikers heraus. Die letzten Frauenzünfte zerfielen und „so verloren die Frauen die wenige Macht, die sie besessen hatten, in allen Schichten.“ (Rieger, 1981, S.33)
Im 18. Jahrhundert wurde die Musik zur „bürgerlichen Lieblingskunst“ (Rieger, 1981, S.35). „Mit Entstehen der Warenwirtschaft ergab sich auf weltlichem Gebiet eine neue Funktion der Musik: sie wurde Genussmittel und Ausgleich gegen den aufreibenden Kampf jeden Einzelnen um seine Existenz.“ (Dibelius, zit. nach Rieger, 1981, S.36) Da die Frau als Anhang des Mannes galt und einzig im Haus zu walten hatte, wurde sie der Mensch, und das Haus der Ort, die für des Mannes Regeneration zu sorgen hatten. Mit der Herausbildung des Berufszweiges des Musikers, Komponisten und Kapellmeisters begann zusätzlich eine Kommerzialisierung der Musik. Frauen waren davon weitgehend ausgeschlossen. Einzig als Sängerinnen konnten sich Frauen durch professionelle Musikausübung ihren Lebensunterhalt verdienen.
Musik wurde als gutes Mittel angesehen, Frauen an das Haus zu fesseln; der Unterricht sollte unter strengsten Bedingungen stattfinden, damit sich Mädchen rechtzeitig an Gehorsam und Unterordnung gewöhnten. Die musikalische Bildung diente vor allem auch der „Wertsteigerung“ eines Mädchens für eine spätere Heirat (siehe: Rieger, 1981, S.48).
Eine Frau wurde jedoch zuerst über ihre Fähigkeiten im Haushalt definiert. Erst dahinter rangierte geistig-künstlerisches Können. Aber auch dies diente in erster Linie nicht ihr selbst, sondern sollte zur Erbauung und Regeneration des Ehemannes nach einem anstrengenden Arbeitstag beitragen. Eine weitere Möglichkeit, um Frauen von allzu intensiver Musikausübung abzuhalten (neben den allgemeinen moralischen Ansprüchen, den Ansprüchen des Ehemannes und der Gefahr als „Mannweib“ dargestellt zu werden), war die These „von der angeblich schwächeren Konstitution der Frau, die oft mit düsteren Voraussagungen möglicher Krankheiten gekoppelt wurde.“ (Rieger, 1981, S.54) Diese schädlichen Nebenwirkungen sollten durch das Spiel von bestimmten Instrumenten hervorgerufen werden. Oft war deshalb nur das Spiel von der Laute, Zither, Harfe und Klavier erlaubt. (Aber selbst Harfe und Glasharmonika galten nicht als „ungefährlich“.)
Freia Hoffmann geht in ihrem Buch auf diese Thema näher ein und benennt die Instrumente, die als „unschicklich“, „unsittlich“ oder gar „lächerlich“ bei musizierenden Frauen galten. (Darauf gehe ich später noch ein.)
Vor der Industrialisierung im 19. Jahrhundert beliefen sich die Pflichten einer Ehefrau auf eine Reihe von verschiedenen Tätigkeiten: Lebensmittel – und Kleidungsherstellung, Reinigung der Kleidung und des Hauses u. v. m. Als dann Maschinen diese Arbeit mehr und mehr ersetzten, „zerfiel der eigentliche Sinn der Hausfrau. Die Ideologie von ihrer ‚natürlichen Bestimmung’ wurde jedoch weiter aufrecht erhalten.“ (Rieger, 1981, S.59f)
Zusätzlich bildete sich ein neues Ideal heraus: das der völlig passiven Frau, eher Schmuck- und Präsentationsstück als Mensch mit eigenem Willen und Gedanken. Hierzu passt auch die Tatsache, dass Harfe und Klavier, die eine sehr weite Verbreitung fanden, sehr repräsentative Möbelstücke sind und sich vorzüglich dafür eignen, um viele monströse Verziehrungen anzubringen (was bei Streich- und Blasinstrumenten denkbar schwierig ist). Klavier und Harfe waren wegen ihrer großen Ausmaße auch schlechter transportierbar und erhöhten dadurch ihren „Gebrauchswert“, die Frau „in der sozialen Enge zu halten“ (Hoffmann, 1991, S.75) Als klassische Begleitinstrumente standen sie ebenfalls für die „Unterordnungsbereitschaft“ der Frau. Zu erwähnen ist noch, dass beim Spiel aller schicklichen Instrumente die hohe, „weibliche Stimmlage“ bevorzugt wurde. Auch die (selten gespielten) unschicklichen Instrumente wie Flöte, Geige und Klarinette sind hohe Instrumente. Eine Fagottistin oder Posaunistin ist gänzlich unbekannt (siehe: Hoffmann, 1991, S.77f).
Statt schwere körperliche Arbeit zu verrichten, sollte die Frau voll und ganz der Forderung ihres Ehemannes nach Ausgleich und Erholung nach einem Arbeitstag nachkommen können – etwas, was sich der Mann offensichtlich nicht selbst geben konnte, und deshalb glaubte, die Frau zur Kompensation dieses Mangels benutzen zu müssen und darauf sogar ein naturgegebenes Recht zu haben. Dass sich diese passive Rolle der Frau nur die wenigsten tatsächlich finanziell leisten konnten, spielte bei der Herausbildung dieses Ideals keine Rolle. „...eine tatsächliche Realisierung des weiblichen Geschlechtscharakters (konnte) nur im reichen Bürgertum gelingen..., während die überwiegende Mehrheit der Frauen als Land – und Fabrikarbeiterinnen und Hausangestellte tagtäglich das ‚Wesen der Frau’ als (zweifelhaftes) Privileg einer Minderheit entlarvte.“ (Hoffmann, 1991, S.73)
Wer es sich leisten konnte, schickte seine Tochter auf ein Pensionat oder auf eine höhere Töchterschule. Sie – die Töchter und die Schulen – wurden „als Statussymbole für die Familie benötigt, die den erfolgreichen wirtschaftlichen Konkurrenzkampf dokumentieren sollten.“ (Rieger, 1981, S.61) Zum festen Bestandteil der dortigen Ausbildung gehörte u. a. das Klavierspiel. Allerdings ging das Niveau der Schülerinnen meist nicht über einen mittelmäßigen Grad hinaus, was überwiegend wohl nicht an den Schülerinnen lag.
„Oft in Hinblick auf einen Gatten, der vielleicht weder Künste noch Bälle lieben würde, und am tag nach der Hochzeit das Klavier abschaffen, die Bleistifte wegwerfen, die Tänze untersagen würde...Niemals hat man uns in der Musik oder im Zeichnen anders als das banalste Zeug gelehrt“ (d’Agoult, zit. nach: Rieger, 1981, S.61). Frauen wurden „diskriminiert durch die Festlegung ihrer Rolle als Repräsentierende sowie durch die Art der Halbbildung.“ (Rieger, 1981, S.62) Es ging lediglich um „pseudo-künstlerische Attribute“ „zwecks Einheiratung in bessere Kreise“ (Rieger, 1981, S.67). Oder man hoffte, dass sich unverheiratete Frauen in der veränderten wirtschaftlichen Situation ihre ökonomische Existenz durch Erteilung von Musikunterricht sichern konnten (siehe: Hoffmann, 1991, S.84). Die Folge war eine Art Teufelskreis: Es wurden immer mehr leicht spiel- und konsumierbare Werke (für Frauen) komponiert, und da diese nur eine geringe Fertigkeit erlangten und dementsprechend nur solche fragwürdigen Werke bewältigen konnten, wurde ihnen jedes Talent zum Begreifen vielschichtiger Musik abgesprochen. Es war daher nicht nötig, sie intensiver in Musik zu unterweisen usw. usf. ...
Kantor, Organist und Orchestermusiker waren Berufe, von denen Frauen ausgeschlossen waren. Ihnen blieb lediglich die Rolle der inspirierenden Muse. Wurden dennoch Abteilungen für Mädchen in neu gegründeten Musikinstituten geschaffen, waren diese meist auf Klavier und Gesang beschränkt. Ebenso gab es weniger Übungsstunden im Vergleich zum Stundenkontingent, das Jungen zugebilligt wurde. „Erst um 1820 erhielt die Mädchenförderung etwas Auftrieb.“ Allerdings einen recht fragwürdigen: „Für solche Drillmethoden, wie sie Logier und auch Fanny Schindelmeisser anwandten, schienen sich Mädchen besonders zu eignen. Es kam auch dem väterlichen Geldbeutel zugute, dass sie auf dem schnellen technischen Fortschritt basierten.“ (Rieger, 1981, S.69)
Versuche, von dieser Art Halbbildung an Schulen wegzukommen, bildeten sogenannte Realkurse für Frauen in Berlin. Die Ausbildung sollte vor allem drei Punkte enthalten: „die Schulung des log9ischen Denkens, das Anknüpfen an moderne Bildungsinteressen und die allgemeine Bildungsgrundlage für sowohl gewerbliche oder kaufmännische Berufe als auch für die Universität.“ (Rieger, 1981, S.63f) dabei trat leider gerade die musisch-ästhetische Bildung in den Hintergrund. „Es wurde als Fortschritt bewertet, dass das Fach fehlte.“ (Rieger, 1981, S.64) Solche Gedanken waren jedoch Ausnahmen (‚Zum Glück’ für die musikalische Bildung? ‚Leider’ für die anspruchsvolle Bildung von Frauen und Mädchen?).
Tatsache ist, dass in allen anderen Bildungseinrichtungen die Musik eine relativ wichtige Rolle spielte. Ihre Bedeutung wird allerdings herabgewürdigt durch den Endzweck, dem sie letztlich diente. Mit ihrer Hilfe sollten Frauen und Mädchen an ihre spätere Aufgabe als Hausfrau und Mutter herangeführt werden, sie sollten durch Musik „an sich selbst die Schönheit“ darstellen (Schmidt, zit. nach: Rieger, 1981, S.64). Jeder weitergehende Ehrgeiz oder gar Virtuosentum waren als „unweiblich“ und verachtenswert zu verurteilen. Das „würdigt die Musikerziehung zu einem manipulierenden Medium herab.“ (Rieger, 1981, S.65) Aber auch diese Eigenschaft von Musik, die ja für die männliche Gesellschaft von recht großem nutzen war, konnte nicht verhindern, dass der Musikunterricht an Bedeutung verlor. Durch bestimmte ökonomische Verhältnisse, „die eine Ausbildung der kognitiven Fähigkeiten der Frauen unabdingbar werden ließen.“ wurde die musische Bildung zusätzlich zurückgedrängt. (ebd.) Die Ausnutzung der Musik zur „Erziehung“ der Frau und die daraus resultierenden negativen Einstellungen von Frauenrechtlerinnen zu dieser Art musisch-ästhetischem Unterrichts taten ihr Übriges.
Diese Entwicklung setzte sich auch im 20.Jahrhundert fort. Besonders mittelständige Frauen waren durch die ökonomische Situation gezwungen, einer Arbeit außer Haus nachzugehen. Das machte eine erweiterte Mädchenschulbildung notwendig. Es wurden aber immer noch die alten Gründe als „Entschuldigung“ dafür herangezogen: Ein Mann müsse „von der Gattin einen höheren Bildungsgrad verlangen können. Diese sollte imstande sein, ihm ein verständiges Ohr zu bieten.“ (Rieger, 1981, S.76) Es ging nicht um eine Gleichberechtigung der Frau oder um eine geistige Bildung der Frau um ihrer selbst willen, sondern es ging um wirtschaftliche Interessen, dass keine „für die Gesamtheit wertvolle Frauenarbeit brachliegt.“ (Bierther/Kuwertz, zit. nach: Rieger, 1981, S.75) Daneben gab es zum Glück auch Bewegungen, die für die Frauen „volles Bürgerrecht und Bürgerpflicht in der geistigen und sozialen Kultur“ forderten (Rieger, 1981, S.75f). In der allgemeinen Mädchenschulbildung wurden Mathematik und andere Naturwissenschaften verstärkt unterrichtet, z. T. wurde dadurch das Fach Musik ganz aus dem Lehrplan verdrängt. Erfreulicherweise (für das Fach Musik) gab es andererseits bestimmte Strömungen, die den Musikunterricht so pädagogisch erneuerten, dass - „zumindest auf dem Papier – die Ziele der Mädchenbildung im Fach Musik denen der Jungenbildung gleichgestellt“ waren (Rieger, 1981, S.77). Die Lehrerinnenbildung erfuhr eine Verbesserung: Immer mehr Frauen konnten studieren, wurden geprüft und durften an allgemeinbildenden und höheren Schulen unterrichten. Aber auch hier gab es immer noch geschlechtsspezifische Trennungen, z. B. in der Prüfungsordnung: Während Männer zur Prüfung eine Komposition vorzeigen mussten, wurde von Frauen nur eine Bearbeitung eines Werkes verlangt. „Man hielt Frauen nicht für befähigt, zu komponieren. Aus welchem Geist diese Annahme stammt, ist ungewiss: Es konnte sich entweder um die praktische Erwägung handeln, dass man Frauen bisher kaum das kompositorische Handwerk gelehrt hatte, oder um die ideologische Annahme, dass Frauen zum komponieren von Natur aus außerstande sind.“ (Rieger, 1981, S.79).
Zeitgleich setzte die Jugendmusikbewegung ein, und mit ihr gewannen die Mädchen ein Stück Freiheit: „Sie, die eingezwängt gewesen waren in rigide Familiennormen, hatten erstmals die Chance, auszubrechen, ohne moralisch verfemt zu werden.“ (Rieger, 1981, S.81) Allerdings, merkt Eva Rieger an, war auch dies Freiheit nicht vollkommen. Sie war um den Preis einer gewissen „Asexualität“ erkauft, die sich die Mädchen aneigneten. Das war eine der moralische Auswirkungen der Vergangenheit, eine Reaktion auf die immer noch herrschenden Konventionen. Jeder größere Schritt der Emanzipation hätte wahrscheinlich eine Revolution zur Folge gehabt, die damals noch nicht verkraftbar gewesen wäre (siehe: Rieger, 1981, S.92).
Eine eigene Episode bildet die Zeit der Naziherrschaft zwischen 1933 und 1945. Sie bedeutete für die Frau einen Rückschritt in quasi vor – industrielle Zeiten. Aus ökonomischen Gründen war sie zwar auch zur Arbeit außer Haus angehalten, aber nur zu solcher, die auch ihrem „Wesen“ entsprach. Sonst bestanden ihre Aufgaben im Kindergebären für den Führer und sie hatte sich „dem männlichen Alleinanspruch unterzuordnen.“ (Rieger, 1981, S.92) „Als vorzügliches Instrument zur Disziplinierung der Massen erwies sich die Hausmusik, da sie nach mehreren Richtungen gleichzeitig wirkte. Man erhoffte sich sowohl eine Gesundung der Volksseele, die an der amerikanischen Tanzmusik „erkrankt“ war, als auch eine Stabilisierung der Familiensituation.“ (Rieger, 1981, S.94) – also auch die Stabilisierung der bereits genannten Rolle der Frau als „Gebärmaschine“ und unterwürfige Ehefrau. Auf den Musikunterricht wirkte sich das durch eine bewusste Polarisierung von „männlich“ und „weiblich“ aus: hier die Aspekte des „Männlich – Soldatischen“, dort das „Weiblich – Gemütvolle“ (ebd.). Während Jungen in der Hitlerjugend auf Blasinstrumenten unterrichtet wurden, blieb den Mädchen meistens nur „die körperliche Darstellung musikalischer Abläufe“ vorbehalten (Auch deshalb besteht bis heute das sehr „männliche Image“ von Blasinstrumenten in Deutschland.) (ebd.).
Der letzte Teil dieses geschichtlichen Diskurses behandelt die Nachkriegsituation zwischen 1945 und 1980. Dabei zeigt Eva Rieger die Möglichkeiten „offner und vor allem versteckter Art“ der Diskriminierung auf (Rieger, 1981, S.97). (Diese werden wohl auch zur Bildung meiner anfangs erwähnten Vorurteile beigetragen haben.) Durch den gemischtgeschlechtlichen Unterricht war zumindest formal eine Gleichberechtigung gegeben ( was leider nicht immer auf den tatsächlichen Verlauf eines Unterrichts schließen lässt). Um ein Beispiel für unbewusste Meinungsbildung zu geben, untersuchte Eva Rieger den Aufbau von Unterrichtsmaterial im Fach Musik. (Wenn ich hier weitgehend Zitate verwende, so deswegen, weil sie in ihrer Prägnanz für sich sprechen.)
„Die Komponisten- bzw. Werkauswahl ist ja eine spezifische, die dazu dienen soll, dem Schüler ein bestimmtes Geschichtsbild, und damit verbunden, Wertvorstellungen sozialer, moralischer und ästhetischer Art zu vermitteln. Sowohl Inhalte als auch die Aussparungen lassen demnach Rückschlüsse über das zu vermittelnde Bild zu.“ (Rieger, 1981, S.97f)
„Dass mit solchem männlich geprägtem Geschichtsbild gerade Mädchen nicht viel anfangen können, braucht kaum betont zu werden. Die männlichen Komponisten werden zu göttlichen Wesen.“ (Rieger, 1981, S.98)
Auch im angebotenen Liedgut finden sich hauptsächlich besungene männliche Berufe.
„ Für den unbefangenen Leser muss sich der Schluss aufdrängen, dass Frauen unkünstlerisch, unschöpferisch und auf jeden fall dem Mann geistig – künstlerisch unterlegen sind.“ (Rieger, 1981, S.100)
„Und auch dort, wo Frauen erwähnt sind, werden sie auf ihre Dienstfunktion für den Mann eingeengt. Clara Schumann wird nicht als weltberühmte Pianistin oder gar Komponistin dargestellt, sondern wir finden ein Zitat von ihr, in dem sie Brahms lobt...“ (ebd.).
„Mädchen lernen durch solche gedankenlos verwendeten Passagen, dass Kunst und Kultur vom Mann auszugehen haben.“ (Rieger, 1981, S.101)
„Auch bildliche Darstellungen können ideologieprägend wirken. In einem didaktischen Angebot von Liedern und Volksmusik aus der Tschechoslowakei sind 24 mal musizierende Männer abgebildet. Frauen fehlen völlig, so dass der Schüler (und besonders die Schülerin, Anm. d. A.)glauben muss, dass die Volksmusik ausschließlich von Männern verwaltet wird.“ (Rieger, 1981, S.102)
„Man mag diese spontan herausgegriffenen Beispiele als übertrieben hinstellen. Gerade aber, weil die Benachteiligung der Frau oft äußerst subtil vor sich geht, sollte mit gleicher Subtilität nach Spuren sexistischen Denkens und Handelns gesucht werden.“ Es ist anzunehmen, „dass sexistische Normen unbewusst und unverarbeitet aufgenommen werden, um in die Überzeugung von weiblicher Minderwertigkeit und männlicher Überlegenheit zu münden.“ (ebd.)
Als Lösungswege nennt Rieger:
- Hinweise in Schulbüchern auf Rollenstereotypen;
- Die „grundsätzliche Abschaffung der Lieder, die die geschlechtsspezifische Rollenverteilung unterschwellig oder offen vermitteln“ (Rieger, 1981, S.103);
- Proportional gleichen Geschlechteranteil in Liedern und Bilddarstellungen;
- Diskussionen zu diesem Thema in den höheren Klassenstufen.
Es ist ebenso wichtig, dass Frauen und Mädchen eine besondere Förderung erhalten und nicht nur formal auf eine umzusetzende Gleichberechtigung hingewiesen wird. Und nicht zuletzt müssen sich die Institutionen und Hochschulen in ihrer Sichtweise umstellen, wo die leitenden Positionen immer noch eine Domäne der Männer sind. „Nur wenn die institutionellen Einrichtungen parallel zu den ideologischen Verfestigungen ins Wanken geraten, besteht Aussicht auf Veränderung.“ (Rieger, 1981, S.103)
Für einen Satz muss ich als Studentin mit dem Hauptfach Blockflöte Eva Rieger allerdings heftig kritisieren: „...Jungen interessieren sich für das Schlagzeug und Blasinstrumente, während Mädchen meist mit der Blockflöte abgespeist werden, einem in jeder Hinsicht begrenzten Instrument...“ (ebd.; Hervorhebung: J.K.). Sie bedient sich hier der gleichen Mechanismen wie die Männer, die sie kritisiert. Sie bringt ein (wahrscheinlich nicht weiter hinterfragtes) Vorurteil an, dass sich so weiterhin in den Köpfen der unwissenden LeserInnen bestätigt und verstärkt. Hier fehlt mir wiederum die Biographie der Autorin (wirklich ein bedauerliches Versäumnis des Verlages), um zu erfahren, inwieweit es Eva Rieger möglich gewesen wäre, Informationen zum professionellen Blockflötenspiel zu erlangen und ihr Urteil über dieses Instrument zu revidieren. Frans Brüggen oder Hans-Martin Linde können 1981 auch in Musikerkreisen, die sich nicht hauptsächlich mit der Blockflöte beschäftigen, zumindest keine völlig unbekannten mehr gewesen sein. Oder sollte ich mich so im Bekanntheitsgrad von Blockflötisten oder auch der Alten-Musik-Bewegung in den 80er Jahren täuschen?
Niemand ist davor gefeit, etwas Falsches zu behaupten, wenn man/frau es nicht anders kennt und/oder der vollen Überzeugung von der Richtigkeit einer Behauptung ist. (das zeigt sich besonders bei diesem Thema.) Und deshalb ist es immer wieder wichtig, sich selbst und seine Ansichten so oft wie möglich zu reflektieren und kritisch zu hinterfragen, um herauszufinden, ob die eigenen (Vor-)Urteile gerechtfertigt sind.
4. ZUR ENTWICKLUNG MÄNNLICHER WAHRNEHMUNGSMUSTER UND ZUR „SCHICKLICHKEIT“ VON MUSIZIERENDEN FRAUEN
Männliche Wahrnehmungsmuster im 18./19. Jahrhundert sind ein wichtiger Gesichtspunkt, wenn man/frau die Diskriminierung der Frau untersuchen möchte, denn diese Muster wirken heute noch fort. Den wichtigen, historischen Schritt zu den Entstehungsgründen konnte auch Freia Hoffmann nicht tun, wie sie selbst in ihrem Vorwort (S.13) sagt. Sie verzichtete – im Gegensatz zu Eva Rieger, wie bereits in der Einleitung erwähnt – auf psychologische Deutungsversuche. Aber ihre Analyse hilft, die allgemeine Denkweise der männlichen Gesellschaft aufzuschlüsseln und zu verstehen (d. h. nicht, sie gleichzeitig anzuerkennen oder gar zu akzeptieren).
„Es geht um einen Sachverhalt, der um 1800 besonders ausgeprägt war und bis heute weiterwirkt. Wahrnehmung und Beurteilung unterscheiden sich grundsätzlich , je nachdem, ob ein Produkt, eine Tätigkeit oder auch nur eine Haltung mit einem Mann oder eine Frau verbunden wird. Gleichgültig, um welchen Vorgang es sich handelt, ob ein Mensch durch einen Raum geht, ob jemand uns ein Erlebnis erzählt, ob jemand ein Bild malt, in der Öffentlichkeit ein Kind verprügelt oder ein Flugzeug entführt – wie ein solcher Vorgang gesehen wird, ist stark davon geprägt, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, die jeweils Subjekt, Gegenstand, Ziel, Opfer oder Adressat eines solchen Vorgangs ist.“ (Hoffmann, 1991, S.20)
Die Wahrnehmung bezieht sich meist auf fünf Sinne. Was den Frauen jedoch bürgerliche Reglementierungen beim Musizieren eingebracht hat, lässt sich allein auf den optischen Sinn zurückführen. Das ist insofern besonders traurig, weil es in der Musik eindeutig zuvorderst um den Hörsinn geht. Die Frau sollte „jederzeit den Idealen von Schönheit, Anmut und Jugend „entsprechen (Hoffmann, 1991, S.49). Dass es dabei nicht immer um rein Äußerliches ging, zeigt Johann Gottfried Herder: „Nur die Bedeutung innerer Vollkommenheit ist Schönheit.“ Sie „ist die natürliche Sprache der Seele durch unsern ganzen Körper“. (zit. nach: Hoffmann, 1991, ebd.) Leider wurde sein Ansatz nicht aufgegriffen.
Statt dessen legte das Bürgertum in Abgrenzung zum Adel auf das Wert, was der Theoretiker Carl Ludwig Junker „der Stand des Weibes ist Ruhe“ nennt (zit. nach: Hoffmann, 1991, S.31). Gewünscht wurde z. B. ein mehr oder weniger starres, freundliches, schönes Gesicht, was keine überschwänglichen Regungen zeigt. Dementsprechend war das „Grimassieren“ von Opernsängerinnen verpönt, und Instrumente wie Klarinette oder Horn galten deswegen für Frauen als „unschicklich“. Diese Forderungen wurden unterstützt durch die bewegungsfeindliche Mode („...Korsetts, Schnürleiber, enge Gürtel, hohe Kragen, aufgetürmte Frisuren, Stiefelchen, hohe Absätze,...“) (Hoffmann, 1991, S.46)) und durch „medizinische“ Geräte zur „Verbesserung“ der Körperhaltung, wie z. B. ein Gestell „zur Aufrichtung des Rückgrates“ und zur „Streckung der Wirbelsäule“ (siehe: Hoffmann, 1991, ebd.). Immer wieder taucht das „Gefühl des Unschicklichen“ auf (Junker; zit. nach: Hoffman, 1991, S.28). Dieses Gefühl drückt sich in drei verschiedenen Bereichen aus: Es sei erstens unschicklich, wenn eine Frau z. B. im Rock Cello spielt, mit weiten Ärmeln den Violinbogen heftig auf und ab bewegt oder mit aufgetürmter Haarpracht ins Horn bläst. Ein Widerspruch also zwischen Kleidung und Instrumentenwahl (siehe: Hoffmann, 1991, S.29ff). Genauso sei es für eine Frau unpassend bestimmte Instrumente zu spielen, weil die natürliche Konstitution des weiblichen Geschlechts ungleich schwächer sei als die des Mannes, ja deren ganzes Wesen nicht für das Spiel jener Instrumente vorgesehen sei. Viele erfordern kraftvolle, schnelle Bewegungen, denen eine Frau unmöglich gewachsen sein kann.
Es mutet geradezu kindisch an und ist quasi ein Beweis für die Unrichtigkeit solcher Behauptungen, dass es Frauen einfach untersagt wurde einen Gegenbeweis zu führen. Drittens – und das ist das eigentlich Empörende – werden Frauen für „Nebenideen“ verantwortlich gemacht, die beim männlichen Zuhörer entstehen, wenn sie beim Musizieren bestimmte Kleidung tragen oder eine bestimmte Körperhaltung einnehmen. Diese Nebenideen sind hauptsächlich sexuell zu verstehen: „...Ein Frauenzimmer spielt das Violoncell (Cello). Sie kann hiebey zwey Übelstände nicht vermeiden. Das Überhangen des Oberleibs, wenn sie hoch (nahe am Steg, vorn übergebeugt) spielt, und also das Pressen der Brust, und denn eine solche Lage der Füße(weit auseinander), die für tausend Bilder erwecken, die sie nicht erwecken sollen; sed sapienti sad (aber genug für den Wissenden)...“ (Junker; zit. nach: Hoffmann, 1991, S.35).
Zum Glück lässt Freia Hoffmann noch einen anderen Theoretiker – Hans Adolf von Eschstruth – zu Wort kommen, der den Glauben an „das Gute im Mann“ wieder ein wenig hebt. Er kritisiert in erfrischend logischer Weise die damalige Mode – auch wenn seine Intention eher die eines fortschrittlichen Bürgers war, der sich vom Adel absetzen möchte, als dass er der Frauenemanzipation voranhelfen wollte. Zu den „Nebenideen“ von Junker schreibt er: „Alle musicalischen Instrumente sind für’s or und Herz, nicht für’s Auge, und wenn die
Musik auf uns wirkt wi si sol, so müssen wir vergessen wi di Töne, di uns entzücken, erzeugt werden...Wessen sitliches Gefül durch di Wollust erst so erstikt ist, daß er wärend der Musik iren (ihren) Eingebungen nachhängt, der wird bei ser vilen unschuldigen Gegenständen Arges in seinem Herzen denken; selbst beim Gottesdinst und Gebät werden sich wollüstige Ideen einmischen, und di Andacht stören...“ (zit. nach: Hoffmann, 1991, S.36f). Leider setzten sich die Ansichten Junkers durch und das Bürgertum trachtete nach einer Übereinstimmung zwischen dem normierten Wesen der Frau und deren Musikausübung. Der Vorwurf Junkers, dass bei musizierenden Frauen sexuelle Nebenideen entstehen können, entspringt der bürgerlichen Abwehr von sexuellen Bedürfnissen. Die christliche Kirche mit ihrer Vorstellung der „fleischlichen Sünde“ hat an dieser starren Einstellung zur Sexualität einen entscheidenden Anteil.
Die damalige Mode betonte zwar die Weiblichkeit, aber versteckte gleichzeitig auch „die Beine als möglicherweise (sexuell) aktive Körperteile...“ (Hoffmann, 1991, S.56). An den „schicklichen“ Instrumenten waren dementsprechend kaum Körperbewegungen notwendig, die sinnliche Versuchungen provoziert hätten. (Eine Ausnahme bildeten das Theater und die Oper, „wo Sinnlichkeit erwünscht und erotische Aktivität und Kontaktaufnahme von beiden Seiten erlaubt waren.“ (Hoffmann, 1991, S.56f)) Besonders die gespreizte Beinhaltung galt es zu verhindern. Viele Frauen, die es trotzdem wagten, z. B. mit dem Cello, öffentlich aufzutreten, wurden deshalb oft ins „Übersinnliche“ gehoben und als „unsexuell“ rehabilitiert (siehe: Hoffmann, 1991, S.61). (Ähnliches beschreibt ja auch Eva Rieger im Zusammenhang mit der Jugendmusikbewegung. (s. S. 9 dieser Arbeit))
Zum Glück gab es immer wieder Frauen, die sich den Normen widersetzten und öffentlich und professionell auftraten, und sei es „nur“ mit „Frauenzimmer-Instrumenten“. Ausnahmen der bestehenden Verbote bildeten auch die sogenannten Wunderkinder. Trotz der Ansicht, Kinder wären „kleine Erwachsene“, galten sie damals als geschlechtslose Wesen. Mädchen war es deshalb auch erlaubt, „unschickliche“ Instrumente zu spielen (Hoffmann, 1991, S.85).
Durch die beständig wachsende zahl von reisenden, konzertierenden Musikern war der Markt bald gesättigt. Es bedurfte immer neuer Attraktionen, um die Konzertsäle zu füllen. Diesen umstand konnten ebenfalls Frauen für sich nutzen „in dem sie eben das Ungewöhnliche und Anstößige präsentierten.“ Und so „von der Reglementierung durch die bürgerliche Ideologie“ profitierten (Hoffmann, 1991, S.87).
Wer eine Instrumentalistin oder einen Instrumentalist mit ihrem/seinem Instrument betrachtet, „betrachte auch die Beziehung zweier Körper zueinander.“ (Hoffmann, 1991, S.63) Musikinstrumente sind schon in vorchristlichen Kulturen als „selbstverständliches Abbild und Symbol des menschlichen Körpers oder seiner Teile“ gesehen worden (ebd.). Aufgrund der daraus entstehenden Geschlechtlichkeit mancher Instrumente dürfen diese bei einigen Völkern der dritten Welt auch heute noch nur von Männern oder nur von Frauen gespielt werden. Deswegen war z. B. das Spielen der Gitarre für Frauen erlaubt, da es mit dem Wiegen eines Kindes im Schoß assoziiert wurde und diese „körperliche Beziehung zwischen Mutter und Kind nicht tabuisiert ist.“ (Hoffmann, 1991, S.64) Beim Klavier besteht zum Organ der Tonerzeugung – im Gegensatz zu Streich- oder Blasinstrumenten – eine größere Distanz und es „eignet sich zur sinnlichen Objektbildung recht wenig.“ (Hoffmann, 1991, S.65) Wenig verwunderlich also, wenn Frauen an Instrumenten wie Geige oder Klarinette – die wohl eher sinnliche Objekte sein können – als „unschicklich“ empfunden wurden. So ist eine Folgerung, dass es nur halb richtig ist, „wenn Frauen ihre Rolle als ‚(Sexual-)Objekt’ aufkündigen.“ Wichtiger ist es als weiteren Schritt, zu lernen, „Subjekt zu sein und selbst Objekte zu bilden in dem Sinn, ‚sich selbst in ein aktives Verhältnis zur Welt zu setzen’.“ (Sichtermann; zit. nach: Hoffmann, 1991, S.64)
5. MÖGLICHE URSACHEN DER DISKRIMINIERUNG
Warum haben „Männer so viel Zeit und Energie darauf verwandt, Frauen den Zugang zu Kunst und Wissenschaft zu verwehren.“ (Rieger, 1981, S.56)? Einerseits benötigt man die Frau, „um durch sie Kraft zu schöpfen.“ Andererseits entsteht in „dem Augenblick, wo die Frau selbst etwas fordert, oder wo sie es wagt, sich auf eine Stufe mit ihm zu stellen“ Angst (ebd.). Also eine große, kollektive Angst unter Männern? Woher sollte sie rühren? Ist die Folge dieser Angst der Zwang (oder die Sucht) von Männern nach Überlegenheit über die Frau? Eva Rieger versucht die Gründe auf zwei verschiedenen Ebenen zu finden: „zum einen hatten die männlc8ihenBürger durch den Kampf um das ökonomische Überleben in der kapitalistischen Gesellschaft bestimmte Eigenschaften ihres Wesens verloren; sie verlangten nun, dass die Frauen dafür kompensierten. Da dies auf partnerschaftlichem Wege nicht denkbar war, mussten unterdrückerische Methoden praktiziert werden. Die Frau durfte nur geben, nehmen durfte sie nicht. Wagte sie s dennoch, war sie sich der männlichen Verachtung sicher.“ (Rieger, 1981, S.57f) Dieses Argument erscheint mir recht einsichtig, ich kann es aber trotzdem nicht als „Universalursache“ akzeptieren (als die es sicher auch nicht gedacht ist). Es klingt zu sehr nach einer Entschuldigung, nach: „Das System war schuld.“ Oder wie ein natürlicher Prozess, den Männer nicht steuern bzw. dem sie nicht genug gegensteuern konnten oder wollten. Der Gedanke von Frau Rieger kann ein Ansatz, eine (vorläufige) Antwort für die Ursachenforschung sein. Es ist aber hoffentlich auch ein Anreiz, weitere Antworten zu suchen, vielleicht in einer konstruktiven, fruchtbaren Diskussion innerhalb einer Vorlesung oder eines Seminars. (An der HdK werden Seminare, die sich u. a. mit diesem Thema beschäftigen, glücklicherweise angeboten, z.B. von Beatrix Borchard. Aber es ist traurig, dass angesichts eines Falles von sexueller Belästigung in der Fakultät Musik das Interesse für die Veranstaltung „gender - talk“ im Sommersemester 1999 so gering ist, dass sie z. Z. noch nicht stattfindet.)
In der zweiten ebene, die Eva Rieger anspricht, lassen sich weniger schlüssige Gründe für die „Angst vor der Frau“ finden. Sie berichtet zwar, wie Frauen verstärkt eine „Teilnahme an Kunst und Wissenschaft“ forderten (ebd.) und wieder vom Mann zurückgedrängt wurden bzw. sich zurückdrängen ließen, aber diese Forderungen der Frauen waren ja schon Auswirkungen und Reaktion auf die Unterdrückung in der männlichen Gesellschaft. Dieses Argument gibt also weniger zufriedenstellend eine Erklärung für die Diskriminierung.
Auch bei Freia Hoffmann finden wir die Vermutung, dass eine „Angst“ dazu geführt hat, dass die „Auswahl der ‚Frauenzimmer-Instrumente’ so dürftig ausgefallen ist (...). Weibliche Kraft, Beweglichkeit, Energie, Ausdrucksvielfalt, Sinnlichkeit und Sexualität haben auf die bürgerliche Männergesellschaft offenbar bedrohlich gewirkt. Jedenfalls mussten die Frauen diese Seiten in sich soweit niederhalten und verstecken, wie es das ökonomische, soziale und psychische System der bürgerlichen Gesellschaft verlangte.“ (Hoffmann, 1991, S.73)
5.1. POLARISIERUNG DER GESCHLECHTSCHARAKTERE
Was bei Luther begann und bei Pestalozzi und Rousseau weitergeführt wurde, ist die Verbindung von bestimmten Eigenschaften mit einem Geschlecht. Die „Natur der Frau (wurde)...um 1800...ideologisch“ festgelegt (Hoffmann, 1991, S.73). „Die ‚Natur der Frau’ war nichts anderes als die Summe der Eigenschaften, die sie zur Erfüllung ihrer Pflichten in dem neuen ökonomischen System brauchte. Die Trennung zwischen männlichem Erwerbsleben und weiblichem Wirken in der Familie führte zu einer Polarisierung der ‚Geschlechtscharaktere’ (Außen und Innen, Aktivität und Passivität, Tun und Sein, Rationalität und Emotionalität)...“ (ebd.). „Im 19./20. Jahrhundert wird das gesellschaftlich gewünschte Verhalten ‚als Wesensmerkmal in das Innere der Menschen verlegt’...“ (Hausen; zit. nach: Hoffmann, 1991, S.73) Es erscheint eine große Anzahl von Werken, die dieses Thema behandeln. Eva Rieger stellt einige von ihnen in Auszügen vor, und mir blieb nach dem Lesen der Texte nichts als Sprachlosigkeit angesichts solcher verbalen Gewalttaten, die man den Frauen angetan hat.
„Die Vertreter des neuen Humanitätsideals wie Kant und Rousseau lehnten eine Umsetzung ihrer Gedanken auf die Frauenerziehung ab. Es scheint, als wäre die Angst vor der Konkurrenz, vor der Auflösung der Familie bzw. vor dem Verlust weiblicher Werte stärker als der verbale Anspruch auf Humanität.“
Freia Hoffmann bringt eine andere, wichtige Idee mit in die Diskussion: die Annahme von der Polarisierung der geschlechtlichen Wesensmerkmale ist keine vollständige: Wir wissen von der zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert (im frühen Bürgertum), die u. a. von der „Sturm -und - Drang“ - Periode gekennzeichnet war, „dass Männer durchaus Gefühle der Einsamkeit, der Trauer, des Schmerzes, der Erschütterung und des Entzückens zugelassen und gemeinsam ausgedrückt haben.“ (Hoffmann, 1991, S.74) Der Mann durfte also auch seine „weiblichen“ Seiten ausdrücken. Der Frau dagegen stand „nur ein Teil der Ausdrucksskala“ zu (ebd.). Es gab keinen Bereich, der nur ihr allein vorbehalten war. Das widerlegt in gewisser Weise das erste Argument von Eva Rieger.
Mir stellt sich nun immer noch die Frage: Warum? Ich kann mir keine andere Antwort geben als: eben aus Angst. Aber warum gerade Angst beim „starken Geschlecht“? Es scheint leider keine Angst von der Art zu sein, die hilfreich sein kann, eine Problem zu lösen, sondern eher eine größere, behindernde Angst, der Man(n) nicht auf den grund geht. Seine Versuche, diese Angst zu kompensieren (sprich: die Frau zu diskriminieren), müssen deswegen zwangsläufig fehlschlagen, weil sie den Kern der Sache nicht treffen. Was fehlte man(n) an Vertrauen auf sich selbst und auf die eigene Kraft, was fehlte an innerer Sicherheit, dass Männer zu solchen drastischen Mitteln griffen? Und wie konnte sich das auf etliche folgende Generationen des männlichen Geschlechts derart ausprägen?
6. SCHLUSSBEMERKUNGEN
Was ist „weiblich“? Was ist „männlich“? Gibt es bestimmte Grundstimmungen und Eigenschaften im Wesen der Geschlechter, die entgegengesetzt zueinander sind? Und das von Natur aus? Ist es legitim von „der“ Frau und „dem“ Mann zu sprechen? Ist dieses Rollenproblem eines der Sprache? Ist es ein Spezifikum der deutschen Sprache, „männlich“ und „weiblich“ mit bestimmten Eigenschaften (z.B. hart, laut, aktiv bzw. weich, passiv, leise) zu assoziieren? Wurde nur in Deutschland „...das gesellschaftlich gewünschte Verhalten ‚als Wesensmerkmal in das Innere der Menschen verlegt’...“ (Hausen; zit. nach: Hoffmann, 1991, S.73)?
Gibt es diese Unterteilung und Assoziationsmöglichkeiten auch in anderen Sprachen? Ist diese „Vertypisierung“ und gleichzeitige Wertung auf der ganzen Welt gleich? Oder gibt es Völker, bei denen es zwar „männlich“ und „weiblich“ gibt, nicht aber gleichzeitig entsprechende Eigenschaften assoziiert werden? Das sind die fragen, die sich mir während und nach dieser Arbeit stellten. Ich konnte sie erfreulicherweise mit FreundInnen und Bekannten sehr anregend diskutieren. Es war mir auch möglich, Sätze zu entkräften wie: „Wären Frauenkompositionen wirklich gut, hätten sie sich doch schon längst durchgesetzt.“ Beide Bücher haben mir dafür eine Reihe interessanter und schlagkräftiger Argumente geliefert. Für diese bereicheru8ng meines Wissens bin ich sehr dankbar.
Wenn man/frau eine Veränderung der gesellschaftlichen Situation wünscht, in bezug auf die Diskriminierung von Frauen in der Musik – oder auch anderswo – dann ist es wichtig, dass jeder sich selbst al eigenständige, ganze Person begreift, die sich nur selbst vervollkommnen kann. Eine zweite Person kann niemals etwas Fehlendes wirklich kompensieren oder vervollständigen. Es ist meist auch nicht eine Frage von „weiblich“ oder „männlich“, sondern von „menschlich“. Veränderungen gehen oft sehr langsam vonstatten und pendeln möglicherweise auch in entgegengesetzte Extreme. Aber es ist – um einen Ausdruck aus der Musik zu benutzen – wie das Stimmen zweier Instrumente: Um sich auf einen Ton einzuschwingen, pendelt frau/man zwangsläufig zwischen den Extremen „zu hoch“ und „zu tief“ hin und her, nähert sich aber stetig an, um schließlich „zu stimmen“ und miteinander zu harmonieren.
Und dann kann Musik beginnen...
7. LITERATURANGABEN
- Rieger, Eva: Frau, Musik und Männerherrschaft. Zum Ausschluss der Frau aus der deutschen Musikpädagogik, Musikwissenschaft und Musikausübung. Ullstein: Frankfurt/M., Berlin, Wien, 1981
- Hoffmann, Freia: Instrument und Körper. Die musizierende Frau in der bürgerlichen Kultur. Insel Verlag: Frankfurt/M., Leipzig, 1991
- Istvanffy, Tibor: Das „Cottbuser Modell”. In: Üben und Musizieren 2/1998 Schott Verlag: Mainz, 1998
- Leon, Donna: „Ein triviales Spielchen“. In: Leon, Donna: Latin Lover. Diogenes Verlag: AG Zürich, 1999
Zitate
„Menschen beginnen nicht mit Taten, sondern mit Worten, Worten wie diesen. Und Worte spiegeln eine vorhandene Einstellung wider. Wen man „nigger“ nennen darf, den lyncht man umso leichter. Und wenn es nur „un trivialissimo gioco erotico“ (ein triviales Sexspielchen; J.K.) ist, darf man die Frau getrost vergewaltigen...“
„Frauen waren jahrhundertelang ein Vergrößerungsspiegel, der es den Männern ermöglichte, sich selbst in doppelter Lebensgröße zu sehen.“
„Man wird nicht als Frau geboren, man wird zur Frau gemacht.“
„Welche Hürden sich euch entgegenstellen, es liegt in eurer Macht, sie zu überwinden. Ihr müsst nur wollen.“
„Was immer Frauen anfangen, sie müssen doppelt so gut sein als man von Männern erwartet. Gottseidank ist das kein Problem.“
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit über die Geschichte der Musikausbildung und -ausübung von Frauen und Mädchen?
Die Arbeit untersucht die Geschichte der Musikausbildung und -ausübung von Frauen und Mädchen, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Diskriminierung und Unterdrückung von Frauen in diesem Bereich gelegt wird.
Welche zwei Bücher sind die Hauptquellen für diese Arbeit?
Die Arbeit stützt sich hauptsächlich auf zwei Bücher: "Frau, Musik und Männerherrschaft" von Eva Rieger und "Instrument und Körper. Die musizierende Frau in der bürgerlichen Kultur." von Freia Hoffmann.
Welche Intention hatte Eva Rieger mit ihrem Buch?
Eva Rieger wollte einen historischen Überblick über die Situation des Mädchens im musikpädagogischen Sektor geben und das Ausmaß der Vormachtstellung des Mannes in der musikalischen Kultur untersuchen.
Was war Freia Hoffmanns Ziel bei der Untersuchung der Rolle von Frauen und Musikinstrumenten?
Freia Hoffmann versuchte, Gründe für die oft problematische Beziehung von Frauen zu Musikinstrumenten zu finden und die Vorgeschichte aufzuarbeiten, wobei sie die herrschenden Wahrnehmungsmuster analysierte und den weiblichen Widerstand gegen das Diktat der "Schicklichkeit" untersuchte.
Welchen historischen Zeitraum betrachtet die Arbeit hauptsächlich?
Die Arbeit konzentriert sich hauptsächlich auf die Zeit ab 1750 bis ins 19. Jahrhundert, wobei die Situation der bürgerlichen Frau im deutschsprachigen Raum und die sogenannte E-Musik im Vordergrund stehen.
Wie sah die musikalische Bildung von Frauen im Mittelalter aus?
Im frühen Mittelalter gab es Unterschiede zwischen der Mädchen- und Jungenbildung, besonders in den unteren Schichten. Adlige Töchter erhielten jedoch oft einen Unterricht, der dem der Knaben gleichgestellt war, und Frauenklöster fungierten als Erziehungsanstalten.
Welche Rolle spielte die Kirche bei der Musikausbildung und -ausübung von Frauen?
Die Kirche spielte eine widersprüchliche Rolle, da sie einerseits die Ausgrenzung der Frau von gesellschaftlichen Machtpositionen begann, andererseits aber auch viele Komponistinnen aus den Klöstern hervorgingen.
Wie veränderte sich die Rolle der Frau im 17. Jahrhundert?
Im 17. Jahrhundert verfestigte sich das Großbürgertum, und die Rolle der Frau als Mutter, Ehefrau und Haushälterin wurde wichtiger, was eine musische und kognitive Ausbildung weniger notwendig machte. Berufsmusiker entstanden, und Frauenzünfte zerfielen, was Frauen die wenigen Machtpositionen nahm, die sie besessen hatten.
Welche Rolle spielte Musik im 18. Jahrhundert für Frauen?
Im 18. Jahrhundert wurde Musik zur bürgerlichen Lieblingskunst, und die Frau sollte durch Musik für die Regeneration des Ehemannes sorgen. Musik wurde als Mittel angesehen, Frauen an das Haus zu fesseln, und der Unterricht sollte der "Wertsteigerung" für eine spätere Heirat dienen.
Welche Instrumente galten als "schicklich" für Frauen und warum?
Instrumente wie Laute, Zither, Harfe und Klavier galten als "schicklich", während andere, wie Klarinette, Flöte und Cello, als "unschicklich" galten, da sie angeblich körperliche Anstrengung erforderten oder sexuelle Assoziationen hervorrufen konnten.
Wie wirkte sich die Industrialisierung im 19. Jahrhundert auf die Rolle der Frau aus?
Mit der Industrialisierung wurden die Pflichten einer Ehefrau reduziert, aber die Ideologie von ihrer "natürlichen Bestimmung" wurde aufrechterhalten. Das Ideal der passiven Frau als Schmuck- und Präsentationsstück entstand.
Welche Bedeutung hatten Pensionate und höhere Töchterschulen für die musikalische Bildung von Frauen?
Pensionate und höhere Töchterschulen wurden als Statussymbole für die Familie betrachtet. Klavierspiel war ein fester Bestandteil der Ausbildung, aber das Niveau der Schülerinnen ging meist nicht über einen mittelmäßigen Grad hinaus.
Wie wurden Frauen in der Lehrerausbildung diskriminiert?
In der Lehrerausbildung mussten Männer zur Prüfung eine Komposition vorzeigen, während von Frauen nur eine Bearbeitung eines Werkes verlangt wurde, da man Frauen nicht für befähigt hielt zu komponieren.
Welche Rolle spielte die Naziherrschaft zwischen 1933 und 1945 für die Frau?
Die Naziherrschaft bedeutete für die Frau einen Rückschritt. Ihre Aufgaben bestanden im Kindergebären für den Führer, und sie hatte sich dem männlichen Alleinanspruch unterzuordnen. Die Hausmusik diente der Disziplinierung der Massen und zur Stabilisierung der Rolle der Frau als "Gebärmaschine".
Wie sah die Situation der Frau nach 1945 aus?
Nach 1945 gab es formale Gleichberechtigung, aber versteckte Diskriminierung blieb bestehen. Schulbücher und Unterrichtsmaterialien vermittelten oft ein männlich geprägtes Geschichtsbild und stellten Frauen in Dienstfunktion für den Mann dar.
Welche Lösungswege werden vorgeschlagen, um die Diskriminierung von Frauen zu überwinden?
Es werden Hinweise auf Rollenstereotypen in Schulbüchern, die Abschaffung von Liedern, die die geschlechtsspezifische Rollenverteilung vermitteln, proportional gleicher Geschlechteranteil in Liedern und Bilddarstellungen und Diskussionen zu diesem Thema in den höheren Klassenstufen vorgeschlagen.
Was wird über männliche Wahrnehmungsmuster im 18./19. Jahrhundert gesagt?
Die männlichen Wahrnehmungsmuster im 18./19. Jahrhundert, die sich in der Bewertung von Produkten und Tätigkeiten je nach Geschlecht unterscheiden, wirken bis heute fort. Besonders der optische Sinn spielte eine Rolle, wobei Frauen den Idealen von Schönheit, Anmut und Jugend entsprechen sollten.
Welche Ursachen für die Diskriminierung von Frauen werden genannt?
Als Ursachen werden die Angst der Männer vor der Konkurrenz, die Notwendigkeit der Frau zur Kompensation der im kapitalistischen System verlorenen Eigenschaften des Mannes und die Polarisierung der Geschlechtscharaktere genannt.
Welche Fragen bleiben am Ende der Arbeit offen?
Offen bleiben Fragen wie: Was ist "weiblich"? Was ist "männlich"? Gibt es bestimmte Grundstimmungen und Eigenschaften im Wesen der Geschlechter, die entgegengesetzt zueinander sind? Und das von Natur aus?
- Citar trabajo
- Juliane Kühne (Autor), 1999, Geschichte der musikalischen Frauenbildung. Musikausübung und -ausbildung von Frauen und Mädchen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109971