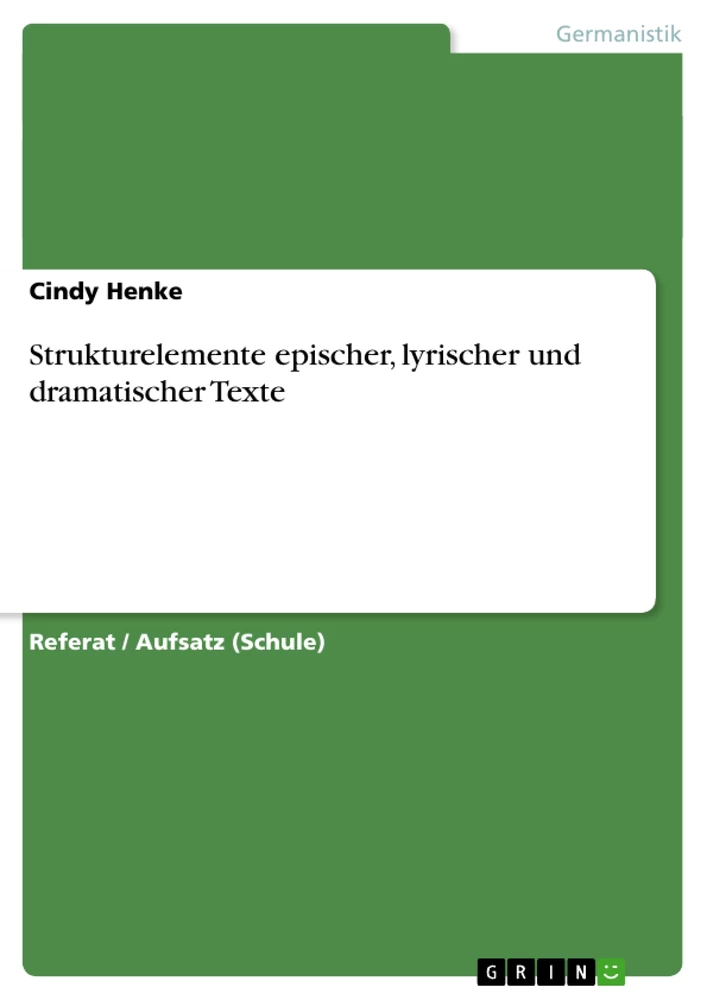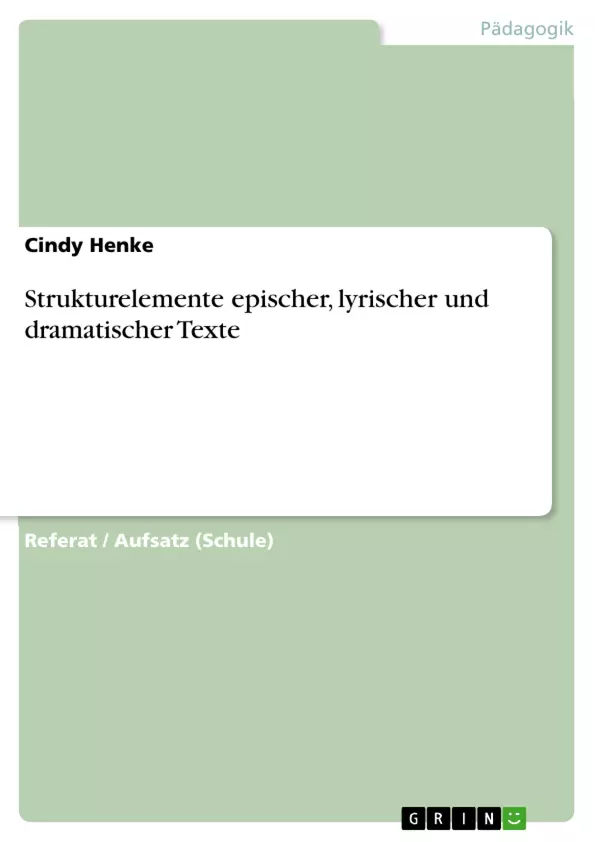Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Literaturanalyse, wo epische, lyrische und dramatische Texte unter die Lupe genommen werden! Dieser umfassende Leitfaden enthüllt die grundlegenden Strukturelemente, die jede Textart einzigartig machen. Entdecken Sie, wie Erzähler, Erzählperspektiven und Erzählsituationen das Fundament epischer Werke bilden, von der allwissenden auktorialen Instanz bis zur intimen Ich-Perspektive und der unbeteiligten personalen Erzählweise. Erforschen Sie das dynamische Zusammenspiel von Geschehen, Geschichte und Fabel, das jede Erzählung prägt, und lernen Sie, wie Raum- und Zeitgestaltung die Atmosphäre und Bedeutungsebene eines Werkes beeinflussen. Untersuchen Sie die vielfältigen Darbietungsformen, von detaillierten Erzählberichten über lebendige Figurenreden bis hin zu den komplexen Techniken des Bewusstseinsstroms und der multiperspektivischen Montage. Im lyrischen Bereich werden Sie in die Geheimnisse von Vers, Klang, Rhythmus und Kadenz eingeführt. Ergründen Sie die Bedeutung von Reimschemata, Versmaßen und dem lyrischen Ich, um die tiefere Bedeutung von Gedichten zu entschlüsseln. Analysieren Sie Themen, Motive und Gedichtarten, um die vielfältigen Ausdrucksformen lyrischer Kunst zu verstehen. Abschließend widmen wir uns den dramatischen Texten, wo Handlung, Konflikt und Figurenkonstellation im Zentrum stehen. Erfahren Sie, wie Sprechakte, Handlungszeit und Handlungsort die Dynamik eines Bühnenstücks bestimmen und wie Akte und Szenen die Struktur des Dramas prägen. Ob Student, Lehrer oder einfach nur ein begeisterter Leser, dieses Buch bietet Ihnen das Werkzeug, um die verborgenen Schichten literarischer Werke zu entdecken und Ihre Wertschätzung für die Kunst des Geschichtenerzählens zu vertiefen. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihre literarische Kompetenz zu erweitern und die Schönheit und Komplexität von Texten in all ihren Formen zu erleben. Dieser Ratgeber ist ein Muss für alle, die sich mit der Analyse und Interpretation von Literatur auseinandersetzen möchten, und bietet einen klaren und prägnanten Überblick über die wichtigsten Konzepte und Techniken der Textanalyse.
Strukturelemente epischer Texte
1. Autor – Erzähler – Erzählsituation
- Autor: Name steht nur auf dem Titel des Romans oder der Kurzgeschichte; denkt sich Erzähler aus
- Erzähler: fiktive Figur des Textes, die Geschichte präsentiert; Vermittler; begrenzt und ordnet das dargebotenen Geschehen
➔ Grundlage des epischen Textes!!!
- Erzählsituationen:
I. auktoriale Erzählsituation
- persönlicher Erzähler, der sich durch Kommentare in die Geschichte einbringt
- hat die Fähigkeit in Zukunft und Vergangenheit zu blicken
- differenziert sich vom Autor
- „Mittelsmann“ zwischen Fiktion und Realität
- berichtende Erzählweise → Vergangenheitsbedeutung
II. Ich Erzählsituation
- gehört zu den Romancharakteren
- hat geschehen miterlebt, erlebt, beobachtet oder von Akteuren in Erfahrung gebracht
- berichtende Erzählweise
III. personale Erzählsituation
- mischt sich nicht in das Geschen ein
- Leser denkt, er befindet sich am Schauplatz des Geschehens oder sieht die Geschichte durch die Augen einer Figur, die aber nicht erzählt → Rollenmaske des Lesers
- Illusion der Unmittelbarkeit
2. Geschehen – Geschichte – Fabel
- Geschehen: Ereigniskette, die vor dem Zugriff des Erzählers liegt
- Geschichte: sinnhafter Verlaufszusammenhang
- Fabel: Gerüst der Geschichte; grobe Übersicht über Verlauf der Geschichte von Ausgangspunkt bis Ende
3. Raum – Zeitgestaltung
- Raum: wird entsprechend Geschehen und Geschichte im Erzählkontext mit Sinn aufgeladen; Korrespondenz zum Charakter des jeweiligen Handlungsmomentes und zur Innenwelt der Person → Bsp.: „Seelenlandschaft“
- Zeitgestaltung:
I. erzählte Zeit: Zeitraum, in dem sich erzähltes Geschehen abspielt
II. Erzählzeit: Zeit, in der Geschichte erzählt bzw. gelesen wird
- Chronologie der Zeitgestaltung:
I. streng lineare Reihenfolge der Ereignisse
II. Vorrausdeutung, Finalspannung, Detailspannung, Rückwendung durch Rückblenden → verschachteltes erzählerisches Zeitgefüge
a) zeitdeckendes Erzählen: Wiedergabe in direkter Rede → Annäherung an Zeitstruktur des Dramas
b) zeitdehnendes Erzählen: längere Erzählzeit als erzählte Zeit
c) zeitraffendes Erzählen: mehrere Jahre, Jahrzehnte oder Generationen müssen „gerafft“ werden
4. Darbietungsformen
- Erzählbericht: Handlungsablauf wird berichtet; Erzähler referiert das (fiktiv) Miterlebte im Zusammenhang → gerafft
- durch Einfügen von Beschreibungen und Reflexionen → Erzählzeit gedehnt zur erzählten Zeit
- Figurenrede: Erzähler lässt dargestellte Peron selbst zu Wort kommen
- szenische Darstellung: Figuren geben Anregungen, Eindrücke, Gedanken und Assoziationen durch Wechselrede direkt wieder → zeitdeckend
- Technik des Bewusstseinsstromes: Erzähler gibt Gedanken, … seiner Figur so wieder wie sie der Figur durch den Kopf gehen → unkommentiert und scheinbar ungeordnet
- wenn Ich Erzähler → Innerer Monolog
- wenn Er Erzähler → erlebte Rede
- Technik der multiperspektivischen Montage: unvermitteltes Herumspringen in personalem Erzählen zwischen den Figuren und ihren Sichtweisen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Strukturelemente lyrischer Texte
(Auszug aus P. Wapnewski: „Gedichte sind genaue Form“)
1. Vers
- Zeilen brechen an einer vom Dichter gesetzten Stelle ab
- Akzentuierung, Pausen, Überlagerung der normalen Satzstruktur durch Versstruktur
- optische/ klangliche Mittel:
- Zeilenstil: Satz- & Versende stimmen überein; Vers schließt mit Pause
- Enjambement: Satz überspringt Versende und setzt sich im folgenden Vers fort; keine Pause am Versende
- Hakenstil: Folge von Zeilensprüngen → Verse erscheinen durch übergreifende Satzbögen verhakt
2. Klang, Rhythmus
- lautliche Ebene → wesentlich am Sinnaufbau beteiligt
- Bsp.: Endreim, Binnenreim, Alliteration, Onomatopoesie (lautmalerische Häufung von Vokalen oder Konsonanten zur Nachahmung von Naturlauten bzw. zum Hervorrufen bestimmter Stimmungen)
- metrisch-rhythmische Gestaltung
- Versmaße & Rhythmisierung (fließend, wogend, hüpfend, tänzelnd, schreitend, drängend, gestaut, zerhackt)
- beeinflussen das Verständnis
3. Kadenz
- wenn betonte Silbe am Versende → männlich (einsilbig)
- wenn unbetonte Silbe am Versende → weiblich (zweisilbig)
- wenn Wechsel zwischen männlich und weiblich → alternierend
4. Versmaß
- Jambus (unbetont – betont → steigend)
- Trochäus (betont – unbetont → fallend)
- Anapäst (unbetont – unbetont – betont)
- Daktylus (betont – unbetont – unbetont)
5. Reim
- Gleichklang von Silben am Versanfang, innerhalb oder am Versende
- Endreim: genauer Gleichklang der Versenden vom letzten betonten Vokal
→ Paarreim: aa bb
→ Kreuzreim: ab ab
→ Umarmender Reim: ab ba
→ Schweifreim: aa bc cb
→ Dreifacher Reim: abc abc
→ Haufenreim: aaa…
- Assonanz: unreiner Reim, bei dem nur Vokale nicht aber Konsonanten übereinstimmen (sagen - Rabe)
- Binnenreim: zwei oder mehrere Wörter in ein und demselben Vers reimen sich
- Schlagreim (Alliteration): zwei unmittelbar aufeinander folgende Wörter reimen sich
6. lyrisches Ich (Subjekt oder Sprecher)
- Vermittler des lyrischen Textes (direkt oder indirekt)
7. Thema
- gedanklich abstrakter Bereich, dem sich der Text zuordnen lässt
8. Motive
- immer wiederkehrendes Element des Textes
- entfaltet das Thema
- lässt sich dem Thema zuordnen
9. Gedichtart
- Erlebnis- oder Stimmungslyrik: gestaltet vor allem reale oder traumhafte persönliche Erlebnisse, besonders zu den Themen Natur und Liebe
- Gedanken- oder Ideenlyrik: vorwiegend betrachtende (reflektierende) Lyrik, die religiöse, philosophische und geschichtlich-politische Themen hat; es gibt verschiedene Mischformen
10. Strophe
- gliedern sich in mehrere Verse, die inhaltlich relativ zusammengefasst sind → Gedichtabschnitt
11. Vers
- Zeile eines Gedichtes
Strukturelemente dramatischer Texte
- Drama = griech. „ Handlung “
- Wesen: Drama liegt Handlung zu Grunde, die auf einer Bühne präsentiert wird
→ Bühnenstück (Unterschied zu Epik & Lyrik)
→ Partitur für Schauspieler (mit Regieanweisungen/ Geräuschen/ Bühnenbildern)
- nicht für Leser, sondern für Zuschauer
- Drama wird vorgeführt (mittels Mimik, Gestik, Bewegung → nonverbal Sprache → verbal)
- Figuren kommen über das Sprechen miteinander in Kontakt (Figurenrede)
→ dadurch erfährt der Zuschauer weitgehend den Handlungsinhalt
- Beziehung:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
→ Neue Dimension (wesentliches dramatisches Element)
- Sprechakte: Figuren äußern sich durch Sprache
- Verhältnis der Längen der Sprechakte → Wichtung der Rolle
- Grundmuster: dramatischer Konflikt = Grundelement der Handlung
- Konflikt = Aufeinandertreffen von mindestens zwei verschiedenen Positionen (Konfliktpole)
→ wird durch Handlungsträger ausgetragen
→ Erkennen von Verhältnissen der Figuren zueinander entsprechend ihren Verhältnissen zu den jeweiligen Konfliktpolen (Bsp: arm – Bettler; reich - Adliger)
→ aus dem Konflikt ergibt sich die Figurenkonstellation
- wenn mindestens ein Konfliktpol weg → Konfliktlösung
- Konflikt wird in Handlungszeit und an Handlungsort ausgetragen → dadurch begrenzt (nach Aristoteles: Einheit der Zeit, des Ortes und der Handlung d.h. Handlung spielt nur an einem Ort an einem Tag (24h))
- Konflikt ist Thema untergeordnet
- Handlung = meistens (in klassischen Dramen) Konfliktentwicklung von Konfliktsetzung bis Konfliktlösung
- einzelne Handlungsschritte = Akte/ Aufzüge
- Akte/ Aufzüge untergliedern sich in Szenen/ Auftritte
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Strukturelemente epischer Texte und wie sind sie definiert?
Die Strukturelemente epischer Texte umfassen Autor, Erzähler, Erzählsituation, Geschehen, Geschichte, Fabel, Raum- und Zeitgestaltung sowie Darbietungsformen.
- Autor: Der Verfasser des Romans oder der Kurzgeschichte, dessen Name auf dem Titel steht.
- Erzähler: Eine fiktive Figur im Text, die die Geschichte präsentiert und das Geschehen vermittelt und ordnet.
- Erzählsituationen:
- Auktoriale Erzählsituation: Ein persönlicher Erzähler, der sich durch Kommentare in die Geschichte einbringt und die Fähigkeit besitzt, in Zukunft und Vergangenheit zu blicken.
- Ich-Erzählsituation: Der Erzähler ist Teil der Romancharaktere, hat das Geschehen miterlebt, erlebt, beobachtet oder von Akteuren erfahren.
- Personale Erzählsituation: Der Erzähler mischt sich nicht in das Geschehen ein; der Leser sieht die Geschichte durch die Augen einer Figur, die aber nicht erzählt.
- Geschehen: Die Ereigniskette, die vor dem Zugriff des Erzählers liegt.
- Geschichte: Ein sinnhafter Verlaufszusammenhang.
- Fabel: Das Gerüst der Geschichte; eine grobe Übersicht über den Verlauf von Ausgangspunkt bis Ende.
- Raumgestaltung: Der Raum wird im Erzählkontext entsprechend dem Geschehen und der Geschichte mit Sinn aufgeladen und korrespondiert mit dem Charakter des jeweiligen Handlungsmomentes und der Innenwelt der Person.
- Zeitgestaltung:
- Erzählte Zeit: Der Zeitraum, in dem sich das erzählte Geschehen abspielt.
- Erzählzeit: Die Zeit, in der die Geschichte erzählt bzw. gelesen wird.
- Darbietungsformen: Erzählbericht, Figurenrede, szenische Darstellung, Technik des Bewusstseinsstromes (innerer Monolog, erlebte Rede), Technik der multiperspektivischen Montage.
Was sind die Strukturelemente lyrischer Texte nach P. Wapnewski und wie werden sie charakterisiert?
Die Strukturelemente lyrischer Texte umfassen Vers, Klang, Rhythmus, Kadenz, Versmaß, Reim, lyrisches Ich, Thema, Motive, Gedichtart und Strophe.
- Vers: Zeilen, die an einer vom Dichter gesetzten Stelle abbrechen; Akzentuierung, Pausen und Überlagerung der normalen Satzstruktur durch Versstruktur.
- Klang, Rhythmus: Die lautliche Ebene, die wesentlich am Sinnaufbau beteiligt ist; Beispiele sind Endreim, Binnenreim, Alliteration, Onomatopoesie sowie die metrisch-rhythmische Gestaltung.
- Kadenz: Männlich (betonte Silbe am Versende), weiblich (unbetonte Silbe am Versende), alternierend (Wechsel zwischen männlich und weiblich).
- Versmaß: Jambus (unbetont – betont), Trochäus (betont – unbetont), Anapäst (unbetont – unbetont – betont), Daktylus (betont – unbetont – unbetont).
- Reim: Gleichklang von Silben am Versanfang, innerhalb oder am Versende; verschiedene Reimschemata wie Paarreim, Kreuzreim, umarmender Reim, Schweifreim, dreifacher Reim, Haufenreim sowie Assonanz, Binnenreim und Schlagreim.
- Lyrisches Ich: Vermittler des lyrischen Textes (direkt oder indirekt).
- Thema: Ein gedanklich abstrakter Bereich, dem sich der Text zuordnen lässt.
- Motive: Immer wiederkehrende Elemente des Textes, die das Thema entfalten.
- Gedichtart: Erlebnis- oder Stimmungslyrik, Gedanken- oder Ideenlyrik.
- Strophe: Mehrere Verse, die inhaltlich relativ zusammengefasst sind.
Was sind die Strukturelemente dramatischer Texte und welche Besonderheiten haben sie?
Die Strukturelemente dramatischer Texte basieren auf der Handlung, die auf einer Bühne präsentiert wird. Wesentliche Elemente sind Figurenrede, Sprechakte, dramatischer Konflikt, Figurenkonstellation, Handlungszeit, Handlungsort, Thema, Konfliktentwicklung, Akte/Aufzüge und Szenen/Auftritte.
- Figurenrede: Figuren kommen über das Sprechen miteinander in Kontakt, wodurch der Zuschauer den Handlungsinhalt erfährt.
- Sprechakte: Figuren äußern sich durch Sprache, wobei die Länge der Sprechakte die Wichtung der Rolle widerspiegelt.
- Dramatischer Konflikt: Das Aufeinandertreffen von mindestens zwei verschiedenen Positionen (Konfliktpole), ausgetragen durch Handlungsträger.
- Figurenkonstellation: Ergibt sich aus dem Konflikt und den Verhältnissen der Figuren zueinander.
- Handlungszeit und Handlungsort: Der Konflikt wird in Handlungszeit und am Handlungsort ausgetragen.
- Konfliktentwicklung: In klassischen Dramen meist die Konfliktentwicklung von Konfliktsetzung bis Konfliktlösung.
- Akte/Aufzüge: Einzelne Handlungsschritte.
- Szenen/Auftritte: Untergliederung der Akte/Aufzüge.
- Arbeit zitieren
- Cindy Henke (Autor:in), 2006, Strukturelemente epischer, lyrischer und dramatischer Texte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110105