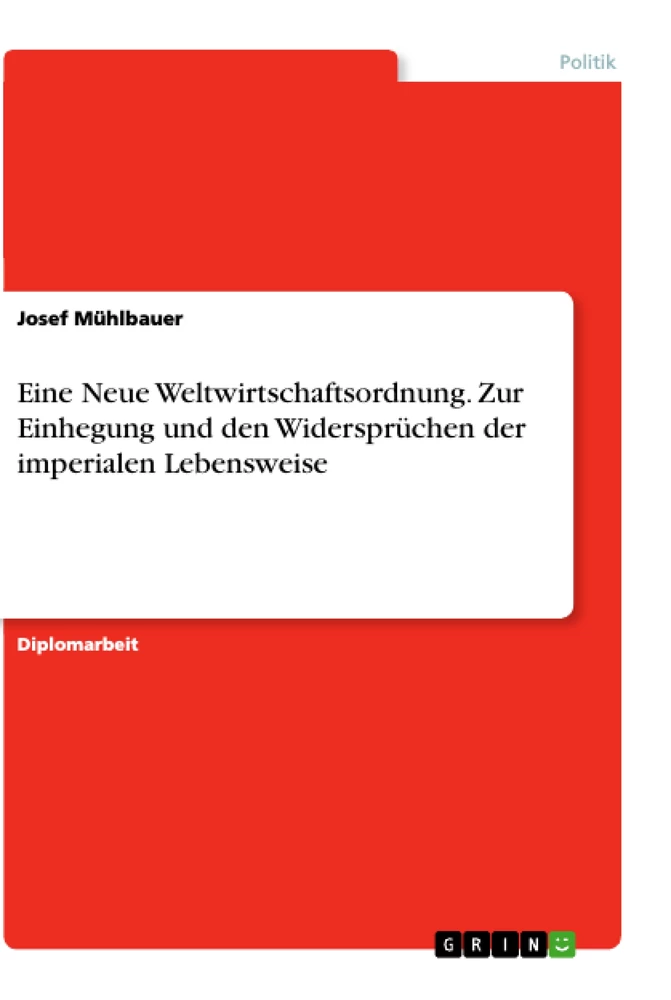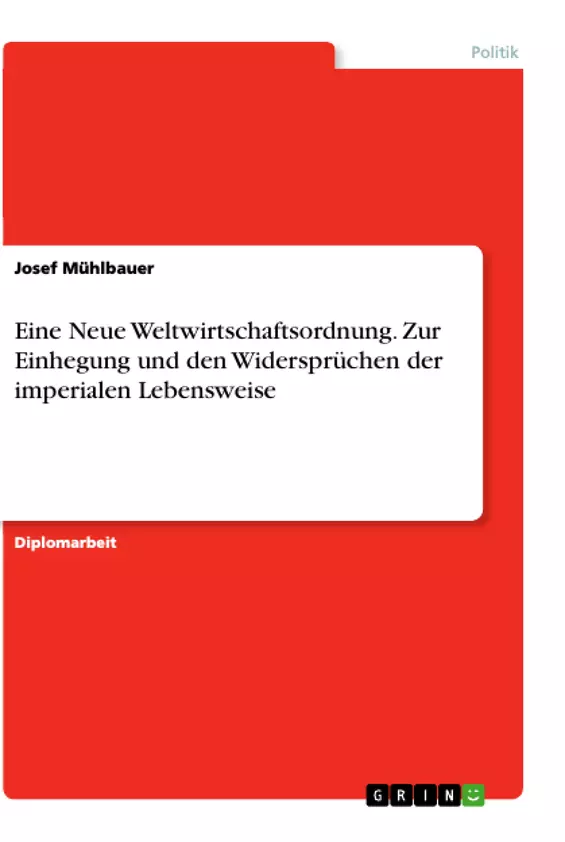Die vorliegende Masterarbeit untersucht mittels einer sozialwissenschaftlichen Dokumentenanalyse den Diskurs um eine Neue Weltwirtschaftsordnung (NWWO) ab den 1970er Jahren. Dabei steht im Zentrum die Frage: inwiefern fortschrittliche Aspekte zur Einhegung bzw. Überwindung der hegemonial etablierten und kapitalistischen Weltordnung – im Sinne einer aufscheinenden solidarischen Produktions- und Lebensweise und ihrer politischen Rahmenbedingungen – thematisiert wurden. In Anlehnung an dem analytischen Strukturbegriff „Imperiale Lebensweise“, der Regulationstheorie und der soziohistorischen Analyse der Annales-Schule rekonstruiere ich die hegemoniale Etablierung, relative Stabilität und inhärente Widersprüchlichkeit des kapitalistischen Akkumulationsregimes. Fortschrittliche Aspekte der Einhegung bzw. Überwindung dieses Regimes werden aus dem Konzept der solidarischen Lebensweise sowie der Degrowth-Debatte und dem Post-Development-Ansatz generiert. Der Diskurs um eine NWWO ist – in Summe – zu begreifen als eine zeitgemäße Form der Darstellung der Gegensätze, die der bestehenden Wirtschaftsordnung zugrunde liegen. Sie ist in keiner Weise aber schon die Aufhebung dieser Gegensätze in einer neuen Wirtschaftsordnung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsfrage und methodologische Herangehensweise
- 2.1 Stand der Forschung und Relevanz dieser Arbeit
- 3. Theoretischer Rahmen und Begriffsbestimmung
- 3.1 Theoretische Vorannahmen
- 3.2 Imperiale Lebensweise
- 3.2.1 Kriterien solidarischer Lebens- und Produktionsweisen
- 3.3 Annales-Schule und Regulationstheorie
- 3.3.1. Soziohistorische Analysen des Akkumulationsregimes
- 3.3.2. Regulationsmodus
- 3.4 Zwischenfazit - Theoretischer Rahmen
- 4. Gesellschaftlich-historischer Kontext der „Neuen Weltwirtschaftsordnung“
- 4.1 Historische Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise
- 4.1.1 Kolonialismus und Imperialismus – eine Geschichte des strukturellen Rassismus
- 4.1.2 Prozess der Dekolonialisierung und die Regulation des Fordismus
- 4.1.3 Post-Fordismus und der Aufstieg des Neoliberalismus
- 4.2 Entwicklungsdekaden und die „Neue Weltwirtschaftsordnung“
- 4.3 Zwischenfazit - NWWO als analytische Kategorie
- 4.1 Historische Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise
- 5. Forderungen, Reformen, Resolutionen und Diskurse der NWWO
- 5.1 Zentrale Forderungen und Reformen
- 5.1.1 Außenorientierung, Abhängigkeit vom Weltmarkt und imperiale Rohstoffe
- 5.1.2 Der wichtigste und blutigste Rohstoff der Welt: Erdöl
- 5.1.3 Souveränität und Selbstbestimmung
- 5.2 Akademische Debatten
- 5.2.1 Jan Tinbergen und der RIO-Bericht – eine Degrowth Perspektive auf die NWWO
- 5.2.2 Die Prebisch-Singer-These – Strukturalistische Perspektive
- 5.2.3 Senghaas - Dependenztheoretische und die dissoziative Perspektive
- 5.2.4 Integrationstische Perspektive I: Allgemein
- 5.2.5 Integrationstische Perspektive II: Brandt-Report
- 5.2.6 Collective Self-Reliance und Selektive Kooperation als Mittelweg?
- 5.2.7 Endogene Ansätze bzw. (neo)liberale Positionen
- 5.2.8 Exogene Ansätze bzw. (Neo-)Imperialismustheorien
- 5.3 Zwischenfazit - NWWO als normative Kategorie
- 5.1 Zentrale Forderungen und Reformen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit dem Diskurs um eine Neue Weltwirtschaftsordnung (NWWO) ab den 1970er Jahren. Sie untersucht, inwiefern fortschrittliche Aspekte zur Einhegung oder Überwindung der kapitalistischen Weltordnung thematisiert wurden. Ziel ist es, die hegemoniale Etablierung, relative Stabilität und Widersprüchlichkeit des kapitalistischen Akkumulationsregimes aufzuzeigen und gleichzeitig die fortschrittlichen Ansätze zur Einhegung oder Überwindung dieses Regimes zu analysieren.
- Die Entwicklung und der Wandel der kapitalistischen Produktionsweise
- Die Entstehung und Entwicklung des Diskurses um eine NWWO
- Die Analyse fortschrittlicher Aspekte im Diskurs um eine NWWO
- Die Kritik an der bestehenden Weltwirtschaftsordnung und ihren Auswirkungen
- Die Suche nach Alternativen zu einer solidarischen und gerechten Weltwirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und erläutert die Forschungsfrage sowie die methodologische Herangehensweise. Das zweite Kapitel behandelt den theoretischen Rahmen der Arbeit und definiert zentrale Begriffe wie „Imperiale Lebensweise“, „solidarische Lebens- und Produktionsweisen“ sowie „Regulationsmodus“. Es werden zudem die zentralen theoretischen Ansätze der Annales-Schule und der Regulationstheorie vorgestellt.
Das dritte Kapitel beleuchtet den gesellschaftlich-historischen Kontext der NWWO. Es zeichnet die Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise von ihren kolonialen Anfängen bis zum Aufstieg des Neoliberalismus nach. Dabei wird der Einfluss von Dekolonialisierungsprozessen auf die Regulation des Fordismus sowie die Rolle des strukturellen Rassismus in der Geschichte der kapitalistischen Weltordnung analysiert.
Das vierte Kapitel untersucht die zentralen Forderungen, Reformen, Resolutionen und Diskurse der NWWO. Es analysiert die Debatten um Außenorientierung, Abhängigkeit vom Weltmarkt, imperiale Rohstoffe, sowie die Rolle von Erdöl und die Bedeutung von Souveränität und Selbstbestimmung.
Im fünften Kapitel werden die akademischen Debatten zum Thema NWWO aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Die Arbeit analysiert die Ansätze von Jan Tinbergen und dem RIO-Bericht, die Prebisch-Singer-These, die Dependenztheorie von Senghaas sowie die integrationstischen Perspektiven, die Brandt-Report und die Idee von „Collective Self-Reliance“ und „Selektiver Kooperation“.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die Themenbereiche der „Imperialen Lebensweise“, der „Neuen Weltwirtschaftsordnung“, des „Kapitalismus“, der „Dekolonialisierung“, des „strukturellen Rassismus“, der „Solidarität“, der „Degrowth-Debatte“ und des „Post-Development-Ansatzes“. Die Arbeit greift auf analytische Werkzeuge wie die Regulationstheorie, die Annales-Schule, sowie die Analyse von Dokumenten und Diskursen zurück.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff "Imperiale Lebensweise"?
Er beschreibt eine Lebens- und Produktionsweise in den Industrieländern, die auf dem unbegrenzten Zugriff auf Ressourcen und Arbeitskraft des globalen Südens basiert.
Was war die Forderung nach einer Neuen Weltwirtschaftsordnung (NWWO)?
Ab den 1970er Jahren forderten Entwicklungsländer gerechtere Strukturen im Welthandel, Souveränität über Rohstoffe und ein Ende kolonialer Abhängigkeiten.
Welche Rolle spielt die Regulationstheorie in dieser Arbeit?
Sie dient zur Analyse der Stabilität und der Krisen des kapitalistischen Akkumulationsregimes (z. B. Übergang vom Fordismus zum Post-Fordismus).
Was ist eine solidarische Lebensweise?
Es ist ein Gegenentwurf zur imperialen Lebensweise, der auf ökologischer Nachhaltigkeit, globaler Gerechtigkeit und Degrowth-Prinzipien basiert.
Wie wird der strukturelle Rassismus im Welthandel thematisiert?
Die Arbeit untersucht, wie koloniale und imperialistische Strukturen historisch zu einer rassistisch geprägten globalen Arbeitsteilung geführt haben.
- Citar trabajo
- Josef Mühlbauer (Autor), 2021, Eine Neue Weltwirtschaftsordnung. Zur Einhegung und den Widersprüchen der imperialen Lebensweise, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1101454