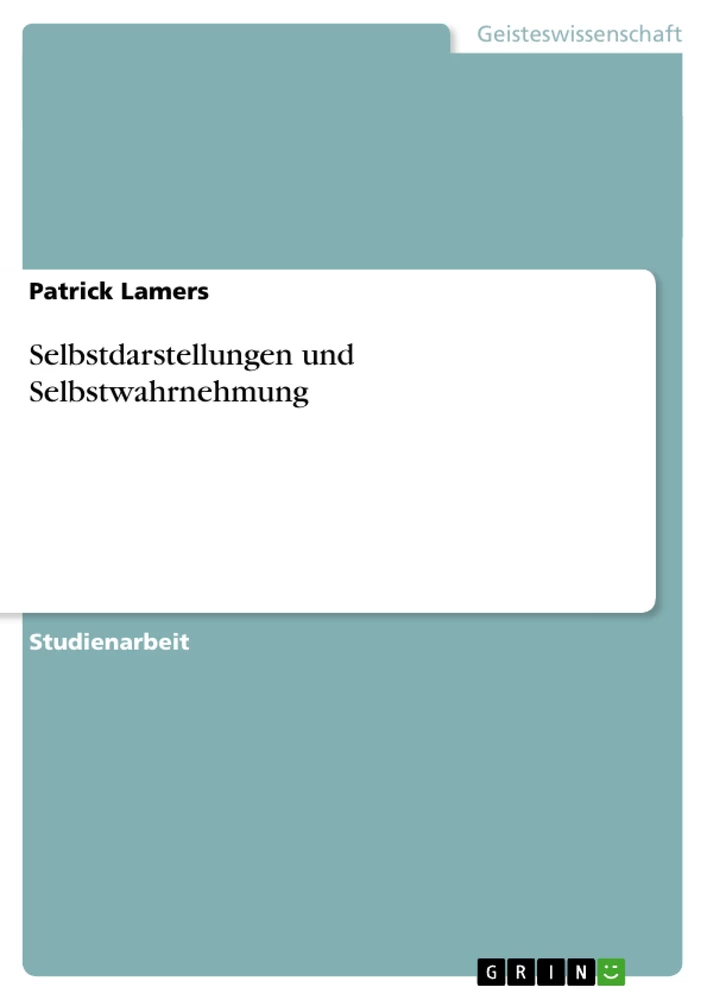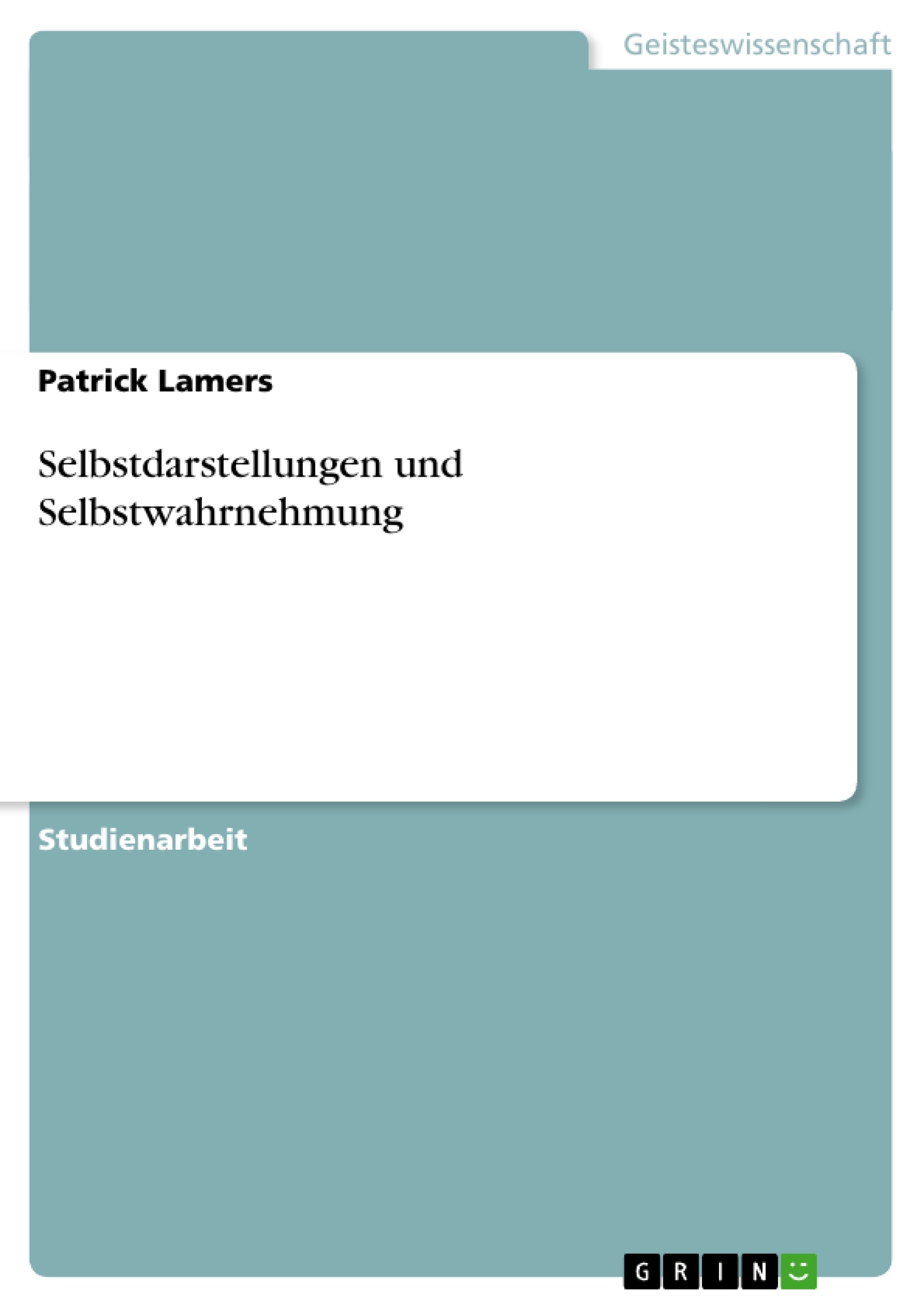1. Einleitung
In der folgenden Arbeit werde ich versuchen die Funktionen des menschlichen Rollenverhaltens zu beschreiben und zu erklären. Beginnen möchte ich mit der Funktion die Rollen für eine Gesellschaft erfüllen und wieso ERVING GOFFMAN die Rolle als „Grundeinheit der Sozialisation“ (GOFFMAN 1973; 97) bezeichnet. Bei der Analyse soll dann insbesondere das Problem der „freien Rollenwahl“ und deren Auswirkungen auf die Wahrnehmung behandelt werden. Auch auf die Diskrepanz zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung soll eingegangen werden, wobei hier die Möglichkeit der Manipulation des Anderen, sowie der Glaube an die eigenen Rollen im Mittelpunkt stehen soll. Abschließend werde ich noch das Problem der Vereinheitlichung mehrer sich widersprechender Rollen thematisieren und die Entwicklung des „Selbst“ als soziales Phänomen erläutern.
Die Hauptthese dieses Aufsatzes lautet: Der Prozess der Sozialisation bzw. die vorangegangen Lebensumstände und Erfahrungen prägen die „Wahl“ der Rollen und deren Auslebung. Des Weiteren beeinflussen die Rollen unsere Selbstwahrnehmung und prägen somit den Charakter.
Anfangen möchte ich mit einem Zitat von Robert Ezra Park, das mir in GOFFMANs Buch „Wir alle spielen Theater“ aufgefallen ist und für diesen Aufsatz von großer Wichtigkeit sein wird:
„Es ist wohl kein historischer Zufall, dass das Wort Person in seiner ursprünglichen Bedeutung eine Maske bezeichnet. Darin liegt eher eine Anerkennung der Tatsache, dass jedermann überall und immer mehr oder weniger bewusst eine Rolle spielt…In diesen Rollen erkennen wir einander; in diesen Rollen erkennen wir uns selbst. In einem gewissen Sinne und insoweit diese Maske das Bild darstellt, das wir uns von uns selbst geschaffen haben – die Rolle, die wir zu erfüllen trachten -, ist die Maske unser wahreres Selbst: das Selbst, das wir zu sein möchten. Schließlich wird die Vorstellung unserer Rolle zu unserer Natur und zu einem integralen Teil unserer Persönlichkeit. Wir kommen als Individuen zur Welt, bauen einen Charakter auf und werden Personen.“ (GOFFMAN 1969; 21)
Als gesellschaftliche Wesen wird das Selbstbild bzw. der Charakter der Menschen durch die kulturell geprägten, normativen Ansprüche und Erwartungen bestimmt. Menschen scheinen sich über ihre Rollen zu identifizieren.
Rollen sind nach GOFFMAN „als die typische Reaktion von Individuen in einer besonderen Position definiert“ (GOFFMAN 1973; 104). Wichtig ist es zwischen der typischen Reaktion (also den kulturellen Rollenerwartungen) und der tatsächlichen Reaktion (also dem eigentlichen Rollenverhalten) zu unterscheiden
– dazu später mehr. Jeder Rolle geht ein gesellschaftlicher Status, d.h. eine Position in einem System zahlreicher, sich wechselseitig ergänzender Positionen, voraus. „Demgemäß ist es eine Position und nicht eine Rolle, die man einnehmen, die man ausfüllen und wieder verlassen kann, denn eine Rolle kann nur „gespielt“ werden“ (GOFFMAN 1973; 95).
Da ein System immer gewissen Regeln und Gesetzen unterliegt, funktioniert auch das Gesellschaftssystem nur unter Berücksichtigung bestimmter „Spielregeln“, die das Zusammenleben ermöglichen. Diese Regeln sind kulturpolitisch vorgegeben und sollen im Laufe des Sozialisationsprozesses internalisiert werden.