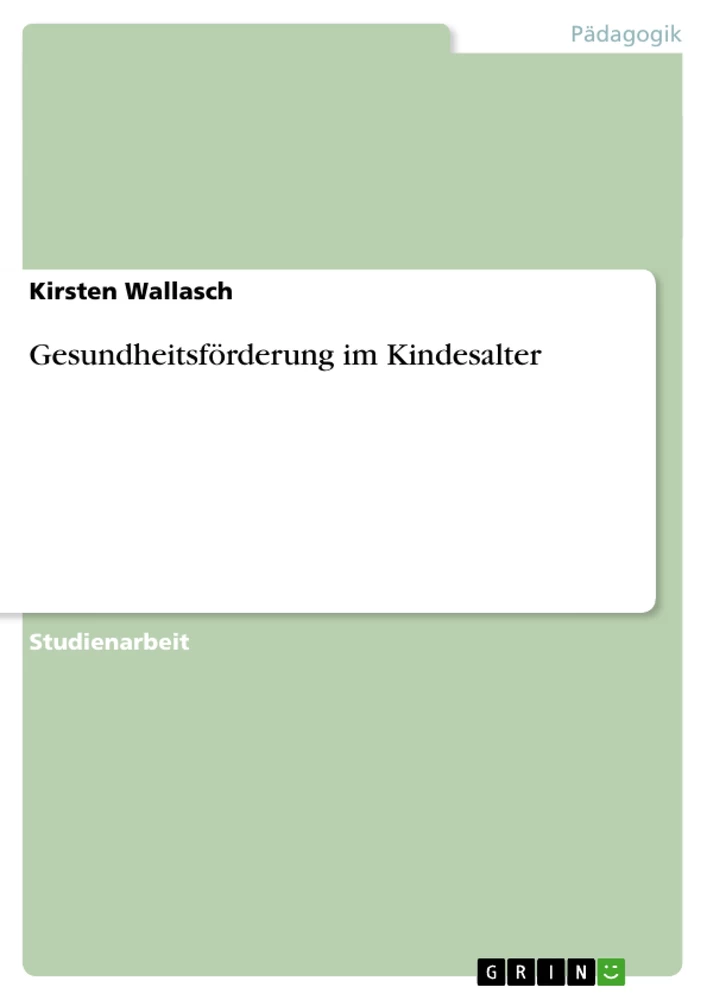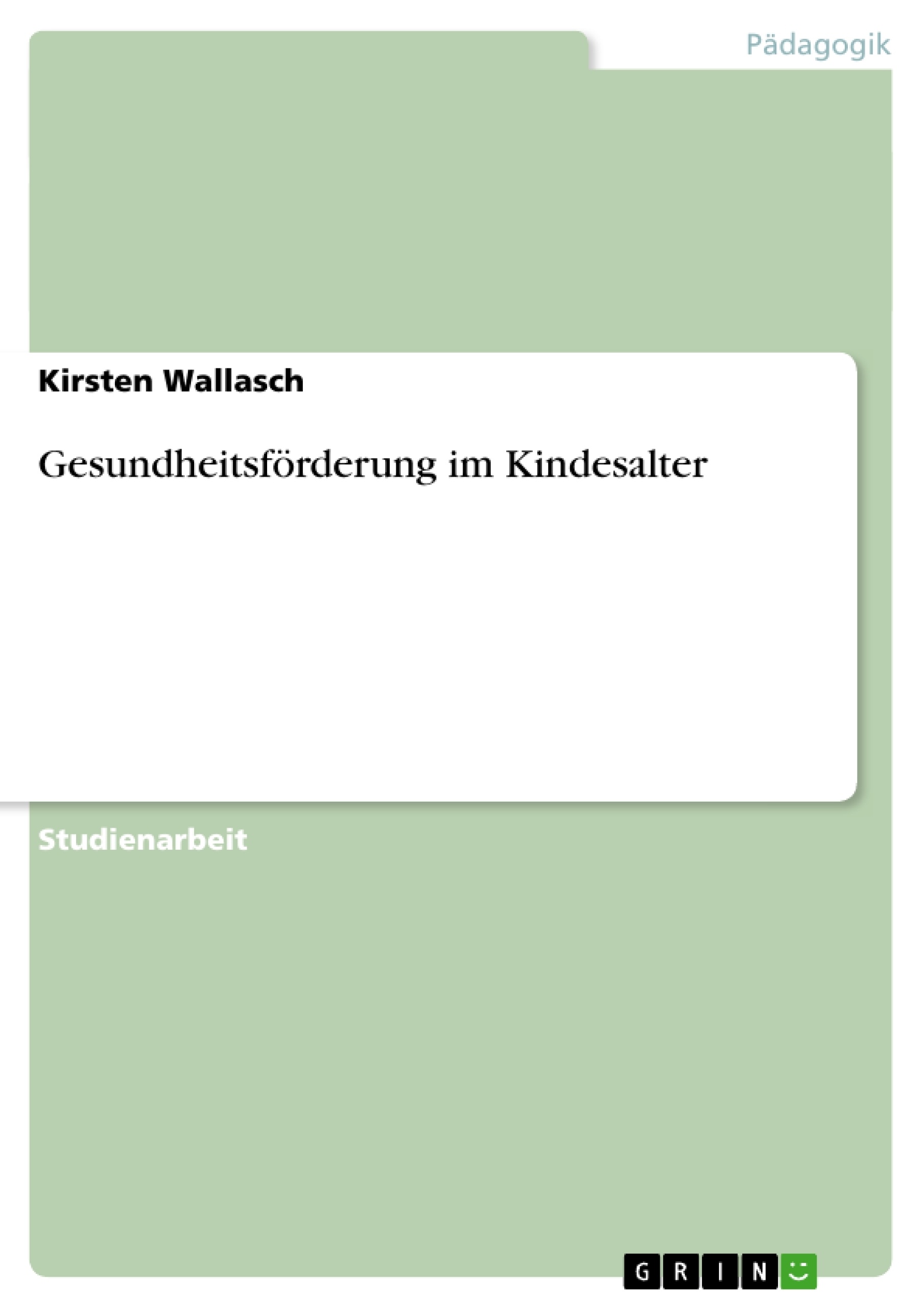Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung
2. Begriffsdefinitionen
2.1 Gesundheits- und Krankheitsbegriff
2.3 Gesundheitsförderung
3. Soziale Kompetenzen
3.1 Selbstwertgefühl
3.2 Soziale Beziehungen
3.3 Soziale Abweichungen
4. Krankheiten
4.1 Körperliche Krankheiten
4.2 Psychosoziale Auffälligkeiten
4.3 Psychosomatische und affektive Störungen
5. Geschlechtsspezifische Formen des Sozial- und Gesundheits- verhaltens
5.1 Sozialverhalten
5.2 Gesundheitsverhalten
6. Handlungsansätze in der (sozialpädagogischen) Praxis
7. Fazit
Literatur
1. Einleitung
Gesundheit ist eines der großen Themen unserer Zeit. In den letzten Jahrzehnten hat sie immer weiter Einzug in das Bewusstsein der Menschen genommen und gilt als besonders wertvoll.
Organisationen, die sich mit der Thematik beschäftigen, wurden gegründet, es gibt Programme für gesundheitsfördernde und –erhaltende Maßnahmen, in den Medien kursieren Gesundheitsratgeber, Menschen setzen sich vermehrt mit gesunder Lebensweise, gesunder Ernährung und Krankheitsprävention auseinander und in der Politik wird Gesundheit als Kostenfaktor der sozialstaatlichen Gesellschaft aufgeführt und diskutiert.
Dabei wird auch immer augenscheinlicher, dass schon früh –also im Kindesalter- mit der Gesundheitsförderung begonnen werden muss. Die moderne Medizin hat es zwar geschafft, bei der Bekämpfung von klassischen Infektions- krankheiten in den westlichen Zivilisationen (durch Impfprogramme) große Erfolge zu erzielen und auch Mangelkrankheiten sowie Epidemien wurden weitgehend besiegt.
Dennoch erscheinen zum einen immer wieder Berichte (in den Medien), dass Kinder sich zu wenig bewegen, oft zu viel wiegen, sich häufig ungesund ernähren, Schwierigkeiten bei der Gestaltung sozialer Beziehungen haben und daher anfällig sind für (chronische) Krankheiten. Zum anderen scheint es sinnvoll, früh zu intervenieren und Kinder zu Gesundheitsbewusstsein zu erziehen und ihnen Maßnahmen zur Gesundheitserhaltung zu vermitteln, als später korrigierend eingreifen zu müssen.
Doch was meint nun der Begriff „Gesundheit“ konkret? Welche Faktoren spielen bei der Förderung und dem Erhalt von Gesundheit – im Kindesalter- eine Rolle? Welche Handlungsansätze gibt es in der (sozialpädagogischen) Praxis? Mit diesen Fragen befasst sich die folgende Ausarbeitung.
2. Begriffsdefinitionen
2.1 Gesundheits- und Krankheitsbegriff
Eine der einfachsten Definitionen von Gesundheit ist sicherlich die, dass „Gesundheit der Zustand von Abwesenheit von Krankheit ist“. Dies ist allerdings nur ein negativer Gesundheitsbegriff, denn er erklärt nicht was der Zustand „Gesundheit“ beinhaltet, sondern lediglich was er ausschließt. Deshalb wurde nach einer positiven Definition von Gesundheit gesucht.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) formulierte daher in ihrer Präambel zur Weltgesundheitsversammlung 1946 die wohl meist zitierte allgemeine Gesundheitsdefinition: „Gesundheit ist der Zustand des völligen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen.“
1977 formulierte die WHO eine weitergehende Forderung, die auch in die „Einzelziele für Gesundheit 2000“ übernommen wurde: „.. dass das wichtigste soziale Ziel für die Regierungen und die WHO in den kommenden Jahren die Erreichung eines Gesundheitszustandes durch alle Bürger der Erde bis zum Jahr 2000 sein sollte, der ihnen die Führung eines sozial und wirtschaftlich produktiven Lebens ermöglicht.“
Als Reaktion auf die aus ihrer Sicht zu wirklichkeitsfremden Definition der WHO Formulierte 1986 der Deutsche Ärztetag: „Gesundheit ist die aus der personalen Einheit von subjektivem Wohlbefinden und objektiver Belastbarkeit erwachsene körperliche und seelische, individuelle und soziale Leistungsfähigkeit der Menschen.“ Was dabei mit Leistung und Produktivität gemeint ist, bleibt allerdings der Interpretation überlassen. (vgl. Wolfgang/Bartholomeyczik 1993, S. 139)
Gesundheit wird also „als ein Gleichgewichtszustand konzipiert, der zu jedem lebensgeschichtlichen Zeitpunkt immer wieder neu hergestellt werden muss. (...) Kann das Gleichgewicht nicht hergestellt werden, kommt es zum Abweichen vom Zustand ‚Gesundheit’ und zu Störungen in den körperlichen, psychischen und sozialen Funktionsbereichen [Hurrelmann/Laaser 1998]. In dieser Sichtweise wird Gesundheit als Stadium des Gleichgewichts, Krankheit als Stadium des Ungleichgewichts von Risiko- und Schutzfaktoren auf körperlicher und psychischer Ebene definiert.“ (Hurrelmann/Bründel 2003, S.154 f)
2.2 Gesundheitsförderung
Im deutschen Sprachraum gibt es viele Begriffe, die sich auf Personen und Institutionen beziehen, welche die Verhütung von Krankheit und die Förderung von Gesundheit durch präventive oder eingreifende Maßnahmen zur Aufgabe haben. Oft werden „Prävention“ und „Gesundheitsförderung“ dabei nebeneinander genannt, ohne eine klare begriffliche Festlegung. Um in dieser Abhandlung genaue Abgrenzungen zwischen den Begriffen zu ziehen, orientiere ich mich an den Definitionsvorschlägen von Ulrich Laaser, Klaus Hurrelmann und Paul Wolters (1993, S.176 ff.):
„- Gesundheitserziehung und Gesundheitsbildung bezeichnen vorzugsweise die Aktivitäten, die vor allem in Familien und in Erziehungs- und Bildungseinrichtungen ablaufen, um über Wissensvermittlung und pädagogische Kontakte und Einstellungen, Kompetenzen und Fertigkeiten zu vermitteln, die der Selbstentfaltung dienen und das gesundheitsbewusste Verhalten eines Menschen fördern;
- Gesundheitsberatung und Gesundheitsaufklärung umfassen –teilweise überlappend- alle Aktivitäten im öffentlichen Raum, die sich an Einzelpersonen oder an ein breites Publikum mit dem Ziel richten, über Informations- vermittlung und Entscheidungshilfe Einstellungen zu verändern und Verhaltensweisen zu beeinflussen;
- Prävention ist durch die medizinische Begrifflichkeit der Weltgesund- heitsorganisation von Primär-, Sekundär- uns Tertiärprävention noch am eindeutigsten definiert, allerdings hat sich der Begriff Tertiärprävention für Rückfallprophylaxe und Rehabilitation nie unangefochten durchsetzen können. Mit dem Teilbegriff der Sekundärprävention werden zwar überwiegend Maßnahmen der Krankheitsfrüherkennung (auch Gesundheitsvorsorge) –meist einschließlich der Risikofaktoren- belegt, oft wird die Früherkennung und Vorbeugung letzterer aber der Primärprävention zugeschlagen. Darüber hinaus wird der Präventionsbegriff vielfach auf den Teilaspekt der Präventivmedizin eingeengt und so der Gesundheitsförderung (s.u.) gegenübergestellt.
- Gesundheitsförderung bezeichnet zusammenfassend die vorbeugenden, präventiven Zugänge zu allen Aktivitäten und Maßnahmen, die die Lebensqualität von Menschen beeinflussen, wobei hygienische, medizinische, psychische, psychiatrische, kulturelle, soziale und ökologische Aspekte vertreten sein können und verhältnisbezogene ebenso wie verhaltensbezogene Dimensionen berücksichtigt werden. Vielfach wird dieser Begriff weitgehend gebraucht: nicht nur Schutz vor Risiko und Krankheit, also Bewahrung von Gesundheit, sondern Verbesserung und Steigerung von nie ganz vollkommener Gesundheit. In diesem Sinne greift Gesundheitsförderung auch über den klassischen Begriff der Primärprävention hinaus.“
Dieser Definitionsvorschlag von Gesundheitsförderung impliziert auch noch einmal, dass Gesundheit nur in einem ökologischen, multidimensionalen Verständnis zu verstehen ist. „Sie ist kein Produkt (z.B. einer gesunden Lebensweise) sondern spiegelt das Ausmaß gelungener Interaktion von Menschen mit sich selbst und anderen auf dem Hintergrund ihrer Lebenswirklichkeit ab.“ (Hildebrandt 1992, S.9)
3. Soziale Kompetenzen
Um ein gesundes Leben zu führen und einen „Zustand des völligen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen“ zu erlangen, bedarf es sozialer Kompetenzen, die den Menschen befähigen eine „gelungene Interaktion mit sich selbst und anderen“ zu betreiben. Denn sie sind immer wieder auf „Interaktionen mit ihren Mitmenschen angewiesen, wenn es darum geht, eigene Bedürfnisse zu verwirklichen und persönliche Ziele zu erreichen. Die Fähigkeit einer Person, solche Interaktionen aktiv, bedürfnisgerecht und zielführend (mit)gestalten zu können, wird dadurch zu einer wichtigen Voraussetzung für ihre psychische Gesundheit und die Entfaltung ihrer persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten.“ (Pfingsten 1996, S. 473)
3.1 Selbstwertgefühl
Um „eigene Bedürfnisse zu verwirklichen und persönliche Ziele zu erreichen“ bedarf es eines starken Selbstwertgefühls, welches dem Kind von Anfang an durch Ermutigung und Bestätigung des eigenen Handelns vermittelt werden sollte.
Kinder benötigen Bezugspersonen, die Vertrauen in ihr Können setzen, um selbst Mut zu entwickeln Neues kennen zu lernen und zu erproben, ja auch sich selbst und ihre Fähigkeiten einschätzen zu lernen und weiter zu entwickeln. Dabei sollten die erwachsenen Bezugspersonen das Kind nicht durch eine übertriebene Schutzhaltung einengen, denn dies schränkt es in seinem Neugierverhalten ein und erschwert ihm die Entdeckung seiner Umgebung.
Durch Überbehütung kann es dazu kommen, dass sich das Kind bald selbst nichts mehr zutraut und seine Leistungsbereitschaft sinkt. Außerdem können überbehütete Kinder versuchen ihre Defizite durch aggressives Verhalten zu kompensieren.
Das Prinzip der Ermutigung ist also ein wesentlicher Bestandteil der Förderung
der kindlichen Persönlichkeit. Es hilft dem Kind für die Zukunft Selbstvertrauen,
Selbstachtung und Selbständigkeit zu erlangen und so auf das Leben gut
vorbereitet zu sein. So gerüstet wird es im späteren Leben auch vor großen
Aufgaben nicht resignieren, sondern selbstbewusst die Herausforderung
angehen und versuchen eine Lösung zu finden.
Das Jugendalter stellt den Heranwachsenden dann vor die Aufgabe, sich vom Elternhaus zu lösen und das Gefühl für die eigene Identität zu entwickeln. Es ist der Lebensabschnitt, in dem es dem Jugendlichen gelingen sollte, sein Verhalten allmählich und immer mehr an grundliegenden moralischen Prinzipien, die der Betreffende selbst für sinnvoll und richtig erachtet, auszurichten und sich damit vom kindlichen Stadium der Verhaltenslenkung durch Belohnung und Bestrafung bzw. von einer starren Orientierung an Regeln und Autoritäten zu lösen.
Außerdem muss der Jugendliche erfahren und verinnerlichen, dass er als Individuum einzigartig ist und dass er auch im Laufe der Zeit mit all den Veränderungen, die diese mit sich bringt, immer der gleiche ist und bleibt. Zu diesem Identitätsbewusstsein gehört auch das Wissen darüber, wie die anderen zu einem stehen, was sie von einem halten und denken, und dass man in ganz bestimmte soziale Strukturen eingebunden ist, die zum Leben des Menschen notwendiger Weise gehören. (vgl. Erikson 2000, S. 106 ff)
3.2 Soziale Beziehungen
„Kinder benötigen zuverlässige, stabile und ‚berechenbare’ soziale Beziehungsstrukturen, die ihnen Unterstützung und Anregung für ihre persönlichen Entwicklungsprozesse gewähren.“ (Hurrelmann 1990a, S.86) Diese Beziehungsstrukturen müssen zuerst natürlich in der Familie gewährleistet sein, da sie die erste Sozialisationsinstanz für das Kind darstellt. Eltern, Großeltern und Geschwister sind die ersten Bezugspersonen des Kindes, welche ihm durch die zuverlässige Befriedigung elementarer (Grund-) Bedürfnisse (Bedürfnis nach Nahrung, Hygiene, Schlaf, Schutz, Geborgenheit, körperliche und seelische Wertschätzung, Anregung und Spiel, Selbstverwirklichung und Bewältigung existenzieller Lebensängste) Sicherheit und Geborgenheit vermitteln sollten. In dieser ersten Lebensphase entscheidet sich, ob das Kind ein sogenanntes „Urvertrauen“ zu sich und seiner Umwelt aufbauen kann, welches unter anderem im weiteren Verlauf der Entwicklung die Ausbildung eines Selbstwertgefühls beeinflusst.
Im Jugendalter treten die Eltern als Bezugspersonen Schritt für Schritt in den Hintergrund und der Jugendliche orientiert sich mehr und mehr an der Gruppe der Gleichaltrigen (Peer-group). Dies geht damit einher, dass der Jugendliche seine Lebenswelt erweitert und neue Bereiche seines sozialen Umfeldes betritt.
Alternative Wert- und Normvorstellungen treten dabei in den Vordergrund, was Eltern oftmals erschreckt und sie im Umgang mit ihren Kindern stark verunsichert. Zum einen stellen sie häufig die Forderungen an den Jugendlichen, der ja bald erwachsen ist, zum anderen können sie dieses Erwachsenwerden aber oft nicht realisieren, und machen nur spärliche Zugeständnisse bei Freiheiten und Selbstbestimmung des Jugendlichen.
Dadurch entstehen oft Konflikte zwischen den Generationen. Aber auch in den Peer-groups gibt es so etwas wie soziale Kontrolle und Normierungstendenzen, was Konflikte heraufschwört und sich durch Rigidität und Einseitigkeit auch gegen die Gesundheit auswirken kann.
3.3 Soziale Abweichungen
Soziale Konflikte erfordern von den Betroffenen adäquate Bewältigungs- strategien und Ressourcen. Stehen diese nicht zur Verfügung, kann es zur Überlastung kommen, vor allem „wenn in der raschen Folge von Verhaltens- anforderungen in unterschiedlichen Aufgabenbereichen im Jugendalter Überforderungen der eigenen Fähigkeiten auftreten.“ (Hurrelmann 1990b, S.99) „Betrachtet man vor diesem Hintergrund Risikoverhaltensweisen, dann kann man sie als inadäquate Bewältigungsstrategien zum Umgang mit auftretenden Problemen auffassen. Sie erhalten damit eine funktionale Bedeutung als (inadäquater) Lösungsweg beim Versuch einer Problembewältigung.“ (Lohaus 1993, S. 44)
Diese Risikoverhaltensweisen zeigen sich oft in abweichendem Verhalten, sowohl in der Flucht in den Drogengebrauch als Konfliktlösungsstrategie, als auch in Formen von delinquentem Handeln. Drogenkonsum, ebenso wie delinquentes Verhalten (Diebstahl, Körperverletzung, Vandalismus) erweisen sich dabei „als Ersatzziel für enttäuschte Erwartungen, sei es im familiären oder schulischen/beruflichen Bereich, in der Gestaltung von Freundschafts- oder Liebesbeziehungen oder in der Auseinandersetzung mit der eigenen Person [Walper 1990, S. 160].“ (Lohaus 1993, S. 44)
Hurrelmann und Bründel haben 2002 festgestellt, dass bei den Formen sozialer Abweichung Gewalt und Kriminalität besonders in Gewicht fallen. „Sie erreichen im Jugendalter ihre höchste Verbreitung, haben aber in den letzten 20 Jahren schon bei Kindern immer mehr zugenommen.“ (...) Der Anteil der Jungen ist dabei besonders hoch, besonders bei den kriminellen Formen mit Gewaltkomponente. Hierin drückt sich die frühe Orientierung an der Männerrolle und nach außen gerichteten Formen der Problemverarbeitung aus [Pfeiffer 1998].“ (Hurrelmann/Bründel 2002, S. 158)
Mädchen verarbeiten soziale Problemstellungen häufig anders als Jungen. Oft richten sich ihre Aggressionen nach innen, also gegen sich selbst und ihren Körper. Sie greifen dabei eher auf Selbstverletzung und Medikamenten- missbrauch zurück, was augenscheinlich negative Folgen für ihre Gesundheit hat.
4. Krankheiten
Während der Sozialisation muss sich das Kind also mit seiner inneren und äußeren Realität produktiv auseinandersetzen und dabei permanent Lebensan- forderungen bewältigen.
Dabei sind mit innerer Realität die genetische Veranlagung, körperliche Konstitution, Intelligenz, psychisches Temperament und Grundstrukturen der Persönlichkeit gemeint. Die äußere Realität umfasst die Familie, Freundes- gruppen, Erziehungs- und Bildungseinrichtungen, soziale Organisationen, Massenmedien, Arbeitsbedingungen, Wohnbedingungen und die physikalische Umwelt. (vgl. Hurrelmann/Bründel 2002, S. 16)
„Unter ‚Bewältigung’ wird die Bemühung des Kindes verstanden, Anforderungen und Belastungen unter Rückgriff auf die eigenen körperlichen und psychischen Merkmale zu meistern. Reichen die individuellen Ressourcen hierfür nicht aus, sind soziale Unterstützung und Hilfe notwendig.“ (Hurrelmann/Bründel 2002, S. 153)
Wie bereits festgestellt, können Gesundheitsstörungen und Krankheiten die Folgen eines Missverhältnisses zwischen „ Belastungsfaktoren und Schutzfaktoren, also den sozialen, psychischen und körperlichen Ressourcen zur Bewältigung der Belastungen“ sein. (Hurrelmann/Bründel 2002, S. 166)
4.1 Körperliche Krankheiten
Infektionskrankheiten, die Jahrhunderte lang maßgeblich zur Säuglings- und Kindersterblichkeitsrate beigetragen haben, sind dank umfassender Impfprogramme und Vorsorgemaßnahmen, zurückgedrängt worden. Auch Mangelerkrankungen und Epidemien konnten in den letzten Jahrzehnten in den westlichen Zivilisationen erfolgreich bekämpft werden. Allerdings haben chronische Erkrankungen und ökologische Belastungen bei Kindern an Bedeutung gewonnen.
Zu nennen sind dabei Krebskrankheiten, die sich bei Kindern häufig als Leukämien (Blutkrebs) und Lymphknotengeschwulste äußern. Auch Hirntumore sind weit verbreitet. Allerdings ist in den letzten Jahren der Anteil der Krebskrankheiten konstant geblieben. Dabei sind die Heilungschancen in den letzten Jahrzehnten gestiegen. Vor 20 Jahren rechnete man noch mit einer 30 prozentigen Genesungschance, heute sind es bereits 60 bis 70 Prozent.
Dieses resultiert zum einen aus der verbesserten Behandlung durch Medikamente, Operationen und Bestrahlungen und zum anderen aus der zunehmend engeren Zusammenarbeit von Ärzten und Pflege- und Betreuungspersonal.
Als eine weitere chronische Krankheit ist der Diabetes Mellitus (Zuckerkrankheit) zu nennen. Dabei handelt es sich um eine Stoffwechsel- krankheit, welche durch den Mangel des in der Bauchspeicheldrüse gebildeten Hormons Insulin gekennzeichnet ist. Bei Kindern tritt oft ein bestimmter Typ von Diabetes auf, bei dem ein völliges Fehlen von Insulin vorliegt. Dieses führt dazu, dass der Transport des im Blut gelösten Traubenzuckers in die Körperzellen beeinträchtigt wird. Die Ursache hierfür liegt darin, dass bestimmte Zellen in der Bauchspeicheldrüse zu Grunde gegangen sind und diese daher nicht mehr funktionstüchtig ist. (Als Ursachen für die Zerstörung der Bauchspeicheldrüse werden genetische Faktoren, Virusinfektionen, Prozesse des körpereignen Immunsystems und Stresssituationen genannt.) Deshalb sind diese Kinder ihr Leben lang auf die Zufuhr künstlichen Insulins angewiesen, da die Krankheit nicht zu heilen ist. Von ihr sind etwa 0,5 Prozent aller Kinder betroffen.
Etwa genau so hoch (0,5 Prozent) liegt der Anteil der an Rheuma erkrankten Kinder. Dieses äußert sich durch starke Schmerzen in Rücken und Gelenken und tritt schubartig auf.
Epilepsie tritt bei 0,5 bis 1 Prozent aller Kinder auf. Dieses Anfallsleiden, was sich durch starke Krämpfe äußert, resultiert aus einer Hirnfunktionsstörung. Ursachen sind dabei häufig, neben einer erblichen Disposition, Folge- erscheinungen einer exogenen Schädigung des Hirns. Oft treten bei den betroffenen Kindern Leistungs- und Funktionsstörungen auf (z.B. Intelligenz- minderung), die wahrscheinlich auf die Hirnfunktionsstörungen und die starken Nebenwirkungen der Medikamente (Antikonvulsiva) zurück zu führen sind.
Besonders belastend wirken sich für diese Kinder nicht nur die Krankheit selbst und ihre Folgen aus, sondern auch die mit ihr oft einhergehende soziale Beeinträchtigung durch Stigmatisierung in der Gleichaltrigengruppe in Kindergarten oder Schule.
In den letzten Jahrzehnten hat die Verbreitung von allergischen Krankheiten (Atopien) enorm zugenommen. Sie kommen in verschiedenen Ausprägungen bei 25 Prozent aller Kinder vor. Bei allergischen Reaktionen spricht der Körper hoch sensibel und mit (Über-) Empfindlichkeitserscheinungen auf Umweltstoffe, wie Pollen, Hausstaubmilben, Tierhaare, Nahrungsmittel und chemische Substanzen, die in der häuslichen Umgebung und der Natur vorkommen an. Die Stoffe, welche die Reaktion des Körpers auslösen, werden als Allergene oder Antigene bezeichnet und sind für den sensibilisierten Menschen schädlich. Sie regen die Bildung von Antikörpern (Immunglobulinen) an. Die häufigsten Allergien sind Heuschnupfen, Bronchialasthma und das atopische Ekzem (konstitutionelle Neurodermitis). Seltener sind Nahrungsmittelallergien, bestimmte Formen von Ausschlägen und Insektenstichallergien.
Wie schon erwähnt, gibt es Formen von Neurodermitis und Bronchialasthma, die durch Allergien ausgelöst werden. Allerdings gibt es auch „eigenständige“ Formen dieser Krankheiten.
Das endogene Ekzem (Neurodermitis) tritt früh, meistens innerhalb der beiden ersten Lebensjahre, auf und nimmt einen chronischen Verlauf. Die Hautkrankheit ist gekennzeichnet durch Veränderungen der Haut, die sich an charakteristischen Stellen häufen (Ellenbogen, Armbeuge, Kniekehlen). Die betroffenen Hautpartien jucken stark und bilden entzündliche Bläschen. Als Ursachen werden neben erblichen Faktoren und allergischen Prozessen Störungen der Mutter-Kind-Beziehung vermutet, wie zu geringer Hautkontakt und Mangel an emotionaler Zuwendung. Die Verbreitung ist schwer abzuschätzen, dürfte aber bei mindestens 5 Prozent eines Jahrgangs liegen.
Das Asthma bronchiale kennzeichnet sich durch eine anfallsartig auftretende Atemnot, die durch eine die Ausatmung behindernde Verengung der äußeren Luftwege verursacht wird. Die Auslöser hierfür sind Schleimhautschwellungen, übermäßige Sekretion und Verkrampfungen der Bronchialmuskulatur. Meist gipfelt die Symptomatik in Anfällen mit verlängerter Atempause. Häufen sich diese, so kann dies lebensgefährlich sein. Oft liegen bei den Patienten zwischen den Anfällen keine Beschwerden vor. Man schätzt, dass etwa 6 Prozent aller Kinder an dieser Krankheit leiden, die sich vor allem im ersten Lebensjahrzehnt zeigt. Zur Erklärung greifen die meisten Wissenschaftler zu einer multifaktoriellen Theorie: „Eine genetische Dispositionen im Sinne einer besonderen Anfälligkeit und Verletzlichkeit der Atmungsorgane wird angenommen, die durch verschiedene Auslöserreize wie insbesondere Infektionen, immunologische Reaktionen und emotionale Belastungen zum Ausbruch kommen.“ (Hurrelmann/Bründel 2003, S. 170 f)
Zu den körperlichen Krankheiten gehören auch das Übergewicht (Adipositas) und die Magersucht. Unter Adipositas versteht man ein ausgeprägtes Übergewicht, welches gleichzeitig durch eine ungewöhnliche Fettgewebsansammlung gekennzeichnet ist. Zurückzuführen ist sie einerseits auf genetische Faktoren, andererseits auf die Ernährungsgewohnheiten und sicherlich auch zunehmenden Bewegungsmangel. Die Kinder essen dabei zum einen zu viel von allem und zu am anderen zu einseitig und bewegen sich immer weniger. Häufig dient Essen dabei als Ersatz für irgendetwas oder zur Kompensation. Es wird zur Frustkompensation benutzt, von den Eltern als Belohnung oder Trostpflaster eingesetzt (vor allem Süßigkeiten), hilft beim Spannungsabbau während des Fernsehens oder dient als Zeitvertreib bei Langeweile. Hurrelmann und Bründel schätzen, dass schon etwa 15 Prozent aller Kinder und Jugendlichen unter Adipositas leiden. (vgl. Hurrelmann/Bründel 2002, S. 168 ff)
Die Magersucht (Anorexia nervosa) und die Ess-Brech-Sucht (Bulimie) treten meist erst im Jugend- oder frühen Erwachsenenalter auf. Es ist eine Krankheit mit dramatischem Verlauf, wobei die Erkrankung schleichend beginnt. Oft sind der Wunsch abzunehmen, um so vom Umfeld Anerkennung zu bekommen, der Auslöser. In der Regel wird die Krankheit von den Betroffenen selbst geleugnet, auch wenn die Symptome schon deutlich sichtbar sind. Es ist kaum Krankheitseinsicht zu finden. Dies ist auch der Grund, warum erst nach einer Krise die Behandlung erfolgen kann, wobei eine Einweisung in ein Krankenhaus unvermeidlich ist. Denn natürlich kann diese Krankheit bei extremen Untergewicht zum Tode führen.
4.2 Psychosoziale Auffälligkeiten
Neben den körperlichen Krankheiten gibt es auch viele psychosoziale Auffälligkeiten, die heute eine große Rolle spielen. Kinder, denen die Be- und Verarbeitung von Konflikten und Problemen Schwierigkeiten bereiten, zeigen häufig „Verhaltensauffälligkeiten“. Die Ursachen hierfür können in innerpsychischen Konflikten liegen, aber auch in familiären Spannungen und problematischen sozialen Verhältnissen. Die Auffälligkeiten zeigen sich vor allem in Form von Störungen im Wahrnehmungs- und Verarbeitungsbereich, Leistungsstörungen, Lese-Rechtschreib- oder Rechenschwäche. Etwa 10 bis 12 Prozent aller Kinder im Grundschulalter zeigen diese Symptome.
Wahrnehmungsstörungen beeinflussen massiv das Lern- und Leistungs- vermögen des Kindes. Wahrnehmungsreize werden über die Sinnesorgane (Auge, Ohr, Haut, Nase und Mund) aufgenommen und müssen dann in Kodierungs- und Dekodierungsvorgängen weiterverarbeitet werden. Dies ist die Basis aller höheren kognitiven Prozesse, wie des Denkens, des Erinnerns und des Lernens. Können die eingehenden Reize nicht angemessen integriert werden, oder ist das Kind nicht in der Lage diese Reize zu differenzieren, so kommt es zu massiven Lernstörungen. Diese müssen allerdings durch spezielle ärztliche und schulmedizinische Untersuchungsmethoden erst einmal festgestellt werden. Denn Integrations- und Differenzierungsstörungen fallen bei normalen Hör- und Sehtest nicht auf; sie zeigen sich erst, wenn in der Grundschule Probleme beim Erlernen des Lesens und Schreibens auftreten. Die betroffenen Kinder haben große Schwierigkeiten bei der Reizselektion (was die Aufmerksamkeit und Konzentration beeinträchtigt), bei der Reizdiskrimination (also beim Unterscheiden und Wiedererkennen), bei der Reizintegration (Impulse zu einem Ganzen zusammen zu fügen) und der Reizdurchgliederung (also die Reize zu zerlegen). „So ist zum Beispiel die Anstimmung von auditiven Reizen mit visuellen oder taktilen Reizen erschwert, die auditive, visuelle oder taktile Unterscheidungsfähigkeit gestört, oder Blickrichtung, Hörausrichtung und Körpergleichgewicht sind in ihrer Steuerung anfällig.“ (Hurrelmann/Bründel 2002, S. 172) Außerdem fallen dem Kind feinmotorische Bewegungsabläufe schwer, das heißt die Bewegungsgenauigkeit bei Auge-Hand- und Auge-Fuß- Koordination sind unzureichend. (vgl. Hurrelmann/Bründel 2002, S. 171 ff) Wie schon erwähnt, können sich psychosoziale Auffälligkeiten auch als Lese-Rechtschreib-Schwäche ( (Legasthenie) oder Rechenschwäche (Dyskalkulie) äußern. Diese beiden Schulleistungsstörungen werden ebenfalls auf Schwierigkeiten im Wahrnehmungsbereich zurückgeführt.
Bei der Legasthenie, die mit etwa 15 Prozent aller Grundschulkinder am weitesten verbreitet ist, geht man davon aus, dass die betroffenen Kinder die grundlegende Beziehung zwischen Laut- und Schriftsprache nicht verstanden haben. In der Regel beherrschen diese Kinder das Schreiben und Lesen der einzelnen Buchstaben und Zahlen, haben aber Schwierigkeiten bei Worten und Sätzen. Bei der Dyskalkulie liegen grundlegende Störungen bei der Erfassung räumlicher Beziehungen, der Rechts-Links-Orientierung und des Körperschemas vor. „Als spezifische Wahrnehmungsschwächen werden Beeinträchtigungen bei der Wahrnehmung von Form-, Größen- und Mengenkonstanzen bezeichnet.“
(Hurrelman/Bründel 2002, S. 175) Bei beiden Teilleistungsstörungen liegen meist keine weiteren Beeinträchtigungen vor und sie sind auch nicht intelligenzabhängig (vgl. Hurrelmann/Bründel 2002, S. 174 f). Sie können heute bei entsprechender Diagnose gut behandelt und therapiert werden.
Weitere psychosoziale Auffälligkeiten sind Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen. Fast jedes 20. Kind im Schulalter leidet unter ihnen.
Eine schwere Ausprägung dieser Störungen wird als Hyperaktivität oder Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS) bezeichnet.
Die betroffenen Kinder träumen viel, lassen sich schnell ablenken, können nur schwer eine Aufgabe zu Ende bringen und ermüden schnell. „Ausgangspunkt ist meist eine fahrige und hektische Motorik in der frühen Kindheit, die mit bestimmten Lern- und Verhaltensstörungen einhergeht. Zu den Primär- symptomen können motorische Unruhe, ziellose Aktivität, Impulsivität, ungesteuerte Motorik, Konzentrationsschwäche, Aufmerksamkeitsstörungen, erhöhte Reizempfindlichkeit, sehr schnelle Erregbarkeit und niedrige Frustrationstoleranz gerechnet werden (...) Als Folge der Primärsymptome der Hyperaktivität treten oft sekundäre Symptome auf wie Kontakt- und Beziehungsstörungen, Lernstörungen im schulischen Bereich, Selbstwert- probleme und Verhaltensauffälligkeiten, die sich in Disziplinschwierigkeiten und Aggressivität ausdrücken können [Döpfner u.a. 2000; Petermann u.a. 2001; Trott 1993].“ (Hurrelmann/Bründel 2002, S. 173) Bei der Behandlung des Krankheitsbildes muss unbedingt der familiäre Kontext, also das Erziehungsverhalten, die Partnerschaftsqualität der Eltern und das Familienklima mit einbezogen werden. Oft wird eine medikamentöse Behandlung mit Ritalin oder Medikinet eingeleitet. Dies Präparate beeinflussen die Aktivitäten der Neurotransmitter im Hirn. Sie können aber nur Erfolg versprechen, wenn zusätzlich auch verhaltens- und familientherapeutische Maßnahmen eingesetzt werden. Im Rahmen der Therapien können Kinder durch Ruhe und Meditation zu sich selbst finden und lernen „dass sie Situationen der Angst und Aufregung durch Selbstbeeinflussung bewältigen, und erleben, dass sie ihre Aufmerk- samkeit bewusst steuern können.“ (Hurrelmann/Bründel 2002, S. 174) Eltern sollen in den Therapien lernen, ihr Kind besser zu verstehen und alternative Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit ihrem Kind erwerben. „Die Eltern müssen darin gestärkt werden, nicht nur bestrafungsorientierte Erziehungspraktiken anzuwenden, sondern liebevolle Zuwendung und Anleitung zu geben und selbst mehr Ruhe und Gelassenheit auszustrahlen [Saile/ Gottschneider 1995].“ (Hurrelmann/Bründel 2002, S. 174)
4.3 Psychosomatische und affektive Störungen
Unter Psychosomatik versteht man die „Wissenschaft von der Bedeutung seelischer Vorgänge für [die] Entstehung und Verlauf körperlicher Krankheiten (Med.).“ (Duden 1982, S. 636) „In der psychiatrischen Literatur wird zwischen neurotischen und reaktiven Störungen mit psychischer Symptomatik oder körperlicher Symptomatik unterschieden. Zeigt sich die Leitsymptomatik vorwiegend im emotionalen Bereich, dann wird von einer psychischen Symptomatik gesprochen [Lempp 1990; Schmidtchen 1989].“ (Hurrelmann/ Bründel 2002, S. 176)
Zu den wichtigsten Erscheinungsformen gehören die Angst- und Affektsyndrome. „Hierunter werden Angstzustände gefasst, die als krankhaft angesehen werden, weil die Intensität der Angstempfindung ungewöhnlich hoch ist, die alterstypischen Aktivitäten eingeschränkt sind und die Inhalte und Objekte der Ängste ungewöhnlich sind.“ (Hurrelmann/Bründel 2002, S. 176)
Im Verlauf der Kindheit gibt es verschiedene Ausprägungen dieser Angstzustände. Im Säuglingsalter gibt es die sogenannte 8-Monats-Angst, im Vorschulalter die Trennungsangst, später die Schulangst und in der Adoleszenz Angstneurosen. Bei der Trennungs- und der Schulangst, spielt die übermäßig ausgeprägte Bindung zwischen Mutter und Kind eine große Rolle. Das Kind weist Symptome wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und Übelkeit und die Neigung zu Angstzuständen und depressiven Verstimmungen auf. Die enge Mutter-Kind-Beziehung muss im Laufe der Behandlung abgebaut werden, damit das Kind autonomer wird und sich allein etwas zutraut. Dabei muss es dennoch erfahren können, dass es in der Mutter eine verlässliche Bezugsperson hat.
Die Schulangst oder Schulphobie wird meist noch durch zusätzliche Faktoren wie Leistungsversagen oder seelische Kränkungen durch Mitschüler und Lehrer ausgelöst. Die betroffenen Kinder versuchen sich diesen Situationen durch Schulverweigerung („Schuleschwänzen“) zu entziehen, um so den Demütigungen ihres Selbstwertgefühls zu entgehen.
„Die Angstneurose wird als eine Kombination von körperlichen und psychischen Angstsymptomen verstanden, die keiner realen Gefahr zuzuschreiben sind, sondern ‚eingebildet’ sind. Die Angst ist diffus und kann sich zur Panik steigern.“ (Hurrelmann/Bründel 2002, S.176) Diese Kinder ziehen sich häufig zurück und zeigen als Reaktion auch vegetative Erscheinungen wie beschleunigte Atmung und Herztätigkeit, Blutdrucksteigerung, Schweißausbrüche und Verdauungs- störungen. Wie weit diese Störungen verbreitet sind, kann nur geschätzt werden. Man nimmt jedoch an, dass Angstzustände bei Kindern in den letzten zehn Jahren durch Medienberichte über Kriegsgefahr, Terroranschläge, Umweltverschmutzung und innenpolitische Probleme wie Arbeits- und damit einhergehende Perspektivlosigkeit für junge Menschen generell zugenommen haben.
Eine weitere Form psychosomatischer und affektiver Störungen sind Depressive Syndrome. Sie äußern sich bei Kindern nicht viel anders als bei Erwachsenen. „Sie setzen sich zusammen aus emotionalen Symptomen (Gefühle tiefer Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit, Mutlosigkeit und Lustlosigkeit), kognitiven Symptomen (Gedanken eigener Wertlosigkeit und Unzulänglichkeit, Selbstzweifel, Selbstvorwürfe, Selbstbestrafung, Selbst- entwertung), motivationalen Symptomen (Erlahmung des Aktivitäts- und Antriebsniveaus und der Entscheidungsfähigkeit) und körperlichen Symptomen (Müdigkeit, Erschöpfung, Appetitlosigkeit und Schlafstörungen). Bei jüngeren Kindern (unter zehn Jahren) zeigen sich depressive Störungen häufig in Trennungsängsten und Schulverweigerung- also ähnlich den Angst- und Affektsyndromen. Bei älteren Kindern drücken sie sich in Verstimmungen, Leistungsabfall und Rückzugstendenzen aus.
Medikamenten- und Drogenkonsum werden auch zu den psycho- somatischen Erkrankungen gezählt. Kinder neigen heute schon früh dazu, bereits bei geringfügigen körperlichen Beschwerden zu Medikamenten zu greifen. Oft sollen irgendwelche Präparate auch Entlastung in unangenehmen Lebenssituationen bringen, für Ablenkung oder Anregung und Leistungs- steigerung sorgen. Auch Eltern greifen oft zu diesem Weg der Problem- bewältigung und „begründen diesen Schritt mit ‚Verhaltensauffälligkeiten’ der Kinder, wobei Konzentrationsstörungen, Schulversagen, Zappeligkeit, Kopf- und Magenschmerzen sowie Schlafstörungen am häufigsten genannt werden.“
(Hurrelmann/Bründel 2002, S. 176) Man schätzt, dass etwa 20 Prozent der Kinder im Grundschulalter regelmäßig, mindestens wöchentlich zu Medikamenten greifen. Aber auch der Konsum von Drogen, legalen und illegalen Stoffen, hat bei Kindern zugenommen. Das Einstiegsalter bei Zigaretten und Alkoholkonsum ist in den letzten Jahren gesunken. „So haben zwei Prozent der Jugendlichen nach eigenen Angaben schon vor dem zehnten Lebensjahr regelmäßige Alkoholerfahrungen. Im Alter von zehn bis elf Jahren wächst der Anteil von Einsteigern um jeweils sieben Prozent an. Das Ergebnis ist, dass bis zum Alter von elf Jahren schon 16 Prozent und bis zum Alter von 12 Jahren 36 Prozent der Kinder regelmäßige oder gelegentliche Alkoholkonsumenten sind [Kolip u.a. 1995].“ (Hurrelmann/Bründel 2002, S. 178) Ähnliche Trends zeigen sich beim Zigarettenkonsum, wobei hier das Einstiegsalter noch unter dem des Alkoholkonsums liegt. (vgl. Hurrelmann/Bründel 2002, S. 176 ff)
5. Geschlechtsspezifische Formen des Sozial- und Gesundheitsverhaltens
Wir leben in einer Kultur, in der männliche und weibliche Rollenmuster immer noch vorherrschen, welche unsere Gesellschaft, das Zusammenleben und somit auch den Alltag beeinflussen. Auch bei formaler Gleichstellung und -berechtigung werden von Männern und Frauen unterschiedliche Verhaltens- weisen erwartet. Meist sind diese mit hierarchischen Strukturen verbunden. Bei „Verstoß“ gegen diese latenten Verhaltensregeln drohen soziale Sanktionen vom Umfeld. Dies bekommen auch schon Kinder zu spüren und es beeinflusst in nicht geringem Maße ihre Sozialisation.
5.1 Sozialverhalten
Wie schon in Punkt 3.3 erwähnt, verarbeiten Jungen und Mädchen die sich ihnen stellenden Problemlagen und Konflikte auf verschiedene Arten. Jungen bevorzugen dabei eine nach außen gerichtete Form des Bewältigungsverhaltens, Mädchen eine eher nach innen gerichtete. Bei ihnen wird das offene Zeigen von Aggressionen und das Einnehmen einer Oppositionshaltung auch als unangemessen und wenig weiblich betrachtet und bewertet. Deshalb sind sie gezwungen, ihre Spannungen und Enttäuschungen mit sich selbst auszumachen, oft in Form von Aggressionen gegen den eigenen Körper durch Selbstverletzung und Medikamentenmissbrauch. Bei Jungen dagegen wird das Ausleben aggressiver Verhaltensweisen oft akzeptiert, wenn nicht sogar erwünscht, denn es gilt als immer noch als Ausdruck von Männlichkeit.
„Die feststellbaren Unterschiede im Sozialverhalten liegen in der Dimension Herrschaft/Unterordnung. In einer Gesellschaft, in der sowohl öffentliche wie private Gewaltausübung überwiegend bis ausschließlich Männern vorbehalten ist, können diese Unterschiede im Verhalten von Kindern als Schritte im Erlernen der Normen unserer Kultur verstanden werden [Hagemann-White 1984, S. 45].“
(Hurrelmann/Bründel 2002, S. 184) Durch diese unterschiedlichen Bewältigungsverhalten ist die Gefahr für Jungen, sich sozial abweichend zu verhalten, also delinquent zu werden, weitaus größer (siehe Punkt 3.3).
5.2 Gesundheitsverhalten
Im Kindesalter sind Jungen weitaus anfälliger für körperliche und psychosomatische Krankheiten als Mädchen. Sie leiden häufiger unter chronischen Krankheiten, psychosozialen Auffälligkeiten, Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen und affektiven Syndromen. Die Sterberate durch Verletzungen, Vergiftungen und Unfälle ist auch höher als bei Mädchen, was sicherlich auf die höhere Risikobereitschaft zurückzuführen ist.
In der Pubertät ändert sich das Verhältnis. Mädchen werden in dieser Zeit häufig durch internalisierende Symptome, wie depressive Stimmungen, Ängste, Einsamkeitsgefühle, Suizidversuche und Essstörungen auffällig. Jungen zeigen auch hier eher externalisierende Auffälligkeiten, wie oppositionelles Verhalten, Delinquenz und Schulprobleme. Sie legen auch in dieser Phase eine höhere Risikobereitschaft an den Tag, was im Straßenverkehr und in Bezug auf den Konsum von Drogen zu einer erhöhten Sterblichkeit führt. Der Zusammenhang mit der Entwicklung des Sozialverhaltens ist dabei sicherlich nicht von der Hand zu weisen.
Auffällig ist, dass sich die Geschlechter im Umgang mit ihrem Körper unterscheiden. „Während Frauen in der Regel sensibel auf ihren Körper achten, um ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen inneren und äußeren Anforderungen herzustellen, betrachten Männer ihre körperliche Grundausstattung als ein ‚Instrument’, um sich die soziale und physische Welt zu erschließen.“ (Hurrelmann/Bründel 2002, S. 191)
6. Handlungsansätze in der (sozialpädagogischen) Praxis
Um Handlungsansätze zur Gesundheitsförderung in der (sozialpädagogischen) Praxis zu finden, muss man sich wohl die Frage stellen „Wie und mit welchen Mitteln kann das vorhandene Gesundheitspotential einzelner Menschen und Gruppen durch persönliche Unterstützung und durch strukturelle und politische Initiativen gefördert werden?“ (Brieskorn-Zinke/Köhler-Offierski 1997, S. 83) Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt und dazu folgende Leitlinien formuliert:
a) Bedingungen für eine gesundheitsförderliche Gesamtpolitik
schaffen
Das bedeutet die grundlegenden Bedingungen für Gesundheit wie Ernährung, Wohnung, Bildung, Arbeiten und Einkommenssicherung sowie Sicherung von sozialer Gerechtigkeit und Chancengleichheit zu schaffen. Dies ist die Aufgabe staatlichen Handelns und muss von der Administration bei Fragen der Stadtentwicklung, der Verkehrsplanung, des Sportstättenbereichs, der kulturellen Einrichtungen, der Jugendeinrichtungen, der Erwachsenenbildung etc. berücksichtigt werden.
b) Die persönlichen Kompetenzen jedes einzelnen Menschen
entwickeln
Oft werden Angebote der gesundheitlichen Vorsorge wie der Schwanger- schaftsvorsorge, der kinderärztlichen Vorsorge, Teilnahme an Schutz- impfungen, Krebsvorsorge etc. von Teilen der Bevölkerung aus der Unterschicht als aufoktroyiert empfunden. Deshalb muss Gesundheitspolitik mehr zu einem Bereich der selbstorganisierten Politik und der Selbsthilfe werden, wenn sie die alltäglichen Lebensbedingungen beeinflussen soll. Staatliche Institutionen wie das Gesundheitsamt können dabei eine Mittlerfunktion einnehmen und für ein flächendeckendes Angebot sorgen und Initiativen der Entwicklung von Gesundheitsförderungsprogrammen unterstützen.
c) Gesundheitsförderliche Lebenswelt schaffen
Hierbei geht es darum, gesundheitsgefährdenden Faktoren wie schlechter Wohnqualität, Verunreinigung der Luft, des Grundwassers und des Bodens vorzubeugen bzw. entgegenzusteuern. Dabei kann den Gesundheitsämtern eine wichtige koordinierende Rolle zukommen.
d) Gesundheitsbezogene Gemeinschaftsaktionen fördern
Dabei geht es der WHO darum, Gemeinschaftsaktionen von Bürgerinitiativen und Selbsthilfegruppen, von selbstgesteuerten Bewegungen und Nachbarschaftsaktivitäten in das Konzept der kommunalen Gesundheits- förderung einzubeziehen.
e) Die Gesundheitsdienste neu organisieren
Nach den Vorstellungen der WHO sollten sich die Gesundheitsämter „stärker
als Träger der kommunalen Leistungsverwaltung verstehen und nicht als Vollstrecker staatlicher Eingriffsverwaltung, wie es heute noch häufig der Fall ist. Die Gesundheitsämter sollen ihr interdisziplinäres Spektrum verbreitern und neben Ärztinnen und Ärzten auch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Psychologinnen und Psychologen, Gesundheitsingenieure, ernährungsmedizinische Berater, Arzthelfer und andere Berufsgruppen mit einbeziehen.“ (Hurrelmann 1990a, S. 187) Die Grundidee dieser Konzeption ist natürlich die der Prävention. (vgl. Hurrelmann 1990a, S. 185 ff) Diese Empfehlungen für präventive Maßnahmen müssen natürlich auch praktisch umgesetzt werden. Dies soll von (vier) formellen Trägern für
Tätigkeiten und Aktivitäten der Gesundheitsförderung im Kindes- und Jugendalter umgesetzt werden:
An erster Stelle stehen natürlich Erziehungs- und Bildungseinrichtungen, die durch ihr professionelles Personal (Erzieher, Lehrer) dazu beitragen sollen, Kindern und Jugendlichen eine spezielle Gesundheitserziehung und –bildung angedeihen zu lassen. Dazu gehören eine Vermittlung von Wissen über gesunde Ernährung, praktische Umsetzung durch Projekte wie „Gesundes Frühstück“ u.ä., Förderung von Freude an Bewegung und Wissen über den Stellenwert von körperlicher Aktivität in Bezug auf Förderung und Erhalt der Gesundheit.
Einrichtungen der psychosozialen Versorgung und Beratung mit ihren Eltern- und FamilienberaterInnen und SozialpädagogInnen sollen neben der allgemeinen sozialpädagogischen Betreuung mit erheblichen Anteilen auch von korrektiver und unterstützender Intervention gegenüber Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern gebrauch machen. Sie können Informations- veranstaltungen für Eltern zur Gesundheitsförderung anbieten und dadurch bei ihnen ein Gesundheitsbewusstsein schaffen und ihnen praktische Handlungsmölichkeiten an die Hand geben, die sie im Alltag umsetzen können.
Einrichtungen der psychiatrischen und der Krankenversorgung sollen neben der heilenden und rehabilitativen Tätigkeit die Aufgaben der Gesundheitsvorsorge und –pflege und in Ansätzen auch der Gesundheitsberatung wahrnehmen.
Öffentliche Einrichtungen der Gemeinde bzw. Gebietskörperschaft sollten neben den allgemeinen Aufgaben der Gesundheitsfürsorge auch die Aufgabe der Gesundheitserziehung, -aufklärung und –beratung wahrnehmen. Das kann durch Aufklärungskampagnen erfolgen.
7. Fazit
Gesundheitsförderung ist ein wichtiger Bestandteil der Erziehung von Kindern.
Bereits von Geburt an kann mit ihr begonnen werden. Eltern sollte bereits in der Begleitung der Schwangerschaft von ÄrztInnen, PflegeInnen und SozialpädagogInnen das Wissen um die Förderung von Gesundheit an die Hand gegeben werden. Ihnen muss bewusst gemacht werden, dass ihr Handeln dazu beiträgt, wie sich ihr Kind entwickelt. Dazu gehören außer der Pflege, Hygiene und Versorgung mit Nahrung eben auch die emotionale Nähe, Vermittlung von Geborgenheit und Angenommensein und kognitive Anreize, damit sich das Kind zu einer körperlich gesunden und psychisch starken Persönlichkeit entwickeln kann.
Aber auch in den Bildungs- und Erziehungseinrichtungen muss vermehrt auf Gesundheitsförderung geachtet werden. Da Fehlernährung und Bewegungsmangel häufig Schlüsselprobleme für die gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Kinder sind, muss ihnen durch entsprechendes Entgegenwirken mit Bewegungs-, Wahrnehmungs- und Ernährungsprogrammen Rechnung getragen werden. In den Schulen muss darauf geachtet werden, dass kein Sportunterricht ausfallen darf und dieser am besten mit einer Wissensvermittlung über die Notwendigkeit von Bewegung gekoppelt werden. Dabei darf der Spaß an der Bewegung natürlich nicht fehlen und muss so gefördert werden, dass sich Kinder auch in ihrer Freizeit vermehrt bewegen –auf spielerische Art und Weise.
Denn die besten Kampagnen zur Gesundheitsförderung von Ministerien und Ämtern taugen nichts, wenn sie nicht in der Praxis umgesetzt werden, und zwar so, dass sie von den Menschen in ihren Alltag mitgenommen werden können. Literatur:
Brieskorn-Zinke, Marianne (1997) (Hg.), Köhler-Offierski, Alexa, Gesundheitsförderung in der Sozialen Arbeit: Eine Einführung in soziale Berufe, Freiburg 1997
Duden (1982), Fremdwörterbuch, neu bearbeitete und erweiterte Auflage,
Mannheim/Wien/Zürich 1982
Erikson, Erik (2000), Identität und Lebenszyklus, 1. Auflage, Frankfurt/Main 2000
Hildebrandt, Helmut (1992), Lust am Leben, Gesundheitsförderung mit
Jugendlichen, Ein Ideen- und Aktionsbuch für die Jugendarbeit, Hrsg. v. Projekt Gesundheit im Bund Dt. Pfadfinder im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Europa, Frankfurt/Main 1987, 2. Auflage 1992
Hurrelmann, Klaus (1990a), Familienstress, Schulstress, Freizeitstress;
Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche, Weinheim 1990
Hurrelmann, Klaus (1990b), Sozialisation und Gesundheit, in: Schwarzer, R. (Hrg.) Gesundheitspsychologie, Göttingen 1990
Hurrelmann, Klaus, Bründel, Heidrun (2003), Einführung in die Kindheitsforschung, 2. vollständig überarbeitete Auflage, Weinheim-Basel-Berlin 2003
Laaser, Ulrich, Hurrelmann, Klaus, Wolters, Paul (1993), in: Hurrelmann, Klaus,
Laaser, Ulrich (Hrsg.), Gesundheitswissenschaften, Handbuch für Lehre, Forschung und Praxis, Weinheim und Basel 1993
Lohaus, Arnold (1993), Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention im Kindes- und Jugendalter, Göttingen 1993
Pfingsten, Ulrich (1996), in: Margraf, J. (Hrg.), Lehrbuch der Verhaltenstherapie,
Berlin 1996/2000
Wolfgang, K., Bartholomeyczik, S. (1993), in: Hurrelmann, Klaus, Laaser, Ulrich (Hrsg.), Gesundheitswissenschaften, Handbuch für Lehre, Forschung und Praxis, Weinheim und Basel 1993
Erklärung:
Ich habe diese Hausarbeit eigenständig und nur unter Berücksichtigung der angegebenen Literatur bzw. Internetquellen verfasst.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Gesundheit laut Weltgesundheitsorganisation (WHO)?
Gesundheit ist der Zustand des völligen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen.
Was versteht man unter Gesundheitsförderung?
Gesundheitsförderung bezeichnet zusammenfassend die vorbeugenden, präventiven Zugänge zu allen Aktivitäten und Maßnahmen, die die Lebensqualität von Menschen beeinflussen, wobei hygienische, medizinische, psychische, psychiatrische, kulturelle, soziale und ökologische Aspekte vertreten sein können und verhältnisbezogene ebenso wie verhaltensbezogene Dimensionen berücksichtigt werden.
Welche sozialen Kompetenzen sind wichtig für ein gesundes Leben?
Ein starkes Selbstwertgefühl und funktionierende soziale Beziehungen sind essentiell. Kinder benötigen Bezugspersonen, die Vertrauen in ihr Können setzen, und stabile soziale Strukturen, die ihnen Unterstützung bieten.
Was sind soziale Abweichungen und wie können sie entstehen?
Soziale Abweichungen, wie Drogenkonsum oder delinquentes Verhalten, können als inadäquate Bewältigungsstrategien für Probleme entstehen, wenn adäquate Strategien und Ressourcen fehlen.
Welche körperlichen Krankheiten sind im Kindesalter relevant?
Zu den relevanten körperlichen Krankheiten zählen Krebs, Diabetes Mellitus, Rheuma, Epilepsie, allergische Krankheiten (wie Heuschnupfen, Asthma, Neurodermitis), Übergewicht (Adipositas) und Essstörungen (Magersucht, Bulimie).
Welche psychosozialen Auffälligkeiten können bei Kindern auftreten?
Psychosoziale Auffälligkeiten können sich in Form von Wahrnehmungsstörungen, Leistungsstörungen, Lese-Rechtschreib-Schwäche (Legasthenie), Rechenschwäche (Dyskalkulie) und Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) äußern.
Was sind psychosomatische und affektive Störungen?
Psychosomatische Störungen sind körperliche Krankheiten, die durch seelische Vorgänge beeinflusst werden. Affektive Störungen umfassen Angst- und Affektsyndrome (wie Trennungsangst, Schulangst, Angstneurosen) sowie depressive Syndrome.
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede im Sozial- und Gesundheitsverhalten?
Ja, Jungen neigen eher zu externalisierenden Verhaltensweisen (Aggression, Delinquenz), während Mädchen eher internalisierende Symptome (Depression, Ängste, Essstörungen) zeigen.
Welche Handlungsansätze gibt es in der (sozialpädagogischen) Praxis zur Gesundheitsförderung?
Handlungsansätze umfassen die Schaffung gesundheitsförderlicher Bedingungen, die Entwicklung persönlicher Kompetenzen, die Gestaltung gesundheitsförderlicher Lebenswelten, die Förderung gemeinschaftlicher Aktionen und die Neuorganisation der Gesundheitsdienste durch Erziehungs- und Bildungseinrichtungen, Einrichtungen der psychosozialen Versorgung, psychiatrische und Krankenversorgungseinrichtungen sowie öffentliche Einrichtungen der Gemeinde.
Welche Leitlinien zur Gesundheitsförderung gibt es von der WHO?
Die WHO formuliert die Leitlinien, Bedingungen für gesundheitsförderliche Gesamtpolitik zu schaffen, die persönlichen Kompetenzen zu entwickeln, gesundheitsförderliche Lebenswelten zu schaffen, gesundheitsbezogene Gemeinschaftsaktionen zu fördern und die Gesundheitsdienste neu zu organisieren.
- Citar trabajo
- Kirsten Wallasch (Autor), 2005, Gesundheitsförderung im Kindesalter, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110298