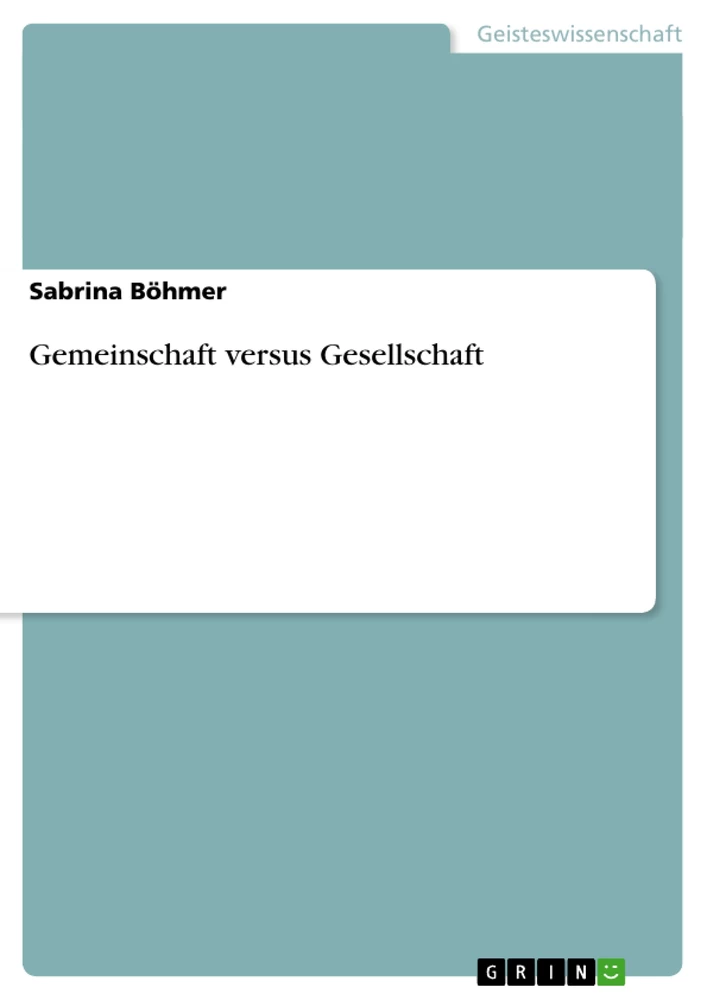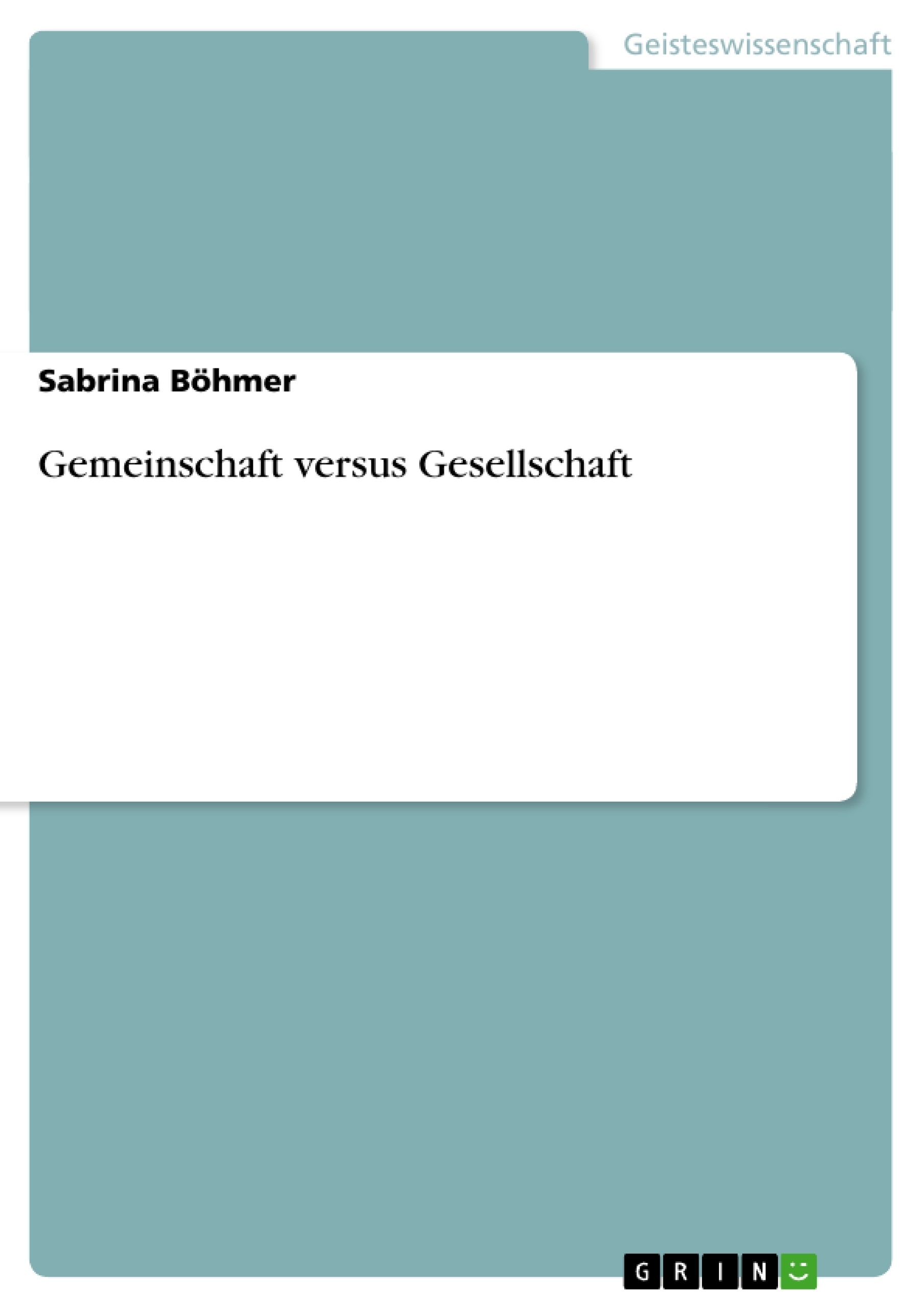Land — Stadt
GEMEINSCHAFT versus GESELLSCHAFT
Wo finden wir noch die ländlich-dörfliche Gemeinschaft auf der einen Seite, die grossstädtisch industrielle Gesellschaft auf der anderen? Das Bild der idyllischen Harmonie und Sicherheit auf dem Lande neben der in dauernder Wandlung und Entwicklung sich befindenden anonymen Welt der Stadt ist überholt — sollte es sich überhaupt je so zugetragen haben und hier nicht viel eher ein Mythos, genährt durch Kunst und Literatur, durch unsere Köpfe geistern.
Damit aber ist die in der Soziologie durch Ferdinand Tönnies” vertretene und lange Zeit von anderen übernommene Auffassung, der Gegensatz zwischen Stadt und Land liege vor allem im Strukturgegensatz von Gemeinschaft und Gesellschaft fraglich geworden. Viele sozialwissenschaftliche Dorfuntersuchungen der letzten Jahre bezeugen, dass Dörfer und Landgemeinden bereits derart verstädtert sind, dass man ihnen den Charakter einer “Gemeinschaft” im philosophischen Sinne kaum mehr zuschreiben kann.
Doch, wenn die Überlegungen grosser Denker vergangener Tage von der Urbanisierung überholt wurden, was bleibt uns, um Stadt und Land voneinander zu unterscheiden? Die Bevölkerungsdichte? Der Grad an Technologie?
Die Stadt, so belehrt uns das Lexikon, sei eine Siedlungsform, die sich “durch Grösse, Bevölkerungsstruktur, vor allem aber durch die Rechtsstellung (Städteordnung) vom Dorf unterscheidet»2. Das Land hingegen ist das landwirtschaftlich genutzte Gebiet — als Pendant zur Stadt.
Ist dies dann auch schon des Pudels Kern? Befinde ich mich immer dann auf dem Land, wenn um mich herum Sonnenblumen wachsen und Traktoren rattern? Und ist immer dann von Stadt die Rede, wenn ich Gefahr laufe, von einem Bus überrollt zu werden und statt Wiesenduft Fabrikluft schnuppere? Ja und Nein.
Zunächst der desillusionierende Verweis darauf, dass Soziologen im Hinblick auf eine reine Unterscheidung von Stadt- und Landleben nicht einfallsreicher sind als Demografen. Auch hier wird zunächst ganz und gar trocken von der Einwohnerzahl her argumentiert. Womit ein kleiner verträumter Ort der Schweiz wie Amriswil TG als Stadt zu bezeichnen ist - ein Umstand, der sich erst kürzlich bei der feierlich begangenen Partnerschaft mit der Stadt Radolfzell (D) in das Bewusstsein drängte.
Alle subjektiv relevanten Aspekte wie kulturelles Angebot, Infrastruktur oder Freizeitwert, werden erst in zweiter Linie in Augenschein genommen — wenn das Kind in den Brunnen gefallen oder besser der Ort offiziell bezeichnet ist.
Die Unterscheidung, wie viele Menschen auf einer bestimmten Fläche leben, hilft zwar, das Augenmerk auf individuelle Lebensbedingungen zu lenken, auf demographische Trends und Entwicklungstendenzen ebenso wie auf Auswirkungen sozialer und wirtschaftlicher Veränderungen — auf Aspekte eben, die unter subjektiven Gesichtspunkten die Unterscheidung von Stadt und Land bedingen. Aber es sagt noch lange nichts über die Qualität des Lebens aus.
Heinrich Wefing, Feuilletonkorrespondent der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ)” in Berlin, ist der festen Überzeugung, die urbane Stadt sei ein Ort, “der Rückzugsmöglichkeiten bietet, Nischen für Aussenseiter, für die im Dunkeln und jene, die sich nach den Lichtern der Strasse sehnen, nach der Lust und dem Laster.” Tatsächlich finden sich in kaum einer anderen Stadt so viele Gegensätze dicht an dicht und scheinbar friedlich koexistierend wie in Berlin. Doch ist dies auch ein Beweis für Lebensqualität? Vielleicht denken Sie ja jetzt gerade, Lebensqualität, das ist der See vor der Tür, die Berge am Horizont, der Hahnenschrei am Morgen oder der Plausch im Lädeli um die Ecke.
Tatsächlich ist die empfundene Lebensqualität eine subjektive Komponente, und so werden auch in den Sozialwissenschaften zunächst die «harten» Fakten der Unterscheidung von Stadt und Land betrachtet, bevor Dimensionen wie Altersstruktur, Siedlungs- und Verkehrsfläche, Landwirtschaftsfläche, Waldgebiete, Wasserfläche oder Schadstoffimmissionen ins Zentrum der Arbeit rücken.
Zu dichtes Zusammenleben beispielsweise kann Aggressionen fördern, ein grösseres Bedürfnis nach Kontrolle und Strukturierung hervorrufen. Eine sehr geringe Bevölkerungsdichte dagegen kann zu Isolation und Gefühlen der Einsamkeit führen, Probleme der Infrastruktur erzeugen oder Zurückgezogenheit und Rückständigkeit entstehen lassen.
Ländliche Gebiete zeichnen sich vor allem durch eine geringe Siedlungs- und Verkehrsfläche aber einem noch immer überdurchschnittlich hohen Anteil an landwirtschaftlich genutzter Fläche aus. Auch wenn heute die meisten Bewohner kleiner Gemeinden nicht mehr oder nur teilweise von der Landwirtschaft leben können.
Gleichzeitig hat ein Trend eingesetzt, der vor allem besser Verdienende das Leben auf dem Land als attraktives Pendant zur Arbeit in der Stadt vermittelt. Immer häufiger — und das lässt sich wiederum mit Zahlen der Demografie belegen — gibt es auf dem Land vor allem sehr alte Menschen oder diejenigen, die zwischen 30 und 50 Jahre alt sind. Das Land als Altersruhesitz und Erholungsraum für gestresste Manager...
Im Hinblick auf das kulturelle Angebot, wozu auch die Erholungsfläche gehört, kann keine genereralisierende Antwort zur Unterscheidung von Stadt und Land gegeben werden. Der Wertewandel in der Gesellschaft hat auch dazu geführt, dass sich die Ansprüche an die Funktion von «Erholung» verändert haben. Durch die Entwicklung hin zur aktiv gestalteten Freizeit, spielen die Freiflächen eine immer grössere Rolle. Erstaunlicherweise haben hier die Städte eine Vorreiterrolle, was die ausgewiesenen Flächen zur Freizeitnutzung betrifft. Aber ein hoher Prozentsatz an Erholungsfläche heisst nicht automatisch hoher Freizeitwert.
Ländliche Umgebung hat statt rollerskategeeigneter Strassen Wälder und Seen zu bieten. Kinder können auf der Wiese vor der Tür statt auf eigens für sie angelegte und eingezäunte Spielplätze. Auch das Angebot von Kinos und Theatern zentriert sich auf Grossstädte — wobei sich dieses Bild hinsichtlich Museen und Bibliotheken eindeutig verschiebt.
Insgesamt muss aber leider — zumindest für Deutschland — zusammengefasst werden, dass Kultur in den Metropolen stattfindet. “Die Provinz ist kulturarm, und zwar kulturarm an Bildungskultur.” (Korczak 1995, 148)
Durch die sich immer stärker abzeichnende Attraktivität der ländlichen Regionen für Berufstätige bleibt allerdings abzuwarten, ob es auch in Europa in absehbarer Zukunft «Geisterstädte» wie beispielsweise Brasilia geben wird. Individuelle und dorfgemeinschaftlich organisierte Freizeitgestaltung könnte den Städten auch diesen (letzten) Rang ablaufen.
1) Tönnies, Ferdinand (1935).
2) Das Bertelsmann Lexikon (1968),1 197.
Literatur:
- Bollmann, Stefan (Red.) (1999): Kursbuch
Stadt: Stadtleben und Stadtkultur an der Jahrtausendwende. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt.
- Das Bertelsmann Lexikon (1968): Band 4, 6 Gütersloh: C. Bertelsmann Verlag.
- Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (1986): Lebensbedingungen in Stadtgebieten. Dublin: Loughlinstown House Shankill, Co.
- Korczak, Dieter (1995): LebensqualitätsAtlas. Opladen: Westdeutscher Verlag GmbH.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes "Land — Stadt: GEMEINSCHAFT versus GESELLSCHAFT"?
Der Text untersucht den Gegensatz zwischen ländlicher Gemeinschaft und städtischer Gesellschaft, wie er traditionell in der Soziologie durch Ferdinand Tönnies vertreten wurde. Er hinterfragt, ob dieser Gegensatz in der heutigen Zeit noch gültig ist, da Dörfer und Landgemeinden zunehmend verstädtern.
Wie definieren Lexika Stadt und Land?
Laut Lexikon unterscheidet sich die Stadt vom Dorf durch ihre Grösse, Bevölkerungsstruktur und vor allem durch ihre Rechtsstellung (Städteordnung). Das Land hingegen wird als landwirtschaftlich genutztes Gebiet definiert, als Gegenstück zur Stadt.
Spielt die Einwohnerzahl eine Rolle bei der Unterscheidung zwischen Stadt und Land?
Ja, die Einwohnerzahl ist ein wichtiges Kriterium, das von Demografen und Soziologen zur Unterscheidung herangezogen wird. Dies kann jedoch dazu führen, dass kleinere, aber dicht besiedelte Orte als Städte gelten.
Welche subjektiven Aspekte werden bei der Betrachtung von Stadt und Land berücksichtigt?
Subjektiv relevante Aspekte wie kulturelles Angebot, Infrastruktur und Freizeitwert werden in zweiter Linie berücksichtigt, nachdem die formale Definition (z.B. Einwohnerzahl) festgelegt wurde.
Wie beeinflusst die Bevölkerungsdichte die Lebensqualität?
Eine zu hohe Bevölkerungsdichte kann Aggressionen und ein grösseres Bedürfnis nach Kontrolle fördern. Eine zu geringe Bevölkerungsdichte kann zu Isolation, Einsamkeit und Problemen mit der Infrastruktur führen.
Was zeichnet ländliche Gebiete aus?
Ländliche Gebiete zeichnen sich vor allem durch eine geringe Siedlungs- und Verkehrsfläche sowie einen hohen Anteil an landwirtschaftlich genutzter Fläche aus, auch wenn viele Bewohner nicht mehr von der Landwirtschaft leben.
Warum zieht es besser Verdienende aufs Land?
Das Leben auf dem Land wird für besser Verdienende als attraktives Pendant zur Arbeit in der Stadt vermittelt. Das Land dient als Altersruhesitz oder Erholungsraum.
Wie unterscheidet sich das kulturelle Angebot in Stadt und Land?
Grossstädte bieten in der Regel ein grösseres Angebot an Kinos und Theatern, während sich das Bild hinsichtlich Museen und Bibliotheken verschiebt. Allgemein findet Kultur hauptsächlich in den Metropolen statt.
Welche Rolle spielt die Freizeitgestaltung bei der Unterscheidung von Stadt und Land?
Durch die Entwicklung hin zur aktiv gestalteten Freizeit spielen Freiflächen eine immer grössere Rolle. Städte haben hier oft eine Vorreiterrolle bei der Ausweisung von Flächen zur Freizeitnutzung, jedoch bedeutet eine hohe Erholungsfläche nicht automatisch einen hohen Freizeitwert.
Welche Entwicklungstendenzen sind in Bezug auf Stadt und Land zu beobachten?
Es bleibt abzuwarten, ob die zunehmende Attraktivität ländlicher Regionen für Berufstätige dazu führt, dass es auch in Europa "Geisterstädte" geben wird. Individuelle und dorfgemeinschaftlich organisierte Freizeitgestaltung könnten den Städten auch diesen Vorteil nehmen.
Welche Literatur wird im Text zitiert?
Die folgenden Werke werden im Text zitiert:
- Bollmann, Stefan (Red.) (1999): Kursbuch Stadt: Stadtleben und Stadtkultur an der Jahrtausendwende. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt.
- Das Bertelsmann Lexikon (1968): Band 4, 6 Gütersloh: C. Bertelsmann Verlag.
- Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (1986): Lebensbedingungen in Stadtgebieten. Dublin: Loughlinstown House Shankill, Co.
- Korczak, Dieter (1995): LebensqualitätsAtlas. Opladen: Westdeutscher Verlag GmbH.
- Tönnies, Ferdinand (1935): Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie. Neudruck der & Auflage. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1988.
- Quote paper
- Dr. Sabrina Böhmer (Author), 1999, Gemeinschaft versus Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110343