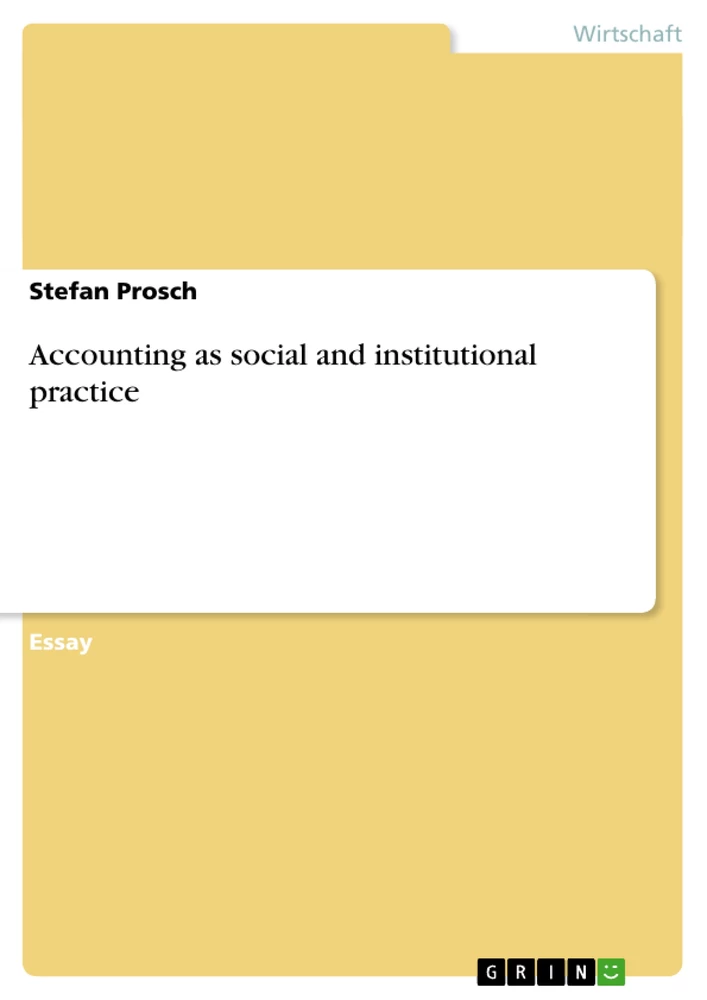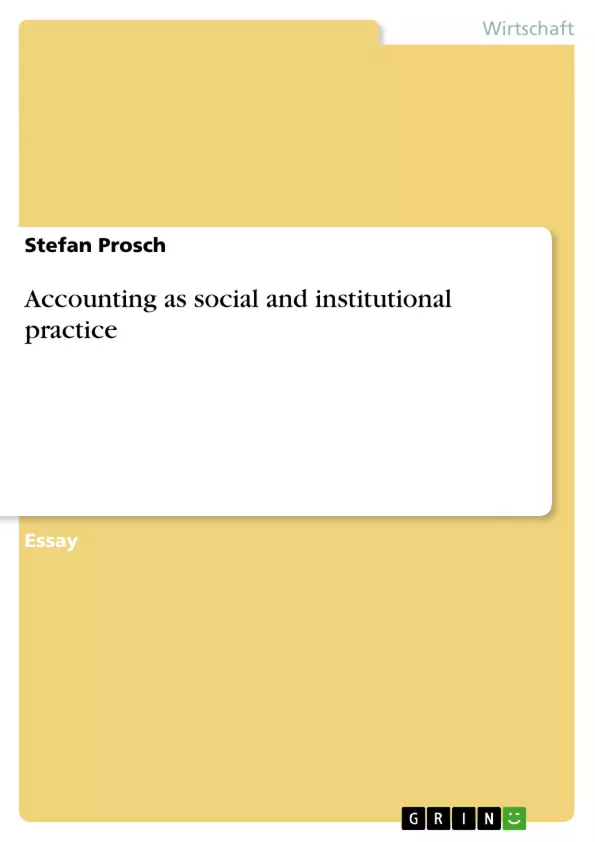Dieser Aufsatz beginnt mit der Feststellung des Autors, dass es in einer Zeitspanne von weniger als einem Jahrzehnt zu fundamentalen Änderungen im Verständnis des Accountings kam.
Peter Miller stellt dabei klar, dass die Analyse des Accountings unter dem sozialen und institutionellen Gesichtspunkt Gegenstand vieler Studien und Artikel war, und dass sein Text dabei lediglich eine Auswahl besonderer „Schlüsselstudien“ darstellt.
Dabei wird auf die verschiedenen Arten verwiesen, wie man sich versucht dem Thema des Accountings zu näher; er definiert dabei diese Versuche als eine Völkerkunde der Accouting-Praktiken, als politische Ökonomie dieser Praktiken.
Das Accounting wird heute als soziale und institutionelle Verfahrensweise angesehen, die auf sozialen Beziehungen aufbaut und nicht aus diesen abgeleitet ist. Im Grunde genommen weist dies auf eben diese Änderung im Verständnis des Accounting hin; weg von der „emotionslosen“ Betrachtung als rein neutrales Abbildungsinstrument und Dokumentierungsinstrument wirtschaftlicher Aktivitäten und Prozesse.
Dem Accounting wird dabei die Fähigkeit zugeschrieben, auf soziale Beziehungen der Individuen, die sich im unmittelbaren Wirkungskreis befinden, einzuwirken, diese zu verändern.
Der Autor identifiziert in diesem Zusammenhang drei besondere, andere Sichtweisen auf die Funktion des Accoutings als soziale und institutionelle Verfahrensweise.
Accounting as social and institutional practice:
an introduction
Aus: A. G. Hopwood/P. Miller: Accounting as Social and Institutional Practice.
Cambridge: University Press, 1994
Dieser Aufsatz beginnt mit der Feststellung des Autors, dass es in einer Zeitspanne von weniger als einem Jahrzehnt zu fundamentalen Änderungen im Verständnis des Accountings kam.
Peter Miller stellt dabei klar, dass die Analyse des Accountings unter dem sozialen und institutionellen Gesichtspunkt Gegenstand vieler Studien und Artikel war, und dass sein Text dabei lediglich eine Auswahl besonderer „Schlüsselstudien“ darstellt.
Dabei wird auf die verschiedenen Arten verwiesen, wie man sich versucht dem Thema des Accountings zu näher; er definiert dabei diese Versuche als eine Völkerkunde der Accouting-Praktiken, als politische Ökonomie dieser Praktiken;
Das Accounting wird heute als soziale und institutionelle Verfahrensweise angesehen, die auf sozialen Beziehungen aufbaut und nicht aus diesen abgeleitet ist. Im Grunde genommen weist dies auf eben diese Änderung im Verständnis des Accounting hin; weg von der „emotionslosen“ Betrachtung als rein neutrales Abbildungsinstrument und Dokumentierungsinstrument wirtschaftlicher Aktivitäten und Prozesse.
Dem Accounting wird dabei die Fähigkeit zugeschrieben, auf soziale Beziehungen der Individuen, die sich im unmittelbaren Wirkungskreis befinden, einzuwirken, diese zu verändern.
Der Autor identifiziert in diesem Zusammenhang drei besondere, andere Sichtweisen auf die Funktion des Accoutings als soziale und institutionelle Verfahrensweise.
In der ersten Betrachtungsweise sieht er das Accounting als eine Art Technologie; als eine Art Kalkulationstechnik, ein Art des Intervenierens, als Vorrichtung zum Agieren. Besonders in bestimmten westlichen Gesellschaften ist diese Sicht des Accountings vorrangig. Durch die Berechnung der Kosten und Gewinne, der Bewertung der Leistungen usw. kann das Accounting im Unternehmen Strukturen aufbauen, evaluieren und dem Unternehmen selber Strukturen auferlegen. Das Accounting weist sich dabei selber einer Art Führungsfunktion, eine Normierungsfunktion und eine Art Leitbild der Führung zu. Das Accounting ermöglicht in diesem Zusammenhang eine spezielle Art der Führung individueller Aktivitäten
Zweitens sieht Miller eine Fokussierung auf das Accounting als eine Art Sprachspiel mit einer besonderen Grammatik. Mit dem Accouting als „Sprache“ zur Abbildung der relevanter Kostenstrukturen, als hinreichende Voraussetzung zur Erfüllung dieser Notwendigkeit der Abbildung. Dem Accounting wird eine Funktion zugewiesen, die über die reine Funktion als Kalkulationsinstrument zur rechnerischen Erfassung und kalkulatorischen Berechnung hinausgeht. Die Funktion, Bedeutung und Anwendung des Accounting hat sich dabei über diese Bedeutung als kalkulatorische Grüsse ausgedehnt;
Drittens schließlich, mit Bezug auf die Funktion des Accountings als soziale und institutionelle Verfahrensweise, nimmt der Autor Stellung zur Funktion des Accountings im „sozialen“ Kontext; wie die Wirtschaftseinheiten innerhalb eines Unternehmens geführt werden. Durch die verschiedenen Kalkulationstechniken gelingt eine unter bestimmten Voraussetzungen „vollständige“ Darstellung der Organisation, deren Teilorganisationen, Abteilungen und Mitarbeitern, wobei unter „vollständig“ eine für bestimmte Notwendigkeiten ausreichende Bedingung verstanden wird. Die Unternehmung wird als eine Art „monetärer Fluss“ dargestellt, womit eine Darstellung des Unternehmens als finanzielle Größe ermöglicht wird. In der Transformierung der physikalischen Ströme in finanzielle Ströme, schafft das Accounting ein spezielles Gebiet der ökonomischen Kalkulation, mit dem bestimmte Urteile gefällt, Aktionen getätigt und gerechtfertigt und Strategien ausgearbeitet werden können. Im Wandel dieser Formen und Anwendungen ergibt sich der sozial-technische Kontext, die Relation zwischen diesen.
Diese drei eben genannten Sichtweisen wirken dabei ergänzend aufeinander ein. Es werden Wege ermittelt, wie die Ziele erreicht werden können, wobei die äußere Umwelt nicht aus den Augen verloren werden darf, denn sollte sich diese verändern oder Veränderungen abzeichnen, so muss die Organisation in der Lage sein, in sozialer oder institutioneller Art auf eben diese Änderungen zu reagieren.
Peter Miller versucht in diesem Aufsatz auf die verbindende Funktion des Accountings hinzuweisen; als Bindeglied zwischen Abteilungen und Mitarbeitern. Das Accounting erhöhte dabei fortwährend seine Bedeutung, obwohl sich nicht so sehr das Accounting selbst (als „neutrales“ Instrument der Erfassung, Kalkulation, Interpretation) geändert hat; vielmehr liegt die Veränderung im Verständnis dieses Instrument. Vielmehr lässt sich dieser Wandel und diese Änderung als ein langsames Entfernen von der rein technischen Sichtweise, hin zu einer sozialen Bedeutung in Form eines Führungsinstruments erkennen. Augrund seiner weitreichenden Aufgaben nimmt das Accounting zwingend, aber auch notwendigerweise, Einfluss auf das soziale System.
Peter Miller versucht von der Bedeutung des Accountings als reines Kennzahlensystem auf die Relevanz des selben Accountings als Instrument zur Erstellung von Zielen und Vorgaben hinzuweisen. Dem Controller wird dabei durch seine Tätigkeit eine besondere Rolle und Aufgabe zugesprochen: er übt eine Art Geschäftsführung auf das soziale System innerhalb der Unternehmung aus. Das Accounting wird dabei als eine Art Lenkrad der Organisation dargestellt.
Das Accounting hat als Bindeglied innerhalb der Organisation die Aufgabe, diese mit den richtigen und relevanten Informationen zu versorgen, wobei sich diese Informationen nicht aus der „neutralen“ Interpretation der gewonnen Zahlen und Kennzahlen ableiten lassen, sondern durch Kombination und Kommunikation innerhalb dieses Unternehmens.
Die Funktionsfähigkeit des Accountings ist in einem Unternehmen erst gewährleistet, wenn es gelingt die drei oben beschriebenen Sichtweisen miteinander in Relation, in Abhängigkeit und Verhältnis zueinander zu bringen.
Erst das wechselwirkende Zusammenspiel zwischen dieser Sichtweisen gewährleistet ein Accounting, welches den Anforderungen genügen kann.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Aufsatz "Accounting as social and institutional practice: an introduction"?
Der Aufsatz von A. G. Hopwood und P. Miller untersucht, wie sich das Verständnis des Accountings in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert hat. Es wird Accounting nicht mehr nur als neutrales Instrument zur Abbildung wirtschaftlicher Aktivitäten betrachtet, sondern als soziale und institutionelle Verfahrensweise, die soziale Beziehungen beeinflusst und auf ihnen aufbaut.
Welche drei Sichtweisen auf das Accounting werden in dem Aufsatz identifiziert?
Der Autor identifiziert drei Sichtweisen: 1) Accounting als Technologie oder Kalkulationstechnik zur Strukturierung und Bewertung von Unternehmen. 2) Accounting als eine Art Sprachspiel mit einer besonderen Grammatik, das über die reine Kalkulation hinaus Bedeutung erlangt hat. 3) Accounting im sozialen Kontext, das durch Kalkulationstechniken eine "vollständige" Darstellung der Organisation ermöglicht und Unternehmen als monetäre Flüsse darstellt.
Wie beeinflusst das Accounting soziale Beziehungen im Unternehmen?
Dem Accounting wird die Fähigkeit zugeschrieben, auf soziale Beziehungen der Individuen, die sich im unmittelbaren Wirkungskreis befinden, einzuwirken und diese zu verändern. Es wird als ein Führungsinstrument angesehen, das Einfluss auf das soziale System innerhalb der Unternehmung hat.
Welche Rolle spielt der Controller im Kontext des Accounting als soziale Praxis?
Der Controller übt eine Art Geschäftsführung auf das soziale System innerhalb der Unternehmung aus. Das Accounting wird als eine Art Lenkrad der Organisation dargestellt.
Warum ist ein gut funktionierendes Accounting wichtig für Unternehmen?
Ein gut funktionierendes und wirksames Accounting stellt eine notwendige Voraussetzung für ein Unternehmen dar, da es das Bindeglied innerhalb der Organisation ist und diese mit den richtigen und relevanten Informationen versorgt. Diese Informationen ergeben sich jedoch nicht nur aus der "neutralen" Interpretation von Zahlen, sondern durch Kombination und Kommunikation innerhalb des Unternehmens. Ein funktionsfähiges Accounting berücksichtigt die drei oben genannten Sichtweisen in ihrem Zusammenspiel.
- Citar trabajo
- Stefan Prosch (Autor), 2003, Accounting as social and institutional practice, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110532