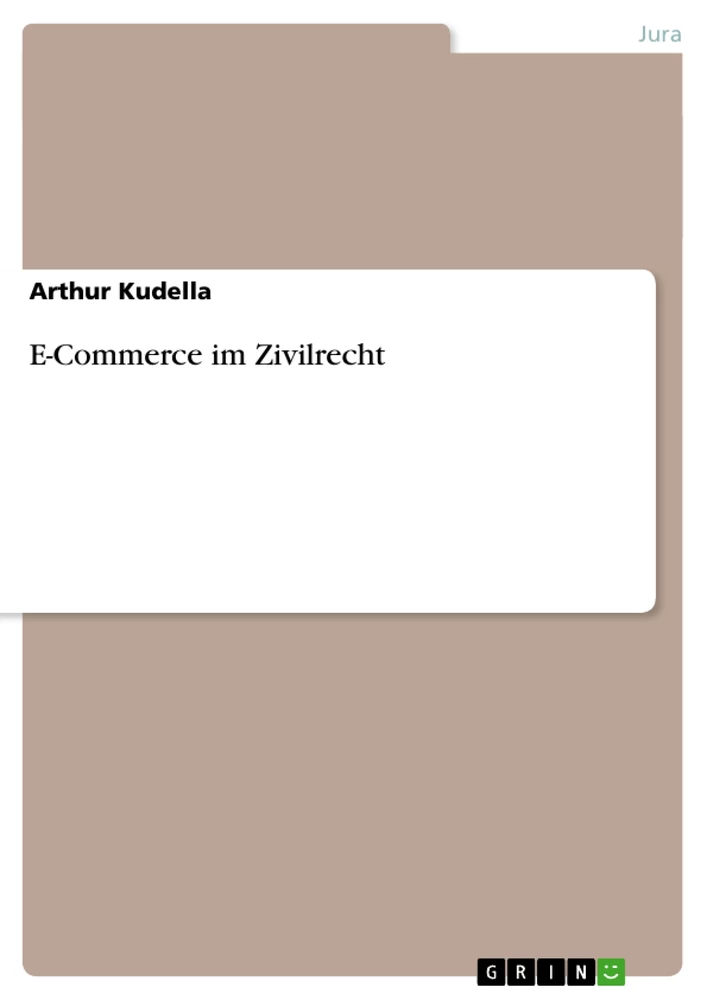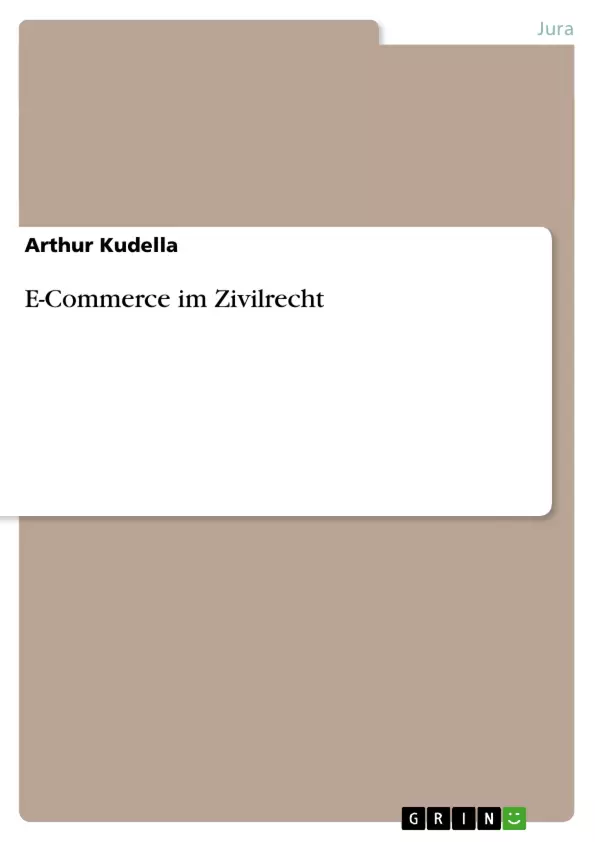Das world wide web (www) wurde Anfang der neunziger Jahre ins Leben gerufen. Bis zum heutigen Zeitpunkt hat sich dieses zum wichtigsten Netzwerk des weltumspannenden Internets entwickelt. Es war, ist und wird weiterhin ein wesentlicher Motor für die steigende Bedeutung des Internets sein. Eine ebenso hohe Akzeptanz wird der E-Mail bescheinigt. Weltweit haben über 500 Millionen Personen eine E-Mail-Adresse (Stand: August 2002), und es werden täglich mehr.
Dadurch gewinnt der E-Commerce quer durch alle Branchen eine immer größere Bedeutung. Die klassische Geschäftsanbahnung sowie Vertriebsformen geraten in den Hintergrund und werden zunehmend durch elektronisch durchgeführte Geschäftsabschlüsse ersetzt. Außerdem führt der Handel über das Internet zu einer schneller anwachsenden Globalisierung der Märkte und durch die hohe Transparenz zu häufig wechselnden Geschäftspartnern. Dies birgt für jeden eine Reihe von Chancen und Risiken.
Hier ist die Aufgabe der Jurisprudenz und der Judikatur, mit einem verlässlichen Instrumentarium der steigenden wirtschaftlichen Bedeutung des Mediums Internet zur Seite zu stehen, um ein Stocken der Entwicklung in diesem Bereich durch rechtliche Risiken oder Hemmnisse entgegenzuwirken. Diese Ausarbeitung gibt einen Überblick über die wichtigsten zivilrechtlichen Aspekte des elektronischen Geschäftsverkehrs. Jedoch läuft im gegenwärtigen Zeitalter der geradezu hektischen Reformen auf nationaler, supranationaler und internationaler Ebene jede Ausarbeitung produktionsbedingt der Gesetzgebung hinterher. Daher bittet der Verfasser zu beachten, dass stets nur eine Momentaufnahme möglich ist.
In dieser Ausarbeitung wird der Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsstand bis einschließlich Oktober 2002 berücksichtigt. Doch bevor der zivilrechtliche Bereich genauer betrachtet wird, ist zunächst zu klären, was unter E-Commerce im Einzelnen zu verstehen ist.
Inhaltsverzeichnis
- EINFÜHRUNG
- E-COMMERCE
- Begriffsbildung und Abgrenzung
- Transaktionsphasen
- Transaktionsparteien
- Internet und seine Dienste
- Begriffsbildung und Abgrenzung
- INFORMATIONSPHASE
- Spamming
- Links
- Hyperlinks
- Deep-Links
- Frames
- Counter
- Manipulation von Suchmaschinen
- Erzeugung rankingerhöhender Faktoren
- Metatags
- Beschreibende Angaben in Domain-Namen
- Powershopping
- VEREINBARUNGSPHASE
- Angebot oder, invitatio ad offerendum'
- Willenserklärungen im Internet
- Abgabe und Zugang
- Erklärung gegenüber Abwesenden oder Anwesenden
- Machtbereich des Empfängers
- Zugangszeitpunkt
- Widerruf
- Anfechtung
- Formerfordernisse
- Beweiskraft
- Abgabe und Zugang
- Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Business-to-Consumer
- Ausdrücklicher Hinweis
- Möglichkeit zumutbarer Kenntnisnahme
- Business-to-Business
- Business-to-Consumer
- Fernabsatzrecht
- Anwendungsbereich
- Informationspflichten und technische Vorgaben
- Widerrufs- bzw. Rückgaberecht
- Verbraucherkreditrecht
- Haustürwiderrufsrecht
- ABWICKLUNGSPHASE
- KOLLISIONSRECHTLICHE FRAGEN
- Vertragliche Schuldverhältnisse
- UN-Kaufrecht
- EGBGB
- Business-to-Business
- Business-to-Consumer & Consumer-to-Consumer
- Außervertragliche Schuldverhältnisse
- Herkunftslandprinzip
- Sinn und Zweck
- Verhältnis zum Internationalen Privatrecht
- Vertragliche Schuldverhältnisse
- FAZIT UND AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Abschlussarbeit befasst sich mit dem Thema E-Commerce im Zivilrecht und analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen des elektronischen Geschäftsverkehrs im deutschen Rechtssystem. Die Arbeit zielt darauf ab, die rechtlichen Besonderheiten des E-Commerce im Kontext der verschiedenen Transaktionsphasen (Information, Vereinbarung, Abwicklung) darzustellen.
- Rechtliche Rahmenbedingungen des E-Commerce
- Transaktionsphasen im elektronischen Geschäftsverkehr
- Anwendbarkeit des deutschen Zivilrechts auf E-Commerce-Verträge
- Spezifische Rechtsprobleme im E-Commerce, wie z. B. Datenschutz, Haftungsfragen und Vertragsabschluss im Internet
- Kollisionsrechtliche Fragen im E-Commerce
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in die Thematik und erläutert die Relevanz des E-Commerce im modernen Wirtschaftsleben. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Begriffsbildung und Abgrenzung des E-Commerce, wobei die Transaktionsphasen und -parteien im Detail beleuchtet werden. Kapitel 3 widmet sich der Informationsphase im E-Commerce und behandelt Themen wie Spamming, Links, Counter und Manipulation von Suchmaschinen. Kapitel 4 analysiert die Vereinbarungsphase im E-Commerce, inklusive der rechtlichen Aspekte von Willenserklärungen, Allgemeinen Geschäftsbedingungen und des Fernabsatzrechts.
Schlüsselwörter
E-Commerce, Zivilrecht, Transaktionsphasen, Informationsphase, Vereinbarungsphase, Abwicklungsphase, Willenserklärungen, Allgemeine Geschäftsbedingungen, Fernabsatzrecht, Verbraucherkreditrecht, Haustürwiderrufsrecht, Kollisionsrecht, UN-Kaufrecht, EGBGB, Datenschutz, Haftung, Vertragsschluss im Internet.
Häufig gestellte Fragen
Wann kommt ein Vertrag im Internet zustande?
Ein Vertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen (Angebot und Annahme) zustande. Im Internet ist oft zu klären, ob die Website bereits ein Angebot oder nur eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots (invitatio ad offerendum) darstellt.
Was ist das Fernabsatzrecht?
Das Fernabsatzrecht schützt Verbraucher bei Verträgen, die ausschließlich über Fernkommunikationsmittel (wie Internet oder Telefon) geschlossen werden, insbesondere durch weitreichende Informationspflichten und ein Widerrufsrecht.
Sind Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) im Internet immer wirksam?
Nein, AGB müssen wirksam in den Vertrag einbezogen werden. Im B2C-Bereich erfordert dies einen ausdrücklichen Hinweis und die Möglichkeit der zumutbaren Kenntnisnahme vor Vertragsschluss.
Welches Recht gilt bei internationalen Internet-Käufen?
Dies regelt das Kollisionsrecht (z.B. EGBGB oder UN-Kaufrecht). Bei Verbrauchern gilt oft das Recht des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern der Unternehmer dort tätig ist.
Was sind die rechtlichen Probleme bei Deep-Links und Frames?
Diese Techniken können Urheberrechte oder Wettbewerbsrecht berühren, wenn fremde Inhalte so eingebunden werden, dass die Herkunft verschleiert wird oder Werbeeinnahmen des Originalbetreibers umgangen werden.
- Citation du texte
- Arthur Kudella (Auteur), 2003, E-Commerce im Zivilrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11060