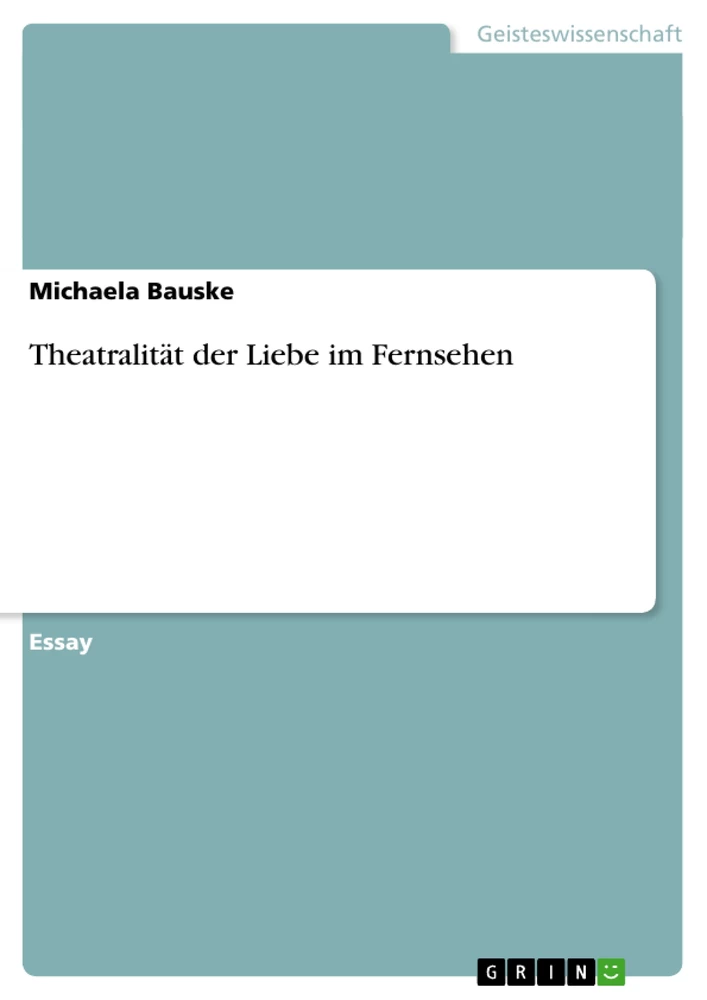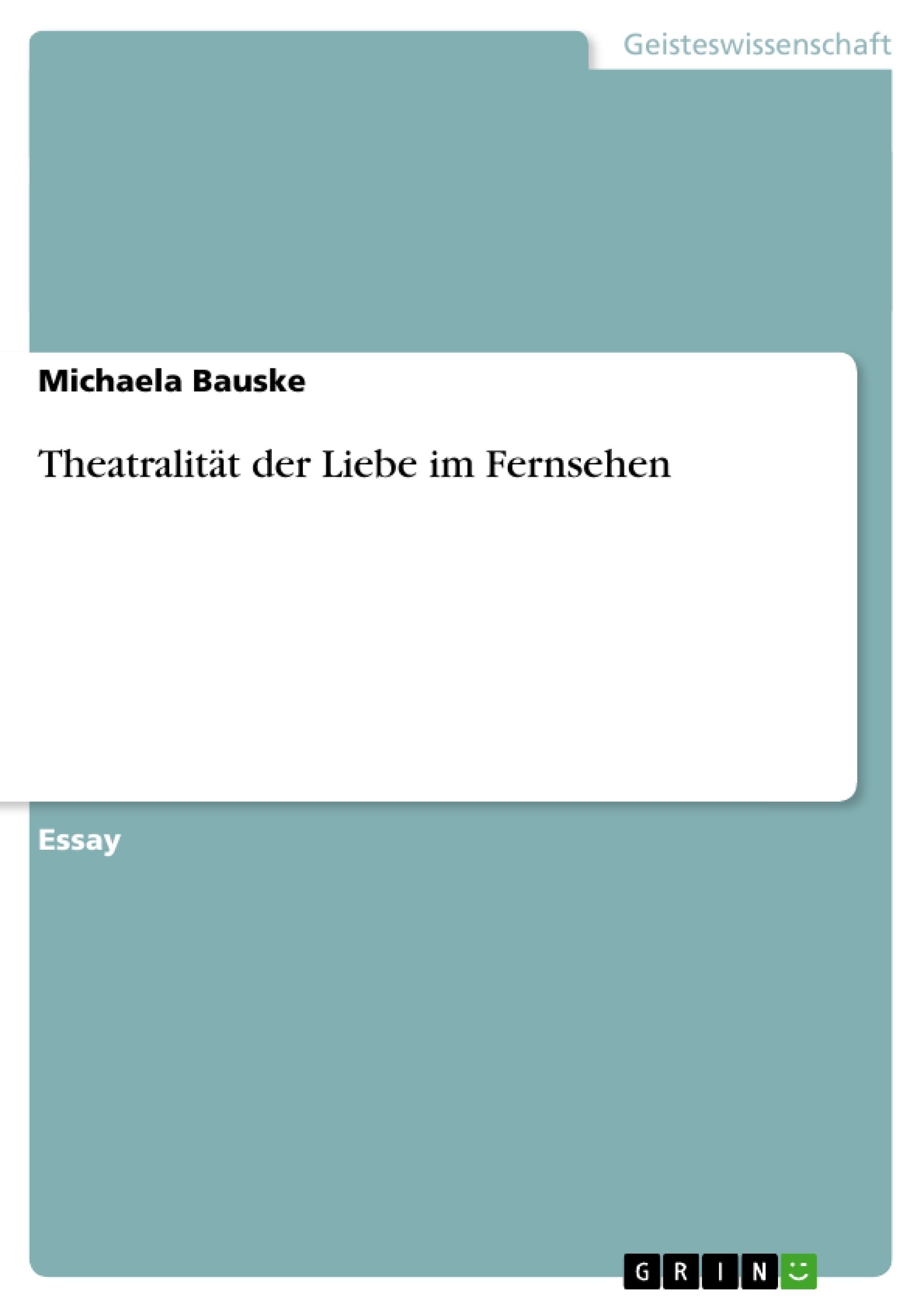Flimmerkiste an. Der Zuschauer wird von einer reißenden, gleißenden Penetranz von Liebesinszenierungen mitgerissen. Schaut mal, wir haben uns so lieb! Promi-Paare machen es vor und sorgen für Schlagzeilen. Tom Cruise und Katie Holmes tragen ihre Liebe in aller Öffentlichkeit zur Marke. Marc Terenzi und Sarah Connor in einer neunteiligen Doku-Soap als TV- Helden. Und bei Kai Pflaume wird’s dann richtig theatralisch in „Nur die Liebe zählt“.
Ist die Liebe des 21. Jahrhunderts süchtig nach Enthüllung? Inspiriert durch einen Öffentlichkeitsdrang? Hat sich das romantische Ideal von der Liebe durch all die Offenbarungen auf dem Bildschirm verändert, welche Ursache und Wirkung lässt sich erkennen?
Wir hatten heute dreimal Sex! Extase! Extase! Für ein bisschen Anerkennung und Beachtung ihrer Person gehen immer mehr Menschen in Talkshows und geben einen Teil ihres Ichs, ihres Selbst, ihrer Emotionen preis. Die stetige Entwicklung in den letzten Jahrzehnten der Medienlandschaft hat dieses Phänomen erst möglich gemacht.
Der Kommunikationsforscher Jo Reichertz spricht in seiner hermeneutischen, wissenssoziologischen Studie über mediale Liebesinszenierungen vom performativen Realitätsfernsehen, in dem Sinne, dass solche Fernsehformate eine unmittelbare Verbindung zum realen Liebesleben darstellen, d.h. Peter setzt sein Vorhaben Claudia seine Liebe zu gestehen vor laufender Kamera in die Tat um, dadurch erhält dieses Szenario einen verbindlichen als auch verpflichtenden Charakter, da Millionen von Augen gebannt vor dem Bildschirm sitzen und Zeuge dieses Geständnisses sind. Die volle Aufmerksamkeit gehört in diesen Minuten nur Peter und Claudia. Warum hat aber ein solches Bekenntnis vor der Kamera einen höheren Stellenwert als etwa ein romantisches Candle light - Dinner zu zweit? Wäre das Liebesgeständnis ohne Kamera nur halb so viel wert?
Die Theatralik der Liebe in der Flimmerkiste
Flimmerkiste an. Der Zuschauer wird von einer reißenden, gleißenden Penetranz von Liebesinszenierungen mitgerissen. Schaut mal, wir haben uns so lieb! Promi- Paare machen es vor und sorgen für Schlagzeilen. Tom Cruise und Katie Holmes tragen ihre Liebe in aller Öffentlichkeit zur Marke. Marc Terenzi und Sarah Connor in einer neunteiligen Doku- Soap als TV- Helden. Und bei Kai Pflaume wird’s dann richtig theatralisch in „Nur die Liebe zählt“.
Ist die Liebe des 21. Jahrhunderts süchtig nach Enthüllung? Inspiriert durch einen Öffentlichkeitsdrang? Hat sich das romantische Ideal von der Liebe durch all die Offenbarungen auf dem Bildschirm verändert, welche Ursache und Wirkung lässt sich erkennen?
Wir hatten heute dreimal Sex! Extase! Extase! Für ein bisschen Anerkennung und Beachtung ihrer Person gehen immer mehr Menschen in Talkshows und geben einen Teil ihres Ichs, ihres Selbst, ihrer Emotionen preis. Die stetige Entwicklung in den letzten Jahrzehnten der Medienlandschaft hat dieses Phänomen erst möglich gemacht.
Der Kommunikationsforscher Jo Reichertz spricht in seiner hermeneutischen, wissenssoziologischen Studie über mediale Liebesinszenierungen vom performativen Realitätsfernsehen, in dem Sinne, dass solche Fernsehformate eine unmittelbare Verbindung zum realen Liebesleben darstellen, d.h. Peter setzt sein Vorhaben Claudia seine Liebe zu gestehen vor laufender Kamera in die Tat um, dadurch erhält dieses Szenario einen verbindlichen als auch verpflichtenden Charakter, da Millionen von Augen gebannt vor dem Bildschirm sitzen und Zeuge dieses Geständnisses sind. Die volle Aufmerksamkeit gehört in diesen Minuten nur Peter und Claudia. Warum hat aber ein solches Bekenntnis vor der Kamera einen höheren Stellenwert als etwa ein romantisches Candle light - Dinner zu zweit? Wäre das Liebesgeständnis ohne Kamera nur halb so viel wert?
Nach Auffassung einiger Kulturwissenschaftler und Soziologen werden Menschen von einem quasi profitablen Prinzip gesteuert, d.h. Peter bietet Geheimnisse und seine Gefühle vor Millionen von Zuschauern dar, auf der einen Seite richtet er Aufmerksamkeit auf sich, auf der anderen Seite steht vielleicht das Motiv der steilen Fernsehkarriere dahinter. Setzt sich Peter also nur ins Zeug um „entdeckt“ zu werden und als der neue Shooting- Star am Fernsehhimmel zu glänzen?
Zum anderen gibt es aber auch die Auffassung, dass solche Inszenierungen von Liebe heutzutage viel häufiger in der Alltagspraxis vorkommen und diese immer mehr als selbstverständlich angesehen werden.
Aber welche positiven Aspekte birgt das performative Realitätsfernsehen in sich? Vielleicht hat Peter nur an Kai Pflaumes starker Schulter den Mut aufbringen können diesen Weg zu gehen und Claudia die Liebe zu beichten. „Nur die Liebe zählt“ als Bearbeitungshilfe der alltäglichen Probleme, Ängste und Sehnsüchte? Sozusagen eine Psychotherapie für die Sinne und Emotionen der Liebenden? Mein Fazit: Ein Metier für Süchtige nach Anerkennung und Aufmerksamkeit, nur Freaks und Dramaturgen mögen glauben ihre Probleme in der Öffentlichkeit lösen zu können. Möchte ich normativ meinen, dass diese Menschen ihre Probleme nur inszenieren und vielleicht gerade dadurch diese erst entstehen lassen, nur für ein „Hier bin ich, hört und seht mich an! Bitte!“ Aufmerksamkeit um jeden Preis, weil sie sie woanders nicht bekommen?
Jo Reichertz beleuchtet diese Problematik aus der Sicht der Kultur der jeweiligen Gesellschaft. Jede Gesellschaft liebt anders, dieses wird durch Erzählungen, Texte und Medien verdeutlicht. Die Liebe in unterschiedlicher Art und Weise zu rezipieren dient zum einen der Orientierung für das Suchen und Finden der Liebe, zum anderen spiegelt es Liebeskultur der Menschen in einer Gesellschaft wieder.
Sollte man demnach performatives Realitätsfernsehen als neue Form der Liebe und ihren Handlungsmustern im 21. Jahrhundert deuten dürfen?
Ist hier der Schlüssel für Ursache und Wirkung von Beziehungsproblemen versteckt? Denn die mediale Inszenierung und Idealisierung der Liebe dienen dem Rezipienten als eine Art Vorlage, die den Vergleich der eigenen Beziehung mit dem mustergültigen Ideal der Show hervorruft. Bei Differenzen zwischen Showideal und Realität kann das leicht zu Beziehungsproblemen führen. Nicht das dieses Fernsehformat für das Vorherrschen der Millionen Singlehaushalte und alle anderen liebeskranken Seelen verantwortlich wäre, dennoch sehe ich einen pathologischen Grundtenor für die Liebe darin verborgen.
Wie steht es nun um die Aufrichtigkeit der Menschen und deren Glaubwürdigkeit in Punkto Liebeserklärung oder Heiratsantrag im TV? Die meistgegebene Antwort lautet, frei nach „alter Schule“: romantisch, aus tiefstem Herzen und ehrlich sollte die Liebeserklärung sein. Ein symbiotisches Moment, in der Zweisamkeit dem geliebten Menschen sein Innerstes enthüllen, sein Ich offenbaren, seine Geheimnisse anvertrauen, ein trauter Augenblick in dem die Welt ringsum vergessen ist. Romantisches Liebesideal vs. TV- Show. Denn kann man von vollster Aufrichtigkeit und hingebungsvoller Glaubwürdigkeit sprechen? Jo Reichertz nennt diesen Akt eine Inszenierung des Nicht- Inszenierten. Eine Inszenierung aus dem Grunde, da zum einen der Akt von den Zuschauern gleichermaßen rezipiert werden soll bzw. muss und zum anderen in diesem Moment die Aufrichtigkeit daran verliert, so offenkundig sein Ich dem angebeteten Menschen und den Millionen von Zuschauern zu präsentieren. Der Akt als solcher wird zwar durch das vermittelnde Element des Fernsehers festgehalten und augenscheinlich eine Verlässlichkeit der Liebeserklärung zu gesichert, meiner Ansicht nach, fällt jedoch die Fassade der vollsten Aufrichtigkeit und hingebungsvollen Glaubwürdigkeit im nächsten Augenblick in sich zusammen. Man kann wohl kaum von einem Antrag im klassischen Sinne des romantischen Liebesideals sprechen.
Zum einen sind „Dritte“[1] in das Geschehen involviert, die hier die Handlungslogik stark beeinflussen und dieses sich entscheidend auf die Interaktions- und Kommunikationssituation der Akteure auswirkt. Wirft man vergleichsweise einen Blick in unsere Vergangenheit, etwa auf das 19. Jahrhundert, kommt zum anderen der anspruchsvolle Charakter des europäischen Bürgertums zum Tragen, denn hier galt es als große Tugend die „Privatzone“ vor der Öffentlichkeit zu verbergen und diese vor äußeren Blicken abzuschotten.
Nur in diesem Bereich durfte die Intimität in vollen Zügen zum Ausdruck kommen. In der Öffentlichkeit wurden die Gefühle nur begrenzt gezeigt. Privates und Öffentliches wird folgendermaßen definiert: „Privat ist man (…), wenn man sich in seinem Handeln nur auf die Seinen bezieht und öffentlich ist man, wenn man sich an weitere Anwesende oder gar an Zuschauer wendet.“[2] Es wird ersichtlich, dass beim Vergleich dieser Bestimmungen heute keine Trennung von Privat- und Öffentlichkeitsbereich vorhanden ist. Besonders in dem TV Format wie der Reality Show Big Brother, in der es keine Grauzone für Zuschauer gibt und man rund um die Uhr alles mitverfolgen kann, bietet ein Extrembeispiel für das Ausmaß an öffentlichen Liebesbekundungen jeglicher Art in der heutigen Zeit.
Aber auch Sonntagabend bei „ Nur die Liebe zählt“ wird das Intimleben enthüllt, wenn Kai Pflaume den Gast nach den Ursachen für den Beziehungsbruch fragt und dieser dann anfängt seine Lebensgeschichte zu erzählen. Die Semantik der Liebe ist also eine andere als vor 100, 200 Jahren. Jo Reichertz bietet einen Erklärungsansatz, indem er postuliert, dass die Veröffentlichung der Liebe in der Medienlandschaft durch den Inszenierungsbegriff als natürliches Motiv des Individuums zu begründen ist. Jedes Individuum befindet sich stets in einer Inszenierung, welche es ermöglicht, dass Produzent(en) und Rezipient(en), sprich die Interagierenden intersubjektiv in Verbindung stehen. Das was der Produzent gewillt ist zu inszenieren, ist das Resultat der sich gewandelten und sich stets wandelnden Kultur. Darf man demnach behaupten, dass unsere Kultur die ist, die uns zur Illustration und Darstellung unseres Intimlebens nötigt? Ist es der Konkurrenz- und Geschlechterkampf der Menschen, der sie den Drang verspüren lässt, den anderen immer überbieten zu wollen indem man alles dafür tut?
Werden die Empfindungen, die Verbindlichkeit, die Glaubwürdigkeit des Partners daran gemessen, inwieweit er bereit ist, dieses vor den Augen der Öffentlichkeit speziell im Fernsehen zu tun? Hat es in der Liebe an Bedeutung verloren, wie tief und rein die Emotionen des Anderen empfunden werden? Oder gilt es heute viel mehr viele und ausgefallene Beweise für die Liebe zu erhalten? Unsere heutige Zeit erfordert neue Praktiken, neue Zeichen und Symbole und was ist nach Jo Reichertz Meinung daran unmoralisch seine Liebe im Fernsehen, wenn auch theatralisch inszeniert Ausdruck zu verleihen.
Quelle:
Jo Reichertz; Nathalie Iványi (Hrsg.) (2003).: Liebe (wie) im Fernsehen. Eine
wissenssoziologische Analyse. Opladen: Leske + Budrich
Seminarmaterial SoSe 2005: Soziologie des Fernsehens, Yvonne Niekrenz M.A.
Seminarmaterial WiSe 2005/2006: Inszenierung- mediale und alltägliche Theatralität, Yvonne Niekrenz M.A.
Seminarmaterial SoSe 2006: Soziologie der Liebe, Dirk Villányi M.A.
[...]
[1] Alle am Fernseh-Set arbeitenden Menschen, wie z.B. Moderator, Kameraleute, Regisseur
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in „Die Theatralik der Liebe in der Flimmerkiste“?
Der Text analysiert, wie Liebe im Fernsehen inszeniert wird und welche Auswirkungen diese Inszenierungen auf die Wahrnehmung und das Verständnis von Liebe in der Gesellschaft haben. Er untersucht, ob die mediale Darstellung von Liebe ein realitätsnahes Abbild ist oder eher eine idealisierte und theatralische Form, die zu unrealistischen Erwartungen und Beziehungsproblemen führen kann.
Was versteht der Text unter "performativem Realitätsfernsehen"?
Der Begriff bezieht sich auf Fernsehformate, in denen Menschen ihre Liebesleben oder Beziehungen öffentlich zur Schau stellen. Es wird argumentiert, dass solche Formate eine Verbindung zum realen Leben herstellen, indem sie beispielsweise Liebesgeständnisse oder Heiratsanträge vor laufender Kamera zeigen. Der Text hinterfragt, ob diese öffentliche Zurschaustellung die Aufrichtigkeit und Glaubwürdigkeit der Handlungen beeinflusst.
Welche Kritik wird an der medialen Inszenierung von Liebe geübt?
Der Text kritisiert, dass die mediale Inszenierung von Liebe dazu führen kann, dass Menschen ihre eigenen Beziehungen mit dem idealisierten Bild im Fernsehen vergleichen. Diese Diskrepanz zwischen Ideal und Realität kann zu Unzufriedenheit und Beziehungsproblemen führen. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob die Teilnehmer solcher Formate tatsächlich aufrichtig sind oder ob sie sich nur inszenieren, um Aufmerksamkeit zu erlangen oder ihre Karriere voranzutreiben.
Welche Rolle spielt die Öffentlichkeit in der heutigen Darstellung von Liebe?
Der Text argumentiert, dass die Grenze zwischen Privatem und Öffentlichem in Bezug auf Liebe verschwommen ist. Im Gegensatz zu früheren Zeiten, in denen Intimität privat gehalten wurde, wird Liebe heute oft öffentlich zur Schau gestellt, insbesondere im Fernsehen. Dies wirft die Frage auf, ob die Öffentlichkeit die Authentizität und Intimität der Beziehung beeinträchtigt.
Was ist die Position von Jo Reichertz in Bezug auf mediale Liebesinszenierungen?
Jo Reichertz wird als Kommunikationsforscher zitiert, der die Inszenierung von Liebe im Fernsehen als Ausdruck der sich wandelnden Kultur betrachtet. Er argumentiert, dass die Veröffentlichung der Liebe ein natürliches Motiv des Individuums sein kann, da jedes Individuum sich stets in einer Inszenierung befindet. Reichertz hinterfragt, was daran unmoralisch sei, wenn die Liebe im Fernsehen, wenn auch theatralisch inszeniert, Ausdruck verliehen wird.
Welche Fragen wirft der Text bezüglich der Glaubwürdigkeit von Liebeserklärungen im TV auf?
Der Text hinterfragt, ob Liebeserklärungen und Heiratsanträge im Fernsehen tatsächlich aufrichtig und glaubwürdig sind. Es wird argumentiert, dass die Anwesenheit eines Publikums und das Wissen um die Aufzeichnung die Handlungen beeinflussen können. Der Text zieht die Frage auf, ob die öffentliche Zurschaustellung die Intimität und Aufrichtigkeit des romantischen Ideals der Liebe untergräbt.
Welche Quellen werden in dem Text verwendet?
Der Text beruft sich auf die Arbeit von Jo Reichertz und Nathalie Iványi im Sammelband "Liebe (wie) im Fernsehen. Eine wissenssoziologische Analyse". Außerdem werden Seminarmaterialien von Yvonne Niekrenz M.A. und Dirk Villányi M.A. als Quelle verwendet.
- Citar trabajo
- Michaela Bauske (Autor), 2006, Theatralität der Liebe im Fernsehen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110622