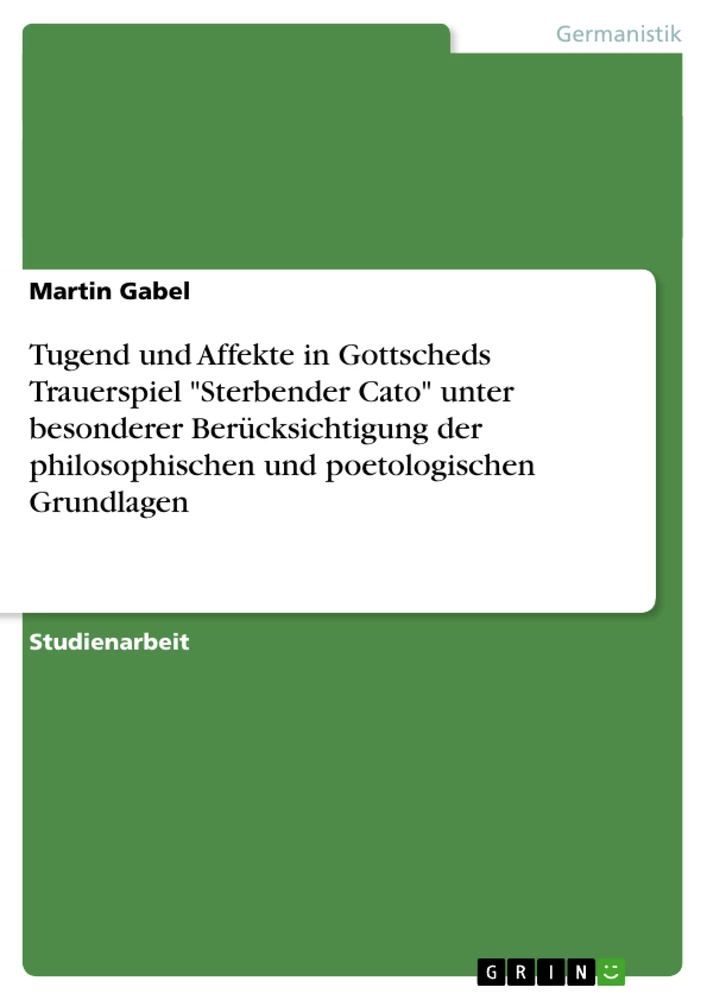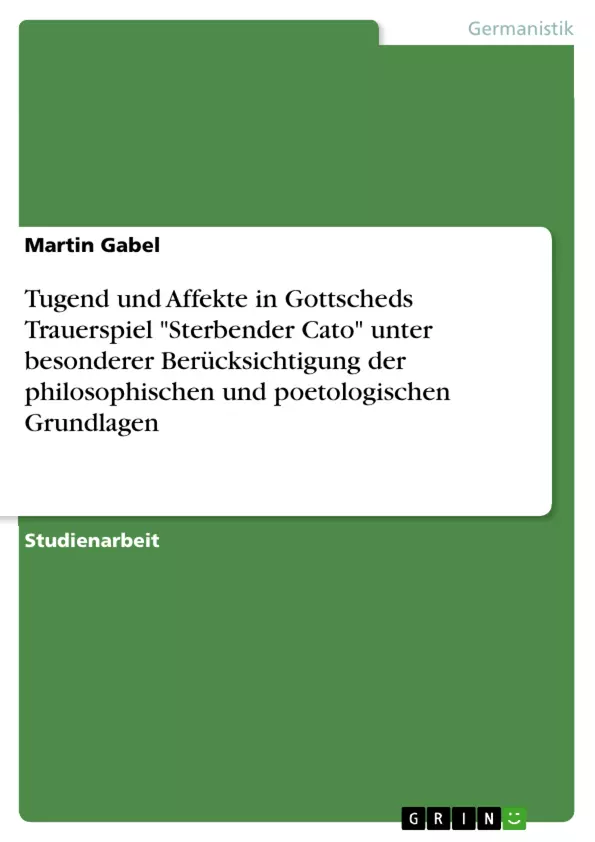Über den Ausgangspunkt der deutschen Ästhetik in der Aufklärung schreibt Ernst Cassirer: "Zum erstenmal stellt sich jetzt die gesamte Problematik des Ästhetischen unter die Leitung und gewissermaßen unter die Obhut der s y s t e m a- t i s c h e n P h i l o s o p h i e" (1); und Karl Otto Conrady gibt in seinem Aufsatz über Gottscheds "Sterbenden Cato" dementsprechend das Leitziel der Interpretation an: "Erst wenn der bei Gottsched bis ins Paradoxe hinein konsequente Folgezusammenhang zwischen philosophischem Weltbild, Literaturtheorie und Einzelwerk sichtbar gemacht wird, rückt auch das Drama vom "Sterbenden Cato" in die richtige Sicht" (2). Diesen Folgezusammenhang suche ich in Gottscheds Mustertragödie hinsichtlich der dramatischen Gestaltung von Tugend und Affekten deutlich zu machen, indem ich zunächst von dem grundlegenden leibniz-wolffschen Denksystem ausgehend zur dem Prinzip der Wirkung verpflichteten und insofern rhetorisch geprägten Poetik Gottscheds weiterschreite, um von dem so erst zu gewinnenden begrifflichen Horizont aus die Gestaltung von Tugend und Affekten im Trauerspiel deutlich machen und einer kritischen Prüfung hinsichtlich der Frage nach dem Verhältnis von Theorie und dramatischer Praxis unterziehen zu können. Auf diese Weise soll deutlich werden, daß schon in der philosophischen Grundlage ein zentraler Bruchpunkt liegt, dessen Ausläufer durch die Poetik, das Drama selbst und alle interpretativen Äußerungen hindurchwirken und auch die Fehlrezeption der antiken Poetik erklären. Dieser Bruchpunkt liegt in der logischen Identifizierung von Natur und Vernunft und dem daraus folgenden Erfolgskriterium des moralischen Handelns. Tragik im antiken oder christlichen Sinne ist vor dem Hintergrunde dieses Verständnisses nicht möglich. Moral als eigenständiger Bereich im Gegensatz zum technischen Handeln ist streng genommen überhaupt nicht existent.
Wegen der heute weitgehend unbekannten und auch in der Sekundärliteratur allzu
oberflächlich abgehandelten Philosophie der Frühaufklärung und ihres fundamentalen
Charakters für eine dem Zeitgeist entsprechende Dramenanalyse wurde die Darstellung der philosophische Grundlage und der Poetik ausführlicher gehalten, als bei einer reinen Dramenanalyse zu erwarten wäre.
Inhaltsverzeichnis
- 1. UNTERSUCHUNGSANSATZ: PHILOSOPHIE UND POETIK ALS GRUNDLAGE DER GESTALTUNG DES DRAMAS
- 2. DIE PHILOSOPHISCH-SYSTEMATISCHE TUGEND- UND AFFEKTENLEHRE GOTTSCHEDS
- 2.1 Zur historischen Stellung der Philosophie Gottscheds
- 2.2 Übersicht über die Lehre von Tugend und Affekten im Brennpunkt der philosophischen Systematik
- 2.3 Nähere Analyse von Tugend und Affekten
- 2.4 Andere philosophische Lehren: Das rechte Verhalten in Unglücksfällen und der Stoizismus
- 3. DIE ZENTRALE STELLUNG VON TUGEND UND AFFEKTEN IN DER KRITISCHEN POETIK GOTTSCHEDS
- 4. DIE DARSTELLUNG VON TUGEND UND AFFEKTEN IM DRAMA "STERBENDER CATO"
- 4.1. ZUR METHODIK DER ANALYSE
- 4.2 PHARNACES ODER DER UNTERGANG DES LASTERS DURCH SELBSTZERSTÖRUNG
- 4.2.1 Dargestellte und berichtete Handlung
- 4.2.2 Motive und Moralreflexion
- 4.3 CATO ODER DER UNTERGANG DES TUGENDHAFTEN AUS EIGENSINN UND DURCH FALSCHE VORSTELLUNG
- 4.3.1 Die dargestellte und berichtete Handlung
- 4.3.2 Die berichteten und geäußerten Motive Catos
- 4.3.3 Die theoretischen Reflexionen über Tugend und Affekte
- 4.4 CÄSAR ODER DIE VERSCHLEIERUNG DES LASTERS DURCH SCHEINBARE TUGEND
- 4.4.1 Dargestellte und berichtete Handlung
- 4.4.2 Motive Cäsars
- 4.4.3 Theoretische Reflexionen
- 5. GOTTSCHEDS INTERPRETATION DES DRAMAS UND DES HISTORISCHEN CATO HINSICHTLICH TUGEND UND AFFEKTEN
- 5.1 Die Vorrede zum "Sterbenden Cato" (in der Erstausgabe)
- 5.2 Die "Bescheidene Antwort" auf die erfahrene Kritik (1733 erschienen)
- 5.3 Die Catorede (1736 gedruckt)
- 6. DAS VERHÄLTNIS VON DRAMATISCHER GESTALTUNG, THEORIE UND EIGENINTERPRETATION
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Tugend und Affekten in Gottscheds Trauerspiel "Sterbender Cato", indem sie den Zusammenhang zwischen Gottscheds philosophischem Weltbild, seiner Literaturtheorie und dem Drama selbst analysiert. Das Ziel ist es, aufzuzeigen, wie Gottscheds philosophische und poetologische Grundlagen die dramatische Gestaltung beeinflussen und welche Intentionen er mit seiner Mustertragödie zum Ausdruck bringen wollte.
- Der Einfluss des leibniz-wolffschen Denksystems auf Gottscheds Poetik.
- Die systematische Darstellung von Tugend und Affekten in Gottscheds Philosophie.
- Die Umsetzung der philosophischen Konzepte in der dramatischen Gestaltung des "Sterbenden Cato".
- Das Verhältnis von Theorie und Praxis in Gottscheds Werk.
- Gottscheds Interpretation des Dramas und des historischen Cato.
Zusammenfassung der Kapitel
1. UNTERSUCHUNGSANSATZ: PHILOSOPHIE UND POETIK ALS GRUNDLAGE DER GESTALTUNG DES DRAMAS: Dieses Kapitel legt den methodischen Ansatz der Arbeit dar. Es betont die Notwendigkeit, Gottscheds Drama im Kontext seines philosophischen und poetologischen Systems zu verstehen, um den Zusammenhang zwischen philosophischem Weltbild, Literaturtheorie und dem Einzelwerk "Sterbender Cato" aufzuzeigen. Der Autor kritisiert rein literaturhistorische Ansätze und plädiert für eine systematische Analyse, die von Gottscheds Intentionen ausgeht und die Umsetzung seiner philosophischen Prinzipien in der dramatischen Gestaltung untersucht. Die Arbeit hebt die Bedeutung der leibniz-wolffschen Philosophie hervor und diskutiert den spezifischen Bruchpunkt in der logischen Identifizierung von Natur und Vernunft, der die Darstellung von Tragik beeinflusst.
2. DIE PHILOSOPHISCH-SYSTEMATISCHE TUGEND- UND AFFEKTENLEHRE GOTTSCHEDS: Dieses Kapitel analysiert Gottscheds philosophische Konzepte von Tugend und Affekten im Kontext der deutschen Aufklärung und ihrer Beziehung zu Leibniz und Wolff. Es beschreibt Gottscheds philosophische Systematik, in der Tugend und Affekte in einen umfassenden Rahmen eingebettet sind, der auf Glückseligkeit und rationalem Handeln ausgerichtet ist. Das Kapitel erläutert, wie die rationalistische und mechanistische Sichtweise der Natur die Interpretation von Tugend und Affekten beeinflusst und wie diese Konzepte in das philosophische System eingebunden sind, um die Grundlage für die spätere Dramenanalyse zu legen. Die Abkehr von einer spirituelleren Ethik hin zu einer auf Bedürfnisbefriedigung ausgerichteten Moral wird herausgestellt.
3. DIE ZENTRALE STELLUNG VON TUGEND UND AFFEKTEN IN DER KRITISCHEN POETIK GOTTSCHEDS: (Summary would go here - This section needs to be created based on the provided text. It should discuss Gottsched's critical poetics and its relationship to his philosophy of virtue and affects.)
4. DIE DARSTELLUNG VON TUGEND UND AFFEKTEN IM DRAMA "STERBENDER CATO": (Summary would go here - This section needs to be created based on the provided text. It should synthesize the analyses of Pharnaces, Cato, and Caesar, highlighting how each character exemplifies or subverts Gottsched's theories of virtue and affect. It should consider the methodologies used to analyze the dramatic presentation and how they relate to the overall argument.)
5. GOTTSCHEDS INTERPRETATION DES DRAMAS UND DES HISTORISCHEN CATO HINSICHTLICH TUGEND UND AFFEKTEN: (Summary would go here - This section needs to be created based on the provided text. It should discuss Gottsched's preface, his response to criticism, and his later oration on Cato, analyzing how these texts illuminate his understanding of virtue and affect in the play and the historical figure.)
6. DAS VERHÄLTNIS VON DRAMATISCHER GESTALTUNG, THEORIE UND EIGENINTERPRETATION: (Summary would go here - This section needs to be created based on the provided text. It should discuss the relationship between the dramatic representation of virtue and affect in the play and Gottsched’s theoretical framework and self-interpretations.)
Schlüsselwörter
Gottsched, Sterbender Cato, Tugend, Affekte, Aufklärung, Leibniz-Wolffsche Philosophie, Kritische Poetik, Dramenanalyse, Rationalismus, Moral, Trauerspiel.
Häufig gestellte Fragen zu: Gottscheds "Sterbender Cato" - Tugend, Affekte und Dramatische Gestaltung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Gottscheds Trauerspiel "Sterbender Cato", indem sie den Zusammenhang zwischen Gottscheds philosophischer Weltanschauung, seiner Literaturtheorie und dem Drama selbst untersucht. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Tugend und Affekten im Drama und wie diese durch Gottscheds philosophische und poetologische Grundlagen beeinflusst werden.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit geht über rein literaturhistorische Ansätze hinaus und betont die Notwendigkeit, Gottscheds Drama im Kontext seines philosophischen und poetologischen Systems zu verstehen. Sie analysiert systematisch, wie Gottscheds Intentionen und die Umsetzung seiner philosophischen Prinzipien die dramatische Gestaltung beeinflussen. Die leibniz-wolffschen Philosophie spielt dabei eine zentrale Rolle.
Welche philosophischen Grundlagen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert Gottscheds philosophische Konzepte von Tugend und Affekten, eingeordnet in den Kontext der deutschen Aufklärung und ihrer Beziehung zu Leibniz und Wolff. Es wird untersucht, wie die rationalistische und mechanistische Sichtweise der Natur die Interpretation von Tugend und Affekten beeinflusst und wie diese Konzepte in Gottscheds philosophisches System eingebunden sind.
Wie werden Tugend und Affekte im Drama "Sterbender Cato" dargestellt?
Das Drama wird detailliert analysiert, indem die Charaktere Pharnaces, Cato und Caesar untersucht werden. Es wird gezeigt, wie jeder Charakter Gottscheds Theorien über Tugend und Affekte verkörpert oder untergräbt. Die Analyse umfasst die dargestellte und berichtete Handlung, Motive, Moralreflexionen und theoretische Reflexionen über Tugend und Affekte.
Welche Rolle spielt Gottscheds eigene Interpretation des Dramas?
Die Arbeit untersucht Gottscheds Vorrede zum "Sterbenden Cato", seine "Bescheidene Antwort" auf Kritik und seine "Catorede". Diese Texte werden analysiert, um Gottscheds Verständnis von Tugend und Affekt im Drama und in Bezug auf die historische Figur des Cato zu beleuchten.
Welches Verhältnis besteht zwischen Theorie und Praxis in Gottscheds Werk?
Die Arbeit untersucht das komplexe Verhältnis zwischen der dramatischen Darstellung von Tugend und Affekten, Gottscheds theoretischem Rahmen und seiner Selbsteinschätzung. Es wird analysiert, wie Gottscheds philosophische und poetologische Überzeugungen seine dramatische Gestaltung beeinflusst haben und wie sich dies in seinem Drama widerspiegelt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Gottsched, Sterbender Cato, Tugend, Affekte, Aufklärung, Leibniz-Wolffsche Philosophie, Kritische Poetik, Dramenanalyse, Rationalismus, Moral, Trauerspiel.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel, die den methodischen Ansatz, die philosophischen Grundlagen, die poetologischen Prinzipien, die Dramenanalyse, Gottscheds Interpretationen und das Verhältnis von Theorie und Praxis untersuchen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, aufzuzeigen, wie Gottscheds philosophische und poetologische Grundlagen die dramatische Gestaltung seines Trauerspiels "Sterbender Cato" beeinflussen und welche Intentionen er mit seiner Mustertragödie zum Ausdruck bringen wollte.
- Quote paper
- Martin Gabel (Author), 1993, Tugend und Affekte in Gottscheds Trauerspiel "Sterbender Cato" unter besonderer Berücksichtigung der philosophischen und poetologischen Grundlagen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110726