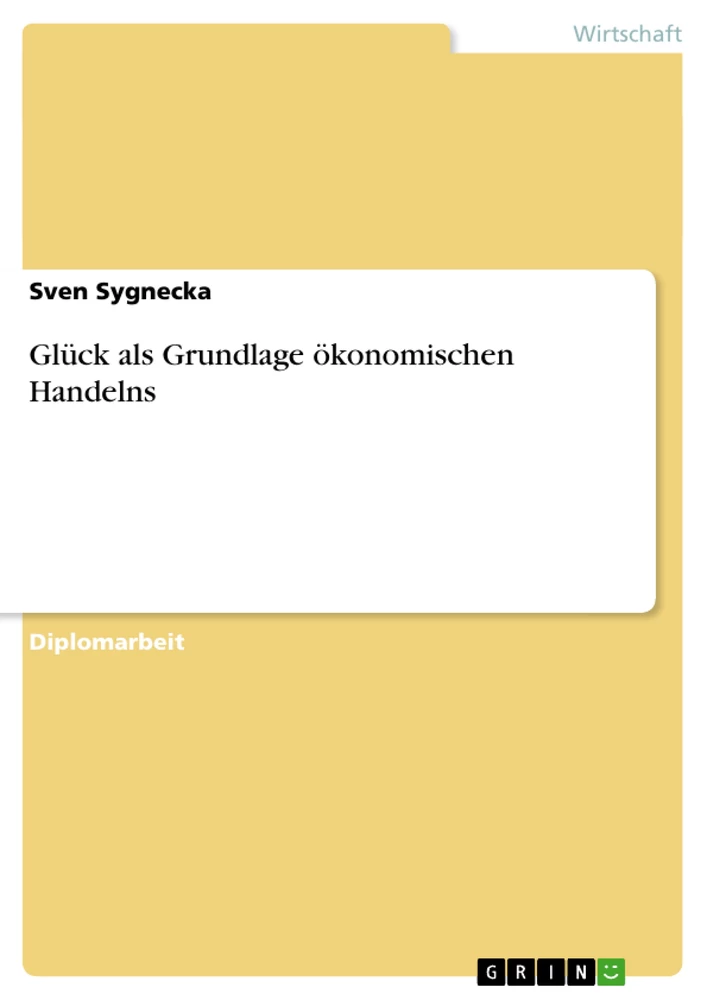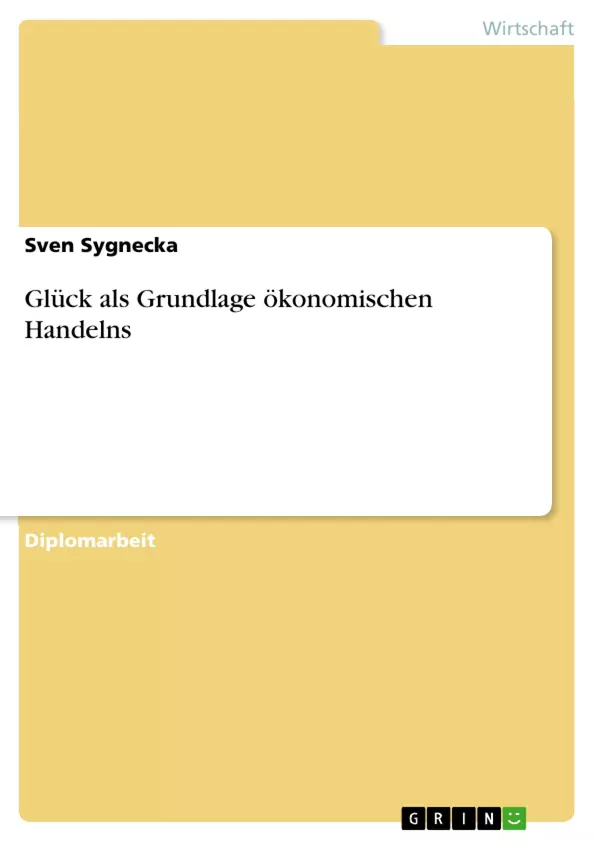Der Mensch, so der zeitgenössische italienische Philosoph GEORGIO AGAMBEN, ist - im Normalzustand - an seine Lebensweise, die „Form“ seines Lebens, gebunden. Nicht nur das biologische Leben selbst, sondern auch die gewählte Art zu Leben, sind vom Menschen untrennbar. „[Der Mensch ist] – insofern er also Möglichkeitswesen ist und tun und lassen, Erfolg haben oder scheitern, sich verlieren oder zu sich finden kann – das einzige Wesen, in dessen Leben es immer um die Glückseligkeit geht, dessen Leben unweigerlich und schmerzhaft dem Glück anheimgestellt ist. […] Das Leben im normal gewordenen Ausnahmezustand ist das bloße Leben, das die Lebensformen in allen Bereichen von ihrem Zusammenhalt in einer Lebens-Form scheidet“ (AGAMBEN 2001: 13ff). Sollte AGAMBENS Analyse zutreffen, so wird in der Politik das menschliche Leben von seinem Glück getrennt und so der Ausnahmezustand hergestellt. Das Glück wäre die Sache des Einzelnen, die körperliche Unversehrtheit im mehr oder weniger weiten Sinne werde als ablösbarer Schutzbereich staatlichen Handelns betrachtet. Auf ungefähr dieser ethischen Basis beruht die neoklassische Ökonomie. Diese Ethik ist das Ergebnis einer Entwicklung, die ironischerweise ihren Ausgangspunkt gerade im „größten Glück der größten Zahl“ auch Maßgabe staatlichen Handelns hatte. BOHNEN (1992: 329) beschreibt diese Entwicklung als Amputation einer Ethik, die in einer Sackgasse endete (vgl. ebd.: 335). Wie es für Sackgassen üblich ist, führt der Weg hinaus nur zurück. Kann der Normalzustand in AGAMBENS Sinne, also die Berücksichtigung der Wirkungen des Wirtschaftens auf die glücksbestimmende Lebensform des Menschen, für die Wirtschaftswissenschaften über eine Rückkehr zu diesem Prinzip erreicht werden?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Context
- Content
- Vom Glück zum Nutzen
- Das Prinzip des größten Glücks
- Benthams biografischer Hintergrund
- Die Elemente des Prinzips
- Die Entwicklung des Nutzenbegriffs
- Das,,aktuelle" ökonomische Nutzenkonzept
- Einflüsse neben dem Utilitarismus
- Einfluss des Utilitarismus über Wohlfahrtsökonomik
- Gemeinsamkeiten von Utilitarismus und Nutzenbegriff
- Vom Nutzen zum Wohlbefinden
- Kritik am Nutzenkonzept: Blinde Flecken und Einwände
- Ein Rückgriff, kein Rückweg
- Das neue Glück in der ökonomischen Theorie
- Annäherung ans Glück
- Empirie
- Theorie
- Praxis
- Determinanten des Glücks
- Glücksquellen in der Ökonomie
- Einkommen
- Konsum
- Arbeit
- Glücksfaktoren unter ökonomischem Einfluss
- Exkurs: Zur Maximierung von Glück
- Vorbehalte nach Entscheidungsebene
- Maximierung durch das Individuum
- Maximierung durch die Regierung
- Das Wesen des Glücks
- lösbare Widersprüche der Maximierung von Glück
- hedonistische Paradoxa
- Glück aus sozialen Beziehungen und der Begriff „Pflicht“
- Ökonomie und Glück - ein Perspektivenwechsel
- Zwischenfazit
- Glück und ökonomisches Handeln
- Produktion
- Glück und die Produktion der Firma
- Seines Glückes Schmied sein - Produktion im Haushalt
- Prozessorientierung
- Wohlfahrt
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Frage, wie Glück als Grundlage ökonomischen Handelns verstanden werden kann. Sie analysiert die Entwicklung des Nutzenbegriffs in der Ökonomie und zeigt die Grenzen des traditionellen Nutzenkonzepts auf. Im Mittelpunkt steht die Integration von Glück in die ökonomische Theorie und die Analyse der Determinanten von Glück. Die Arbeit untersucht, wie Glück durch ökonomische Faktoren beeinflusst wird und welche Auswirkungen dies auf die ökonomische Entscheidungsfindung hat.
- Die Entwicklung des Nutzenbegriffs in der Ökonomie
- Die Grenzen des traditionellen Nutzenkonzepts
- Die Integration von Glück in die ökonomische Theorie
- Die Determinanten von Glück
- Die Auswirkungen von Glück auf die ökonomische Entscheidungsfindung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext und den Inhalt der Arbeit vor. Sie erläutert die Relevanz des Themas und die Forschungsfrage, die in der Arbeit beantwortet werden soll. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Entwicklung des Nutzenbegriffs in der Ökonomie. Es analysiert das Prinzip des größten Glücks, das von Jeremy Bentham entwickelt wurde, und die verschiedenen Einflüsse, die zur Entstehung des modernen Nutzenkonzepts geführt haben. Das dritte Kapitel kritisiert das traditionelle Nutzenkonzept und zeigt seine Grenzen auf. Es argumentiert, dass das Nutzenkonzept nicht in der Lage ist, das menschliche Glück vollständig zu erfassen. Das vierte Kapitel stellt das neue Glück in der ökonomischen Theorie vor. Es analysiert die empirischen Befunde zur Messung von Glück und die theoretischen Ansätze, die Glück in die ökonomische Theorie integrieren. Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Maximierung von Glück. Es untersucht die verschiedenen Ebenen der Entscheidungsfindung und die Herausforderungen, die sich aus der Maximierung von Glück ergeben. Das sechste Kapitel analysiert die Beziehung zwischen Glück und ökonomischem Handeln. Es untersucht die Auswirkungen von Glück auf die Produktion, den Konsum und die Wohlfahrt. Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Glück, Nutzen, Wohlbefinden, Ökonomie, ökonomisches Handeln, Entscheidungsfindung, Produktion, Konsum, Wohlfahrt, Utilitarismus, Jeremy Bentham, Hedonismus, subjektives Wohlbefinden, empirische Forschung, Determinanten des Glücks, Maximierung von Glück, Perspektivenwechsel.
- Citation du texte
- Sven Sygnecka (Auteur), 2006, Glück als Grundlage ökonomischen Handelns, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110853