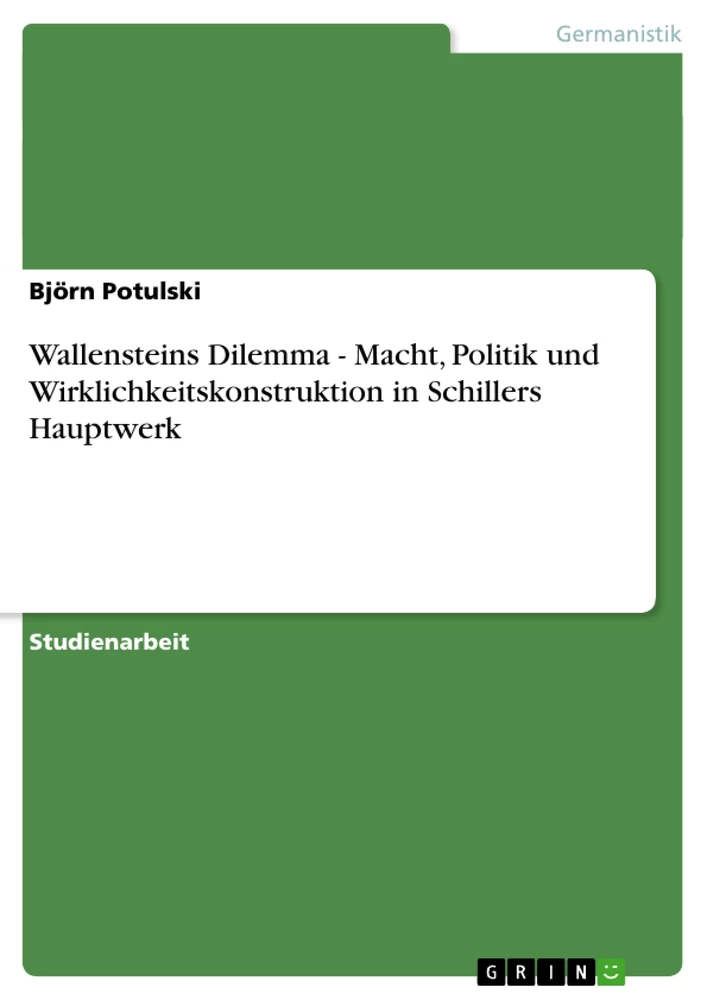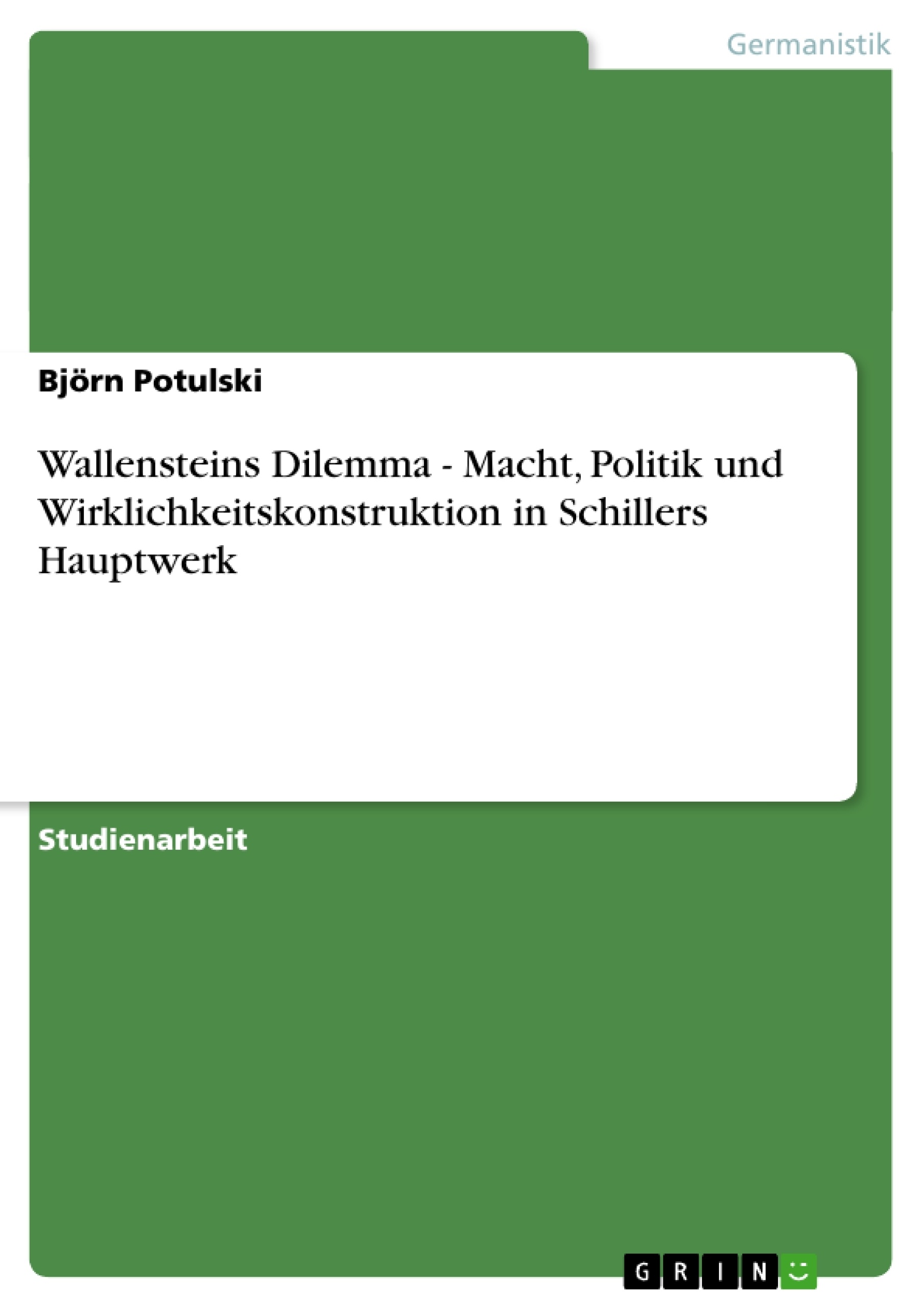Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung: Schiller, Wallenstein und das Drama der Macht
II. Phantasien der Macht: Zum Verhältnis von Spiel und Ernst
III. Bestandsaufnahme im Möglichkeitsraum: Der Achsenmonolog
IV. Machiavellistischer Realismus beim Idealisten Schiller
V. Über Verschwörungen
VI. Der dramatische Diskurs der Sicherheit
VII. Wallensteins Machtdilemma
VIII. Über Konstruktion von Wirklichkeit
IX. Nachtrag: Wallensteins Scheitern
IX. Zum Schluss: Wo bleiben die Ideale?
Bibliographie
Was tu ich Schlimmres, Als jener Cäsar tat, des Name noch
Bis heute das höchste in der Welt benennet?
Wallenstein
I. Einleitung: Schiller, Wallenstein und das Drama der Macht
Politik ist Umgang mit Macht[1] – diese einfache Definition ist common sense aller Theorien des Politischen. Macht wollen wir hier mit Clausewitz als das Vermögen verstehen, „den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen“[2]. Wie der Erwerb von Macht und ihr Gebrauch sich gestalten kann, muss, oder soll, das sind durchaus alternative Untersuchungsfelder widerstreitender Paradigmen politischer Theorie.
In Friedrich Schillers Wallenstein-Trilogie erleben wir das Drama der Macht: Die Figuren, deren historische Vorbilder wir als Akteure des Dreißigjährigen Krieges kennen, begründen militärische Macht, haben Not, ihre symbolische Macht zu erhalten, drohen mit unverhohlenen Machtdemonstrationen, versuchen vergebens ein stabilisierendes Gleichgewicht der Macht auszubalancieren.
Grundlage des dramatischen Konfliktes ist ein Ungleichgewicht der Macht: Der Kaiser in Wien verfügt über die Insignien der legitimen (Macht-) Ordnung, seine tatsächliche Macht beschränkt sich aber auf das Feld des Symbolischen. Wir kennen aus der Geschichte des heiligen Römischen Reiches die besonderen Probleme, die einen Kaiser ohne ‚Hausmacht’ betrafen. Das Defizit kann zunächst behoben werden, indem der Kaiser als Auftraggeber der Macht in Erscheinung tritt: Der Kriegsunternehmer Albrecht von Wallenstein fungiert als Lieferant dringend benötigter militärischer Macht, deren kriegerisches Mandat von der symbolischen Macht des Kaisers legitimiert wird. Zwar ist der militärisch mächtige Feldherr auf die Legitimation durch den Kaiser und der Kaiser auf die kriegerische Potenz des Feldherrn angewiesen, doch bleibt dieses Gleichgewicht prekär.
Schillers dramatische Trilogie verarbeitet ein repräsentatives Korpus detailreicher Diskurse politischer Theorie:
Die Modellierung der dramatischen Konfliktsituationen und deren Auflösung offenbart eine erstaunliche Nähe zu den Szenarien, die der politische Theoretiker und Fürstenberater Niccolò Machiavelli (1469-1527) entwirft[3]. Bei der Analyse der Verschwörungshandlung im „Wallenstein“ sind die Texte des Florentiners eine anregende Hilfe, auch wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass Schiller sie als Quellen nutzte.
In theoretischer Opposition zu Machiavellis brachialer Verantwortungs- ethik steht Immanuel Kants gesinnungsethisch geprägte politische Schrift „Zum ewigen Frieden“. Die Forschung zieht neuerdings die Möglichkeit in Betracht, dass diese Schiller als Quelle der politischen Thematik seines ‚Wallenstein’ gedient haben könnte[4].
Wir identifizieren also den Einfluss zweier konträrer politischer Paradigmen, die von den Figuren reflektiert und vertreten werden, die aber vor allem ihr Handeln leiten: Octavio Piccolomini, General in Wallensteins Armee, genießt das uneingeschränkte Vertrauen des Titelhelden, den er später unter kluger Ausnutzung dieses Umstandes in die Falle der im Auftrag des Kaisers konstruierten Verschwörung tappen lässt. Octavio präsentiert sich uns als Repräsentant des politischen Realismus, einer Denkrichtung, welche die Welt so zu behandeln vorgibt, „wie sie ist“[5].
Octavios politische Theorie und Praxis findet eine erbitterte Opposition in seinem Sohn Max Piccolomini, dem Ziehkind Wallensteins und Obersten in dessen Heer, der sich als glühender Verfechter eines politischen Idealismus zu erkennen gibt, dessen Projekt es ist, die Welt zu beschreiben, wie sie sein soll.
Im historischen Kontext der Entstehungszeit des „Wallenstein“ ist also Max mit seinem Kantschen Idealismus die paradigmatische Figur. Gleichwohl fasst Schiller in zahlreichen Repliken der Hauptfiguren, vor allem Octavios und Wallensteins, deutliche kritische Positionen gegenüber dem bedingungslos konsequenten Idealismus zusammen, indem er Max in sinnlosem Opfertod untergehen lässt, während Octavios Intrige zur Stabilisierung der legitimen Ordnung führt, die ohne Alternative bleibt. Die Tauglichkeit des idealistischen Ansatzes für den politischen Prozess lässt sich aus der Handlung des Dramas heraus beurteilen: Den kritischen Positionen Octavios und Wallensteins muss vielfach zugestimmt werden. Dagegen muss aber auch festgehalten werden, dass Maxens scheinbar weltuntaugliches ‚politisches’ Programm einen Ausweg aus einem zentralen Dilemma des Machtdiskurses bereitgehalten hätte.
Die Intrigenhandlung, der Antagonismus Wallensteins im Verhältnis zum Kaiserhof, das polare Verhältnis der politischen Anschauungen und der politischen Praxis der beiden Piccolomini können also als politischer Prozeß analysiert werden.
«Realismus»“.
Schiller führt uns an dieser Konstellation beispielhaft das Dilemma der Macht vor Augen: Sobald mehrere Akteure über Macht verfügen, müssen sie Vorkehrungen treffen, sich vor der Macht des anderen zu schützen. Es bleibt ihnen nur die Möglichkeit, ihre eigene Macht zu vergrößern. Das Dilemma ist selbsterhaltend und selbstverstärkend. In Schillers Drama kann ihm nur durch das Mittel der Verschwörung zur Ausschaltung des Opponenten begegnet werden. Wie wir sehen werden, gibt es dazu nur die Alternative, die Wallenstein zu realisieren versucht: Die Ansammlung einer Übermacht zum eigenen Schutz und zur Konsolidierung der eigenen Position – diese Möglichkeit hat der Kaiser nicht, weshalb ihm lediglich der oben skizzierte – letzte – Ausweg bleibt: „Er [Cäsar, s.o.] führte wider Rom die Legionen, / Die Rom ihm zur Beschützung anvertraut. / Warf er das Schwert von sich, er war verloren, / Wie ich es wär’, wenn ich entwaffnete.“ (Tod, 838ff.).
Dem Dilemma liegt ein kompliziertes Konzept inkongruenter Wirklichkeitskonstruktionenen zugrunde: Die konflikthaft verbundenen Akteure verfügen über individuell konstruierte Wirklichkeiten, die sich nur teilweise überschneiden. Darin hat die hohe Intensität der Bedrohungsperzeption im Verhältnis des Kaisers zu seinem Feldherrn ihren Ursprung.
Es wird nicht zu entscheiden sein, ob eine Verschwörung Wallensteins den Kaiser zu Gegenmaßnahmen zwingt, oder die Gegenmaßnahmen des Kaisers Wallenstein zur Verschwörung nötigen.
Lediglich eine gewisse ‚Schuld’ im Sinne einer politischen Unklugheit wird man Wallenstein anlasten müssen, der es, aus welchen Motiven wird zu untersuchen sein, sich nicht versagen konnte, sich in Phantasien der Macht zu ergehen, die seine Opponenten schrecken müssen. Unser Augenmerk soll dem Punkt gelten, an dem aus Phantasie unintentional und unvermittelt Realität wird.
Dies beschrieben zu haben ist eine große Leistung des politischen Dichters Schiller, dessen 200. Todestag wir am 9. Mai begehen werden. Umso weniger verständlich ist es da, dass die großen Bayerischen Schauspielbühnen es sich im Schillerjahr nehmen lassen, auf das aktuell vorherrschende politische Klima der Angst und der Bedrohungsgefühle durch weithin unsichtbare (konstruierte?) Feinde, mit engagierten Inszenierungen von Schillers dramatischem Hauptwerk zu reagieren – auf den Spielplänen findet sich leider kein einziger „Wallenstein“.
II. Phantasien der Macht: Zum Verhältnis von Spiel und Ernst
„Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“[6] Im Sinne dieser Schillerschen Anthropologie möchte Wallenstein ganz Mensch sein, sein Umgang mit der Macht ist der eines Spiels. Der Ort des Machtspiels ist zunächst nur die Phantasie, sie dient Wallenstein als Fluchtraum, in den er ausweicht um reale Optionen nicht einer Entscheidung im Sinne eines Für oder Wider aussetzen zu müssen: Sich für eine Option zu entscheiden, fiele ihm vielleicht noch leicht, wäre damit nicht zwingend die Entscheidung gegen eine andere verbunden, was den Möglichkeitsraum zunächst verkleinert.
Der dramatische, wie auch der historische Wallenstein sind in ihrer Zeit Ausnahmeerscheinungen, charismatische Führer eines treuen Heeres von gewaltiger Stärke, das auf der Welt keinen Gegner zu fürchten braucht. Erst recht nicht seinen Dienstherren, den machtlosen Kaiser.] Dieser Umstand ist Wallenstein nicht anzulasten, muss aber bei der Beurteilung der vielfältigen Konsequenzen, die sich daraus ergeben, mildernd herangezogen werden. Die Realität hält für den mächtigen Feldherrn keine (Macht-)Schranken bereit, nimmt ihm also vor allem auch keine Entscheidung ab, er kann schlicht jede Option wählen, die er möchte. Wallensteins Zögern, die Handlungshemmung in der Realität, die ihm, klug ausgenutzt von seinen Gegnern, schließlich das Leben kosten wird, ist Thema vieler Abhandlungen. Hier soll uns das vehement betriebene phantasierte Handeln interessieren, das, obwohl es nicht in der Welt des politisch Realen stattfindet, seine politischen Gegner doch gegen die Titelfigur zusammenschweißt und einen Konflikt schafft, in dem nur noch das Äußerste eine Lösung bereit hält.
Wallenstein verstrickt sich also in diesem Sinne in ein selbstgeknüpftes Netz, obgleich die Falle ohne jede Absicht von ihm selbst aufgestellt wird. Zu Beginn des zweiten Teiles der Trilogie erleben wir das Räsonnement des Feldherrn aus der Innenperspektive. Indem Wallenstein bereits eine Welt von Feinden sieht, geht seine Phantasie rückblickend noch einmal im reinen Möglichkeitsraum alle Handlungsoptionen durch, die er hatte oder gehabt hätte, inklusive Verrat und Usurpation. Wallenstein spielt Szenarien durch. Sprachlicher Ausdruck des nicht Realen sind die vielen Konjuktive und Fragen[7]. Wallensteins Gegner hielten dieses interessenlose Spiel des Feldherrn ab einem bestimmten Zeitpunkt für Ernst und begannen, Abwehrmaßnahmen zu treffen, deren sichtbare Signale nun auch dem, gegen den sie gerichtet sind, nicht mehr verborgen bleiben. ‚Interesselos’ bedeutet, das Spiel bezog sich nicht auf Intentionen, die in den Tatsachen der äußeren Realität repräsentiert sind. Wallensteins Absicht besteht zunächst nur im Spielen. Die politischen Interessen seiner Gegner würden durch Wallensteins spielerische Interessen jedoch, würden diese Realität, massiv bedroht. Die Grenze zwischen Spiel und Ernst wird durchlässig. ‚Ernst’ meint in diesem Zusammenhang eine Zuschreibung, die zunächst Wallensteins Gegner durchführen. Hier ist der eigentümliche Punkt auszumachen, an dem aus Phantasie Realität wird. Wallenstein hat ab sofort nicht mehr die spielerische Freiheit, mit der er sich im Phantasieraum bewegte. Es bleibt der Modus des Spiels, welches sich jedoch in die Realität verlagert, eine Transformation findet statt, die es ‚ernst’ werden läßt.
Wallensteins Verantwortung, oder sagen wir ruhig Schuld, liegt in einer Verwechslung: Er möchte Schauspieler sein und spielt Machtspiele in der Phantasie, ohne jedoch eine Bühne zu haben. Er genießt also keinen „künstlerischen Rabatt“ (Lazarowicz). Außerdem ist er sehr mächtig, was dieses Defizit umso folgenreicher werden lässt. Tatsächlich können ihm seine politischen Gegner keinen künstlerischen Rabatt gewähren. Dieses sollte ihm, der selber das Feld des Politischen kennen muss, ist er doch schließlich auf diesem groß und mächtig geworden, bewusst sein, folglich spielt er auch noch mit dem Feuer. Dies ist sein Beitrag zur Bilanz tragischer Schuld, die am Ende, das nicht nur seinen eigenen Tod bringen wird, gezogen werden muss.
Wallenstein möchte also nicht auf Optionen verzichten müssen, möchte alles verkörpern können, er ist ein „Parvenu“[8], der seiner Spiellust frönt. Er gefällt sich in den verschiedensten Rollen: „Schirmer“ des Reiches (Picc., 835), Rebell, Kriegs- und Friedensheld, Überwinder des „ewig Gestrigen“ (Tod, 218) sowie zugleich der legitime Repräsentant eben dieser Ordnung. Seine Ambivalenz geht bis zur Zerrissenheit, er ist ein Leidender. Die Aufhebung dieser Widersprüche gelingt ihm nur im Phantasieraum, in dem er sich austobt.
[...]
[1] Vgl. Menzel, 80: „Politik heißt Umgang mit Macht: Macht begründen, Macht entfalten, Macht erhalten, Macht demonstrieren, Macht ausüben, Macht ausbalancieren“.
[2] Clausewitz analysiert den Krieg als Akt der Gewalt zur Durchsetzung bestimmter Zwecke und bekanntlich als „Fortsetzung der Politik unter Einmischung anderer Mittel“: Er stellt im politischen Prozess also lediglich ein Machtmittel unter anderen dar.
[3] Machiavelli, N.: Discorsi, Gedanken über Politik und Staatsführung
[4] Vgl. Borchmeyer, 118
[5] Morgenthau,49: Der „theoretischen Auseinandersetzung mit dem menschlichen Wesen, wie es wirklich ist, und mit den geschichtlichen Abläufen, wie sie den Tatsachen entsprechen, verdankt die hier dargestellte Theorie den Namen
[6] Zit. Nach Borchmeyer, 130
[7] Vgl. Borchmeyer, 129ff.
Häufig gestellte Fragen zu "Wallenstein"
Worum geht es in dem Text hauptsächlich?
Der Text ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Hauptthemen, die Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter des Werkes "Wallenstein" enthält. Im Zentrum steht die Analyse der Macht und des politischen Handelns in Schillers Drama.
Welche Themen werden im Inhaltsverzeichnis angesprochen?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst Themen wie Schillers Werk "Wallenstein" und das Drama der Macht, Phantasien der Macht im Verhältnis von Spiel und Ernst, den Achsenmonolog, machiavellistischen Realismus bei Schiller, Verschwörungen, den dramatischen Diskurs der Sicherheit, Wallensteins Machtdilemma, die Konstruktion von Wirklichkeit, Wallensteins Scheitern und die Frage, wo die Ideale bleiben.
Welche Figuren spielen eine wichtige Rolle in der Analyse?
Die Analyse konzentriert sich auf Figuren wie Wallenstein, den Kaiser, Octavio Piccolomini und Max Piccolomini. Ihre politischen Anschauungen und Handlungen werden im Kontext des Machtkampfes untersucht.
Welche politischen Theorien werden im Text diskutiert?
Der Text verweist auf Niccolò Machiavellis politische Theorie und Immanuel Kants Schrift "Zum ewigen Frieden" als konträre Paradigmen, die das Handeln der Figuren beeinflussen.
Was ist das zentrale Dilemma der Macht, das Schiller aufzeigt?
Schiller verdeutlicht das Dilemma, dass Akteure mit Macht Vorkehrungen treffen müssen, sich vor der Macht anderer zu schützen, was zu einem selbsterhaltenden und selbstverstärkenden Machtkampf führen kann. Im Drama wird dieses Dilemma durch Verschwörungen und dem Aufbau von Übermacht gelöst.
Welche Bedeutung hat die Unterscheidung zwischen "Spiel" und "Ernst" im Bezug auf Wallenstein?
Wallenstein wird als jemand dargestellt, der Machtspiele in der Phantasie spielt, ohne die Konsequenzen für die Realität ausreichend zu berücksichtigen. Seine Gegner nehmen dieses Spiel jedoch ernst, was zu einem Konflikt führt, in dem die Grenze zwischen Phantasie und Realität verschwimmt.
Welche "Schuld" wird Wallenstein angelastet?
Wallenstein wird eine politische Unklugheit angelastet, da er sich in Phantasien der Macht ergeht, die seine Gegner verängstigen. Er verwechselt die Rolle des Schauspielers mit der Rolle eines mächtigen Feldherrn in der Realität.
Was wird im Bezug auf die gegenwärtige Theaterszene kritisiert?
Es wird kritisiert, dass die großen Bayerischen Schauspielbühnen im Schillerjahr keine engagierten Inszenierungen von Schillers "Wallenstein" zeigen, um auf das aktuelle politische Klima der Angst und der Bedrohungsgefühle zu reagieren.
- Quote paper
- M.A. Björn Potulski (Author), 2004, Wallensteins Dilemma - Macht, Politik und Wirklichkeitskonstruktion in Schillers Hauptwerk, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110895