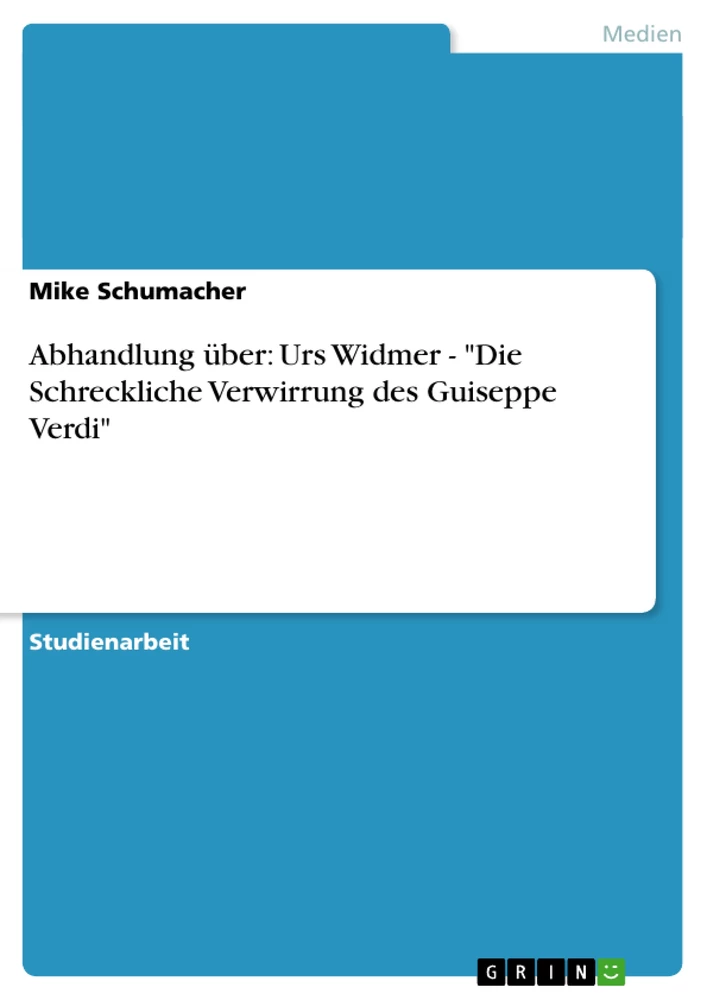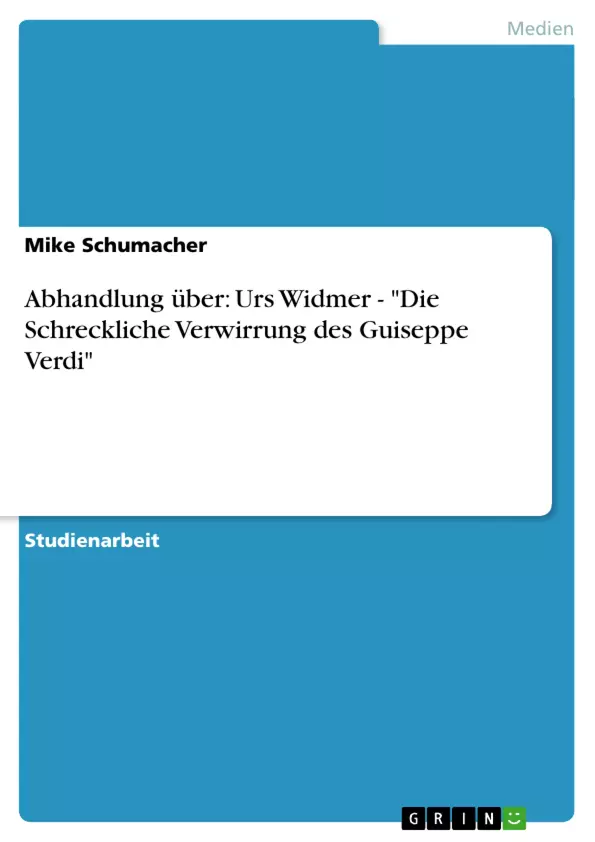Wie wird die Hauptperson des Stückes in unserer Gesellschaft eingefügt?
Und wie interagiert das Individuum mit seinem Lebensraum. Diese Fragen möchte ich näher beleuchten und zum zentralen Punkt dieser Arbeit machen.
Warum gerade auf Giuseppe Verdi eine zentrale Rolle im Stück entfällt, welche Versinnbildlichung durch diese Personifizierung stattfindet und ob Urs Widmer möglicherweise eine Antwort auf die Schizophrenien unserer Zeit gibt, wird in (2.2.) näher beleuchtet.
Ein weiterer wichtiger Untersuchungsansatz meiner Arbeit soll sich mit der musikalischen Natur des Stückes beschäftigen, da diese untrennbar mit dem Inhalt des Stückes verwoben zu sein scheint.
Urs Widmer und Peter Zwetkoff wurden für ihr Stück 1974 mit dem Karl-Scuka-Preis ausgezeichnet, welcher für „die beste radiophonisch gestaltete Produktion eines Hörspiels“ vergeben wurde (2.3.).
Zuletzt möchte ich einen Zusammenhang zwischen diesem Stück und der Bewegung der „Arte Povera“ herstellen, welche in die legendäre Zeit der 68-er einzuordnen ist.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Durchführung
2.1. Hauptproblematik
2.2. Versinnbildlichung Verdis
2.3. Musikalischer Untersuchungsansatz
2.4. Arte Povera
3. Schluss
4. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
„Die schreckliche Verwirrung des Giuseppe Verdi“ erzählt die Geschichte eines Komponisten heutiger Tage, der aufgrund seiner fortschreitenden Schizophrenie, zunehmend mit geistlicher Entfremdung seiner Umwelt begegnet.
Anhand der komplex aufgebauten Geschichte des Stückes in drei Ebenen möchte ich nachweisen, wie Urs Widmer auf geniale Art und Weise dem Hörer das Krankheitsbild Schizophrenie näher bringt und seinen Helden unbemerkt tiefer und tiefer entgleiten lässt in die Dualität von Realität und Schein. Wichtig erscheint mir der ungebrochene Bezug zu unserer gegenwärtigen Zeit. Zwischen 1 bis 10 Prozent der Bevölkerung leiden an Schizophrenie. Dies ist demnach keine Randgruppe. Mein Untersuchungsansatz liegt infolgedessen darin, wie konfrontiert Urs Widmer den unvorbereiteten Hörer mit dieser Krankheit.
Wie wird die Hauptperson des Stückes in unserer Gesellschaft eingefügt.
Und wie interagiert das Individuum mit seinem Lebensraum. Diese Fragen möchte ich näher beleuchten und zum zentralen Punkt (2.1.) dieser Arbeit machen.
Warum gerade auf Giuseppe Verdi eine zentrale Rolle im Stück entfällt, welche Versinnbildlichung durch diese Personifizierung stattfindet und ob Urs Widmer möglicherweise eine Antwort auf die Schizophrenien unserer Zeit gibt, wird in (2.2.) näher beleuchtet.
Ein weiterer wichtiger Untersuchungsansatz meiner Arbeit soll sich mit der musikalischen Natur des Stückes beschäftigen, da diese untrennbar mit dem Inhalt des Stückes verwoben zu sein scheint.
Urs Widmer und Peter Zwetkoff wurden für ihr Stück 1974 mit dem Karl-Scuka-Preis ausgezeichnet, welcher für „die beste radiophonisch gestaltete Produktion eines Hörspiels“ vergeben wurde (2.3.).
Zuletzt möchte ich einen Zusammenhang zwischen diesem Stück und der Bewegung der „Arte Povera“ herstellen, welche in die legendäre Zeit der 68-er einzuordnen ist (2.4.)
2. Durchführung
2.1. Hauptproblematik
Die Hauptperson des Stückes ist ein Mann namens Helmut. Er wird dem Hörer als opernschreibender Komponist vorgestellt, der aber bisher nur von mäßigem Erfolg gesegnet ist. Seine neuste Oper lässt sich wie folgt beschreiben. „Der Inhalt meiner Oper ist [...] Giuseppe Verdi will eine Oper schreiben. Er denkt in meiner Oper, dass in seiner, ein toller wilder italienischer Landarbeiter vorkommt, der flammende Arien zu den anderen unterdrückten Landarbeitern spricht.“ (5)
In diesem Zitat spiegeln sich bereits zwei von drei Handlungsebenen des Stückes wieder. Die dritte stellt das Leben von Helmut an sich dar, welche die eigentliche „Haupthandlungsebene“ repräsentiert.
Anhand drei verschiedener Sprecherstimmen ist es halbwegs möglich, dem ständig wechselnden Geschehen zu folgen. Helmut, persönlich gesprochen von Urs Widmer, offenbart dem gespannten Zuhörer sein Leben, seine Umwelt, seine Träume und Phantasien. „Durch den Schleier vor meinen Augen ...“ (5) berichtet er schon frühzeitig von seinem veränderten Realitätsbewusstsein. Die Liebesgeschichte des bäuerlichen Nabuccos mit der aristokratischen Violetta, eingebettet in die revolutionäre Phase des Unabhängigkeitskampfes Italiens um 1850, bilden die Eckpfeiler der zwei weiteren Ebenen, deren Bedeutungsinhalte den Charakter von Traumnovellen und Tagesphantasien haben, die den Komponisten während seiner Arbeit begleiten. Gesprochen werden Helmuts exzessive Träumerein von den zwei weiteren weiblichen Sprechern des Stückes. So durchlebt Helmut die Rolle des Verdis im Italien des 19.Jahrhunderts, die Zeit, in welcher der reale Verdi lebte. Aufgrund zunehmend mangelnder Differenzierbarkeit vermischen sich die Welten für Helmut mehr und mehr.
Schon zu Beginn erfährt der Zuhörer von den bewundernden Gedanken Helmuts für Guiseppe Verdi. „Giuseppe Verdi ist [...] schon ein Kerl gewesen, Weisgott. Er hat Arien geschrieben, Chöre , Ouvertüren ...“ (5) Hingegen muss Helmut sein Dasein mit dem Komponieren von Vertragsopern fristen, die zudem nicht richtig abgerechnet werden. Schlimmer noch „Ein Held sollte man sein mit einem Ross und einem Spieß. Da komponiert man und komponiert man und am ersten steht der Hausbesitzer unter der Tür und will doppelt so viel Miete. Das war zu Giuseppe Verdis Zeiten, schreie ich, ganz, ganz anders.“ (5) Helmut scheint auch außerordentlich von monetären Nöten geplagt zu sein, was, wie ich denke, einen weiteren Schub der Realitätsentfremdung bewirkt. Halbe Verschwörungstheorien machen sich in Helmuts Gedankenwelt bemerkbar, welche zugunsten von Phantastereien verdrängt werden. Unablässig träumt Helmut von großen bedeutungsvollen Werken, die er verfassen möchte, solche, die ihn mit Respekt und Ruhm huldigen, solche, die ihn als „Maestro“ erscheinen lassen.
„Ich schreibe ununterbrochen an meiner Oper ...“ oder „Ich atme heftig.“ oder „... ich esse nur noch wenig [...]“(5) verdeutlichen, dass Helmut wie ein Besessner an seiner Oper schreibt, korrigiert und verändert, denn sein großes Vorbild tat dies dito. Mit Voranschreiten der Geschichte vernimmt der Hörer Helmuts steigende manische Begeisterung für seinen Maestro. Eine genaue Beschreibung des Erscheinungsbildes Verdis erhält der Hörer in folgendem Auszug: „Giuseppe Verdi [..] saß auch als steinalter Mann mit seinem eisgrauen Bart, seinem Vatermörder seinem Gehrock und seinen schwarzen Lackschuhen [...] aufrecht in der Loge der Scala.“(5) Diese Beschreibung ist sehr wichtig, denn sie ist wesensgleich, mit einer anderen Beschreibung am Ende des Stückes. Darauf werde ich später noch genauer eingehen.
An dieser Stelle erscheint eine genauere Definition von Schizophrenie angebracht. „Oberbegriff für verschiedene Formen einer schweren psychischen Erkrankung, die mit Veränderungen des Denkens, Fühlens und Verhaltens einhergeht. Ein Hauptmerkmal dieser Störung ist ein tief greifender Realitätsverlust. Die Gedanken und Gefühle des Schizophrenen weisen keinen logischen Zusammenhang auf. Durch eine übersteigerte Wahrnehmungsfähigkeit können sich Wahnvorstellungen und Sinnestäuschungen (Halluzinationen) entwickeln.“ (1)
[...]
- Citar trabajo
- Mike Schumacher (Autor), 2003, Abhandlung über: Urs Widmer - "Die Schreckliche Verwirrung des Guiseppe Verdi" , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110982