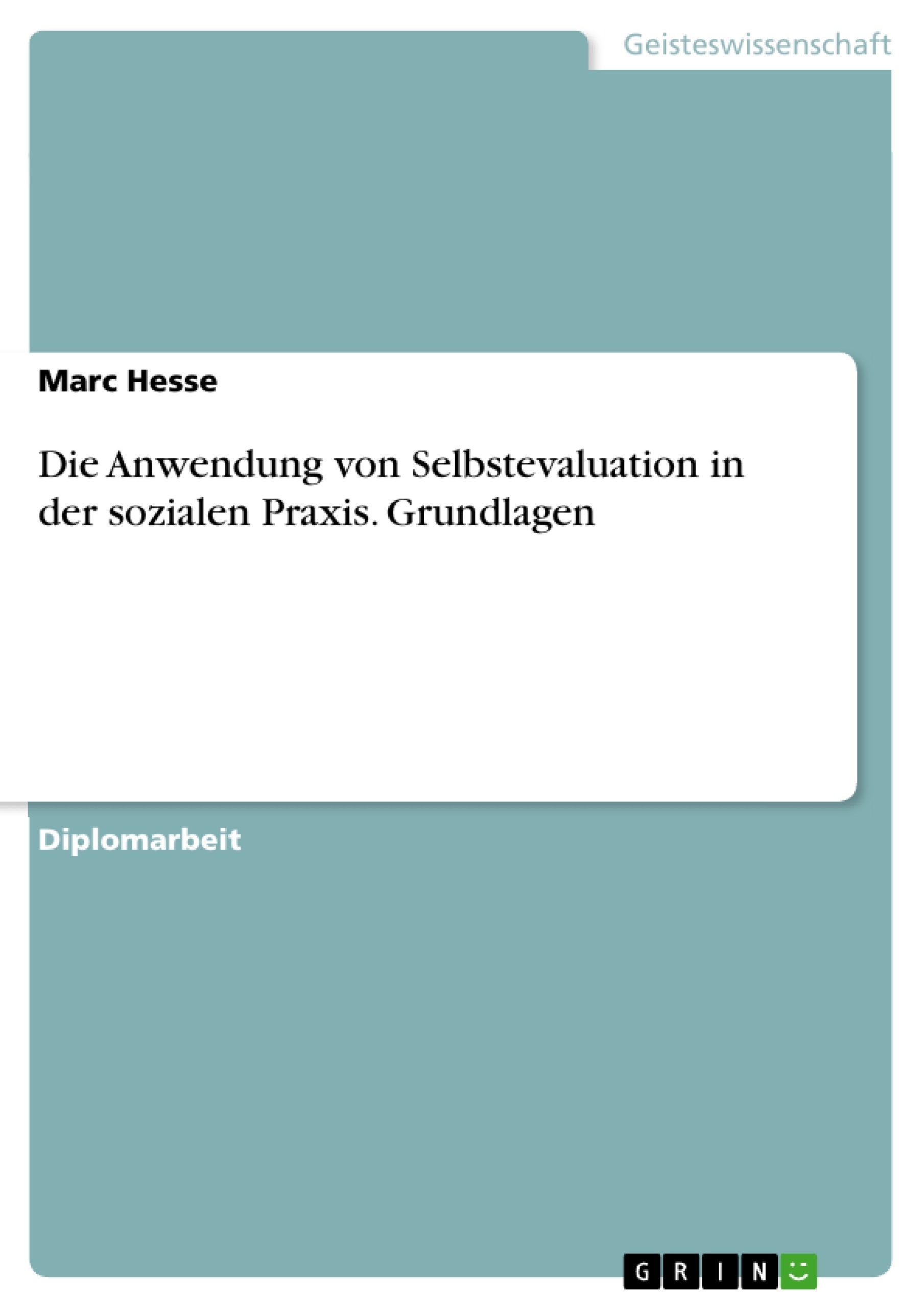Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Komplexität Ihrer sozialpädagogischen Arbeit nicht nur bewältigen, sondern auch aktiv gestalten und verbessern. Dieses Buch enthüllt die verborgenen Potenziale der Selbstevaluation in der sozialen Arbeit und bietet Ihnen einen praxiserprobten Leitfaden, um Ihre berufliche Tätigkeit systematisch zu reflektieren und zu optimieren. Es geht weit über oberflächliche Reflexionen hinaus und zeigt Ihnen, wie Sie durch strukturierte Verfahren und bewährte Methoden Ihre eigenen Stärken erkennen, Herausforderungen meistern und die Qualität Ihrer Arbeit nachhaltig steigern können. Entdecken Sie, wie Sie Ihre täglichen Routinen in wertvolle Lernprozesse verwandeln, indem Sie Zielsetzungen klar definieren, Erfolge messbar machen und aus Fehlern lernen. Das Buch beleuchtet die wesentlichen Elemente der Selbstevaluation, von der präzisen Definition des Evaluationsgegenstandes bis zur Entwicklung geeigneter Bewertungskriterien, und zeigt Ihnen, wie Sie diese in verschiedenen Arbeitsfeldern der sozialen Arbeit anwenden können. Erfahren Sie mehr über die Rolle der Selbstevaluation in der sozialpädagogischen Fallarbeit, die Verknüpfung mit professioneller Handlungskompetenz und die ethischen sowie rechtlichen Aspekte, die es zu beachten gilt. Zahlreiche Fallbeispiele und Interviews mit erfahrenen Praktikern geben Ihnen Einblicke in die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und zeigen, wie Sie Selbstevaluation als ein wirksames Instrument zur Qualitätssicherung und persönlichen Weiterentwicklung nutzen können. Ob strukturierte Verlaufsnotizen, die Evaluation von Teamsitzungen, die Netzwerkanalyse oder die Zielsetzungsprotokollierung – dieses Buch liefert Ihnen das notwendige Know-how und die praktischen Werkzeuge, um Ihre sozialpädagogische Arbeit auf ein neues Niveau zu heben. Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie die transformative Kraft der Selbstevaluation für Ihre berufliche Praxis in der Sozialarbeit, Jugendhilfe und weiteren sozialen Bereichen. Qualitätsmanagement, Praxisforschung, Reflexionsmethoden, Handlungskompetenz, Ethik, Soziale Arbeit, Pädagogik, Fallarbeit, Selbstevaluation, Evaluation, Jugendhilfe, soziale Einrichtungen, Methoden der Sozialen Arbeit, soziale Kompetenz, professionelles Handeln, Hilfeplanung, Qualitätssicherung, Teamarbeit, Kinder- und Jugendhilfe, Selbstreflexion, soziale Kompetenz, Handlungskompetenz, Sozialpädagogik, Gemeinwesenarbeit, Kindererziehung, Elternberatung, Jugendamt, Fallanalyse, soziale Dienstleistungen,Jugendhilfeplanung, Jugendhilfestatistik,Praxisreflexion,Qualitätssicherung,Evaluation in der Sozialarbeit,Qualitätsmanagement im Sozialwesen,Methoden der Datenerhebung,Ethik in der Sozialarbeit,Berufsethik,Fallbesprechung,Sozialpädagogische Kompetenz,Sozialarbeitsmethoden, Soziale Einzelfallhilfe, Soziale Gruppenarbeit, Evaluation von Teamsitzungen, Netzwerkanalyse, Zielsetzungsprotokollierung, Zielerreichungskontrolle,Selbst- und Fremdeinschätzung,Teamberatung, Professionalisierung, Hilfeprozess, Intervention, Diagnose, Anamnese, systematisches Arbeiten, Methodenbewusstsein, Multiperspektivität.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Das Wesen von Selbstevaluation in der sozialen Arbeit
2.1 Evaluation sozialer Arbeit
2.1.1 Begriffsbestimmung
2.1.2 Zentrale Elemente
2.2 Selbstevaluation als Evaluationsform
2.2.1 Systematisierung und Abgrenzung
2.2.2 Merkmale und Perspektiven
2.3 Zum Verhältnis von Praxisforschung und Selbstevaluation
2.4 Der Standort des Methodenbegriffs
3 Selbstevaluation als Bestandteil sozialpädagogischer Fallarbeit
3.1 Die Phasierung des Hilfeprozesses
3.2 Verpflichtung zur Selbstevaluation?
3.3 Dimensionen sozialpädagogischer Handlungskompetenz
4 Möglichkeiten der Umsetzung von Selbstevaluations-Vorhaben
4.1 Ablauf und individuelle Charaktergestalt
4.2 Verfahren auf der Ebene des Teams
4.2.1 Strukturierte Verlaufsnotizen
4.2.2 Evaluation von Teamsitzungen mithilfe von Schätzskalen
4.3 Verfahren auf der Ebene der einzelnen Fachkraft
4.3.1 Netzwerkanalyse
4.3.2 Zielsetzungsprotokollierung
5 Zur Anwendung in der sozialen Praxis
5.1 Formen der Reflexion und Dokumentation sozialarbeiterischen Handelns
5.2 Zum Umgang mit den Effekten der eigenen Tätigkeit
5.3 Von der Reflexion zur Selbstevaluation
5.4 Selbstevaluative Aktivitäten in der Praxis
5.4.1 Persönlichkeits- und Leistungsprofil bei Jugend-ABM
5.4.2 Zielerreichungskontrolle im Hilfeplanverfahren
5.5 Alternativen und Ergänzungen
6 Zusammenfassende Schlussbetrachtungen
Quellenverzeichnis
Anhang
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Strukturierte Verlaufsnotizen (Auszug aus: HÖING 1988, 145 ff.)
Abbildung 2: Fragebogen zur Verbesserung der Teamsitzungen (WENZEL 1994, 214)
Abbildung 3: Skizze für eine Netzwerkanalyse im Fallbeispiel Katrin Bauer
Abbildung 4: Erhebungsbogen zur Protokollierung von Zielsetzungen im Fallbeispiel Schleusinger nach KÄHLER (1988, 155)
Abbildung 5: Erhebungsbogen für ein Persönlichkeits- und Leistungsprofil bei Jugend-ABM (SA 1)
Abbildung 6: Auszug aus dem Formularsatz zur Hilfeplanfortschreibung beim Jugendamt 1 (SA 2)
Abbildung 7: Auszug aus dem Formularsatz zur Hilfeplanfortschreibung beim Jugendamt 1 (SA 2)
Abbildung 8: Auszug aus dem Grundgerüst für die Fallbesprechung in einer Heimeinrichtung (SA 5)
1 Einleitung
Evaluationsprogramme finden längst in den verschiedensten Wissenschaftszweigen und Berufsfeldern Akzeptanz und häufige Anwendung. Nicht selten werden sie großvolumig ausgestaltet, und häufig sind sie dabei komplex, kostenintensiv und wenig transparent. Teilweise wirken sie sich im Ergebnis nur mittelbar auf das tägliche Handeln der Praktiker aus. Das gilt auch für den Bereich der sozialen Arbeit. Erst in den letzten Jahren hat sich dort der Zweig der Selbstevaluation herausgebildet. Einzelne Personen, z. B. Maja HEINER und Hiltrud von SPIEGEL, haben den sozialwissenschaftlichen Diskurs wiederholt angeregt und zum begonnenen Etablierungsprozess des Ansatzes maßgeblich beigetragen. Gestützt auf die aktuellen und u. a. von diesen Autorinnen publizierten Erkenntnisse und Erfahrungen werden in der vorliegenden Arbeit die praktische Umsetzung und die Relevanz von Selbstevaluation untersucht. Von Interesse sind vornehmlich die Möglichkeiten der Eingliederung selbstevaluativer Verfahren in die soziale Praxis. Fokussiert werden dabei vor allem die Ebenen der einzelnen Fachkraft und von Teams.
Im folgenden Kapitel wird Selbstevaluation zunächst in ihren Wesenszügen dargestellt. Es werden die Zielstellungen und Nutzen des Ansatzes bestimmt sowie eine Einordnung innerhalb der Evaluation und eine Abgrenzung zur Praxisforschung vorgenommen. Es wird erörtert, ob Selbstevaluation als Methode der Sozialen Arbeit zu verstehen ist, und inwiefern das Verfahren selbst an Methoden gebunden ist. Das dritte Kapitel widmet sich der Frage, in welcher Form der Ansatz als Bestandteil sozialpädagogischer Fallarbeit verstanden werden kann. Hierbei wird auf die Phasierung des Hilfeprozesses, auf rechtliche und ethische Normen sowie auf die Verknüpfung mit professioneller Handlungskompetenz Bezug genommen. Im darauf folgenden vierten Kapitel wird ein allgemein gehaltenes Planungsschema für Selbstevaluation angeführt. Dessen Elemente werden anschließend genutzt, um vier Literaturbeispiele für Selbstevaluation kritisch zu beschreiben.
Die Sichtweisen von verschiedenen Fachkräften aus der Praxis sozialer Arbeit werden im fünften Kapitel wiedergegeben. Es werden sieben Leitfadeninterviews, welche in Jugendämtern und anderen Einrichtungen der Jugendhilfe durchgeführt wurden, vergleichend ausgewertet.
Untersucht werden der Umgang mit den Effekten eigenen Handelns, die Umsetzung von Reflexionsprozessen sowie die Einstellung gegenüber dem Ansatz der Selbstevaluation. Praxisreflexion wird begrifflich und in Bezug auf die wahrgenommenen Formen ihrer Ausprägung differenziert, um hiernach ein erneuertes Verständnis von Selbstevaluation zu definieren. Ausgehend davon werden drei – in den Einrichtungen praktizierte – systematisierte Reflexionsverfahren exemplarisch dargelegt. Es wird geprüft, ob und inwiefern sie die Merkmale von Selbstevaluation aufweisen und sich dem Ansatz annähern oder ihm gleichen. Betrachtet werden in Auswertung der Interviews außerdem mögliche Alternativen und Ergänzungen zu selbstevaluativen Vorgängen.
Da „Sozialpädagogik“ und „Sozialarbeit“ als Schauplätze der Selbstevaluation nicht voneinander getrennt werden können, wird im Kontext der vorliegenden Arbeit auf eine begriffliche Unterscheidung verzichtet und eine weitestgehende Synonymie unterstellt.
2 Das Wesen von Selbstevaluation in der sozialen Arbeit
2.1 Evaluation sozialer Arbeit
2.1.1 Begriffsbestimmung
Der aus dem Lateinischen[1] stammende, aber amerikanische Begriff „Evaluation“ bedeutet im deutschen Sprachraum soviel wie „Bewertung, Beurteilung“ (KARBACH 2001). Für den sozialwissenschaftlichen Bereich definiert C. Wolfgang MÜLLER Evaluierung als „akkurate Einschätzung des Wertes einer Einrichtung oder Maßnahme mit Methoden und Instrumenten der empirischen Sozialforschung“ (1996, 189). Während WOTTAWA/THIERAU (1990, 9) die explizite Anwendung wissenschaftlicher Forschungsmethoden nicht als Eigenschaft der Evaluation, sondern vielmehr als Merkmal von Evaluationsforschung ausweisen, betont BEYWL den Anspruch von Evaluation, dass sie bereits eine „systematische, datenbasierte Beschreibung und Bewertung von Programmen (...), zeitlich beschränkten Projekten (...) oder Institutionen“ (Uni Köln 2000) sein sollte.
Der von Wennemar SCHERRER geprägte „Faktor Vier“ in der Jugendarbeit hat angesichts knapper werdender öffentlicher Mittel und angestrengt geführter Diskussionen um Jugendhilfequalität sowie Verwaltungsstrukturreformen in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen: „Hilfen für junge Menschen müssen bei einer Halbierung des Ressourceneinsatzes doppelt so viel Qualität und doppelt so große Wirkungen aufweisen als bisher“ (BMFSFJ 1996, 29.9). Wenngleich dieser programmatische Vorsatz in der Praxis der sozialen Arbeit kaum umsetzbar zu sein scheint, proklamiert er doch zwei wesentliche Ziele von Evaluation: Evaluative Aktivitäten sollen die Voraussetzungen für eine Effizienzsteigerung einerseits sowie andererseits für die Erhöhung der Wirksamkeit (Effektivität) sozialer Programme schaffen.
Evaluation in der sozialen Arbeit heißt zunächst, die Qualität, Effektivität und Effizienz des sozialpädagogischen Handelns, von Arbeitsabläufen, Projekten oder Programmen mit adäquaten wissenschaftlichen Methoden zu überprüfen und zu messen, um sie gegebenenfalls korrigieren zu können. Die besonders aktuellen Hintergründe von Evaluationsvorhaben in der sozialen Arbeit sind Kostenreduzierung, die (vor allem politische) Legitimation sowie die Qualifizierung der eigenen Arbeit.
„Auf wenige Schlagworte verkürzt ließe sich also sagen, Evaluation heißt:
- sozialpädagogisches, politisches und administratives Handeln effektiv und effizient zu gestalten,
- viele verfügbare Informationen und Beteiligte einzubeziehen,
- alternative Lösungen abzuwägen,
- begründbare Entscheidungen zu treffen,
- Argumente zur Durchsetzung von erfolgversprechenden Konzepten zu sammeln,
- Verantwortung für die entwickelten Konzepte zu übernehmen,
- sich selbst kritisch zu hinterfragen,
- das eigene Handeln fortwährend optimieren (sic!)“
(FRÜCHTEL 1995, 8).
2.1.2 Zentrale Elemente
Um dem ungegenständlichen Evaluationsbegriff etwas mehr Plastizität zu verleihen, eignet sich die Sichtweise von LENZ/GMÜR (1996, 53 ff.), die ähnlich wie Burkhard MÜLLER (1997, 126 ff.) zentrale Elemente hervorheben: den Evaluationsgegenstand, den Evaluator, das Evaluationsverfahren sowie die Evaluationskriterien. Der Begriff Evaluationsgegenstand beschreibt das, was im Rahmen eines Evaluationsvorhabens untersucht und bewertet werden soll. Auf ihn richtet sich das Untersuchungsinteresse. Seine Definition bestimmt sich nach den mit dem Auftraggeber der Evaluation vereinbarten Zielstellungen. WOTTAWA/THIERAU (1990, 51) verwenden synonym den Begriff „Evaluationsobjekt“. Global und unabhängig vom betroffenen gesellschaftlichen Bereich (Evaluationsbereich) verweisen sie auf unterschiedliche Gruppen von möglichen Evaluationsobjekten:
- Personen,
- Umwelt-/Umgebungsfaktoren,
- Produkte,
- Techniken/Methoden,
- Zielvorgaben,
- Programme/Projekte,
- Systeme/Strukturen,
- Forschungsergebnisse/Evaluationsstudien.
Nach KÖNIG (2000, 69) ist die „Fragestellung einer Evaluation (...) nichts anderes als der in Frageform gebrachte Gegenstand“ der (Selbst-) Evaluation. Evaluatoren sind diejenigen Beteiligten, welche die Evaluation vornehmen. Von ihnen wird die Verantwortung der Evaluationsplanung, -durchführung und -auswertung übernommen sowie umgesetzt. Eine einfache Gliederung denkbarer Evaluationsperspektiven neben der Selbstevaluation wird von Burkhard MÜLLER (1997, 138) vorgeschlagen: Evaluation „von oben“, „von unten“ sowie „von außen“. Ungeachtet der noch zu erörternden (sozial-) wissenschaftlichen Komponente von Evaluation können bei dieser Betrachtungsweise Vorgesetzte, Fachaufsichten und Kontrollinstanzen Evaluatoren „von oben“, Klienten und Betroffene „von unten“, sowie Öffentlichkeit (sowohl Bürger und Laien, als auch die sozialwissenschaftliche Fachwelt) Evaluatoren „von außen“ sein.
Als Evaluationsverfahren bezeichnen LENZ/GMÜR (1996, 56 ff.) die Art der Durchführung, die Vorgehensweise beim Evaluationsvorhaben. Versteht man das „Verfahren“ als „Technik“ sozialen Handelns, also als weniger komplexes Element einer Methode, und begreift man die Methode als den „vorausgedachten Plan der Vorgehensweise“ (GEISSLER/HEGE 1999, 24 ff.), dann ist „Evaluationsmethode“ der scheinbar geeignetere Begriff. Auf den Umgang mit dem Terminus „Methode“ wird weiter unten noch eingegangen (vgl. 2.4). Im begrifflichen, aber auch gegenständlichen Umfeld des Evaluationsverfahrens befindet sich das Evaluationskonzept, worunter ein formulierter (möglichst niedergeschriebener) Evaluationsplan zu verstehen ist. Evaluationsinstrumente sind Hilfsmittel (Fragebögen, Interviewleitfaden, Beobachtungsprotokolle, etc.), die im Rahmen des methodischen Vorgehens, z. B. bei der Datenerhebung, verwendet werden. Geeignete Verfahren, Techniken und Instrumente lassen sich im Wesentlichen den quantitativen und qualitativen Methoden der empirischen Sozialforschung entlehnen. Evaluationskriterien sind die Vorgaben, nach denen ein Evaluationsgegenstand untersucht wird. In der Praxis der Evaluation sozialer Arbeit gehören dazu vor allem die Effektivität sozialarbeiterischen Handelns (Wirkungen) sowie die Effizienz des Ressourceneinsatzes (Aufwand-Nutzen-Verhältnis). Für die Evaluation eigenen beruflichen Handelns führt Burkhard MÜLLER (1997, 135) weiterhin ethische Kriterien sowie Kriterien der Realitätsprüfung an. Kriterien sind bereits vorhandene (Wert-) Maßstäbe, mithilfe derer eine Bewertung des Gegenstandes geschehen kann.
2.2 Selbstevaluation als Evaluationsform
2.2.1 Systematisierung und Abgrenzung
Beim Versuch, die sehr unterschiedlichen Ansätze und Modelle von Evaluation zu systematisieren, stößt man in der einschlägigen Literatur (WOTTAWA/THIERAU 1990, von SPIEGEL 1993, HEINER 1996, MENNE 1998) auf zahlreiche, aber wiederkehrende Perspektiven, aus denen differenziert wird. Um die Formen der Selbstevaluation, welche Gegenstand des vorliegenden Textes sind, leichter einordnen zu können, seien im Folgenden einige Evaluationsansätze und -klassifizierungen beschrieben.
Die wohl häufigste Unterscheidung wird zwischen der summativen und der formativen Evaluation getroffen. Hat eine Evaluation summativen Charakter, so handelt es sich um die abschließende Bewertung eines Projektes. Dagegen findet die formative Evaluation noch während der Durchführung der Maßnahme bzw. des Programmes statt, sie nimmt gleichzeitig Einfluss auf den ablaufenden Prozess. Bezogen auf die Untersuchungsebene, die den Evaluationsgegenstand bestimmt, grenzt LIEBALD (1996, 13) die Mikroevaluation, bei welcher einzelne Teile oder Details einer Arbeits-/Organisationseinheit untersucht werden, von der Makroevaluation, welche auf die Bewertung des Gesamtprogrammes/-projektes abzielt, ab. Im Gegensatz zur vergleichenden Evaluation, in welcher zwei oder mehrere gleichartige Evaluationsgegenstände miteinander verglichen werden, wird in der Praxis sozialer Arbeit häufiger die nicht-vergleichende Evaluation durchgeführt. Die Bewertung des Evaluationsgegenstandes erfolgt hier anhand von vorher festgelegten bzw. allgemein anerkannten Standards.
Eine Klassifizierung zum Verständnis des Ansatzes der Selbstevaluation nehmen BEYWL/ SCHEPP-WINTER (2000, 31) vor, indem sie zwischen
- Selbstevaluation,
- interner und
- externer Evaluation
unterscheiden. Bei der externen Evaluation wird ein organisationsfremder Dritter mit der Untersuchung/Bewertung der Maßnahme/des Projektes beauftragt, z. B. ein Sozialwissenschaftler. Intern verläuft eine Evaluation dann, wenn der Evaluator aus den Reihen der Organisation stammt. Sind hingegen die gleichen Personen sowohl für die Umsetzung des Projektes/der Maßnahme als auch für die Durchführung der Evaluation verantwortlich, dann wird von Selbstevaluation gesprochen. Eine differenziertere Unterscheidung stammt von HEINER (1996, 35 ff.). Sie beschreibt für die oben definierte interne Evaluation fünf verschiedene Evaluationssettings:
- zentrale Programmevaluation,
- Teamselbstevaluation,
- kollegiale Selbstevaluation,
- kollegiale Fremdevaluation und
- individuelle Selbstevaluation.
Unter zentraler Programmevaluation ist nach HEINER ein Setting zu verstehen, „in welchem eine sozialwissenschaftlich ausgebildete Expertin in Nähe zur Leitung (z. B. in Stabsfunktion) eine Organisation(seinheit) in allen Punkten, die zentral für die Durchführung des Programms dieser Organisation(seinheit) sind“ (1996, 35), untersucht. Bei einer Teamselbstevaluation wird die Arbeit der Organisationseinheit vom gesamten Team evaluiert, während berufliches Handeln bei einer kollegialen Selbstevaluation von einzelnen Mitarbeitern innerhalb vorher festgelegter und gleich bleibender Paare gegenseitig untersucht wird. Eine kollegiale Fremdevaluation findet dann statt, wenn diese Evaluationspartner unregelmäßig gewechselt werden und es nicht bei einem feststehenden paarweisen Gegenseitigkeitsverhältnis bleibt. Zur individuellen Selbstevaluation wird zunächst weder ein Partner noch ein dritter Evaluator benötigt. Hier geht es um die Bewertung des persönlichen Handelns durch die einzelnen Mitarbeiter selbst.
Obwohl HEINER (ebd.) interne Evaluation genauso definiert wie BEYWL/SCHEPP-WINTER (2000, 31) wird deutlich, dass die interne Evaluation sowohl als Fremd- als auch als Selbstevaluation ausgeführt werden und demnach als Evaluationsform nicht gleichrangig neben der Selbstevaluation stehen kann. Aus der Sicht von WOTTWA/THIERAU (1990, 30) ist Selbstevaluation sogar das gleiche wie innere (interne) Evaluation. In Anlehnung an HEINER muss jedoch festgehalten werden, dass Selbstevaluation lediglich eine Form von interner Evaluation ist. Es kann vorerst zusammengefasst werden, dass Selbstevaluation dadurch charakterisiert wird, dass der Evaluator im weiteren Sinne gleichzeitig auch Evaluationsgegenstand ist, damit also Objekt und Subjekt der Untersuchung[2]. In diesem Kontext findet Selbstevaluation auf verschiedenen Ebenen statt: Möglich erscheint sie unter anderem auf der Ebene einer Organisation (z. B. Jugendverband), einer Arbeitseinheit (z. B. Fachbereich, Arbeitsgruppe, Vorstand), aber als individuelle Selbstevaluation auch auf Ebene des einzelnen Mitarbeiters (z. B. Jugendbildungsreferent). Dem allgemeinen Verständnis von Selbstevaluation folgend richtet sie sich jedoch in der Regel weniger an größere Organisationseinheiten, sondern vielmehr an Teams und Fachkräfte:
„Bei der Selbstevaluation wird das eigene berufliche Handeln mit seinen Konsequenzen erforscht“
(HEINER 1998b, 56).
„Es geht darum, gestützt durch SE (Selbstevaluation, d. Verf.) das eigene Handeln zu verbessern bzw. die Qualität zu belegen und zwar planmäßig (...). Wir meinen ausschließlich das eigene Handeln bzw. höchstens noch von Teams“ (BEYWL/BESTVATER 1998, 40).
„Die Selbstevaluation ist ein Instrument für Fachkräfte, die ,an der Basis’, also direkt mit den Adressaten und Adressatinnen der sozialen Arbeit zu tun haben und auch für Leitungskräfte, die ihre eigene Organisations- und Führungsarbeit unter die Lupe nehmen wollen“ (von SPIEGEL 1997, 32).
„Selbstevaluation zielt (...) nicht auf die Evaluation ganzer Einrichtungen oder großer Programme, sondern ist i. d. R. auf die eigene berufliche Tätigkeit ausgerichtet“ (LIEBALD 1996, 14).
2.2.2 Merkmale und Perspektiven
Mit Selbstevaluation werden in der sozialen Arbeit hauptsächlich zwei Erwartungen verbunden, BEYWL/BESTVATER ordnen ihr einen „doppelten Auftrag“ zu: zum einen Praxisveränderung, zum anderen Erkenntnisgewinn (1998, 41). Das eigene professionelle Handeln soll gestärkt bzw. korrigiert werden; gleichzeitig und teilweise auch als Voraussetzung dafür soll Selbstevaluation zudem Erkenntnisse über die Praxis liefern. Es liegt nahe, dass gleiche oder ähnliche Anforderungen auch an andere Evaluationsformen gerichtet werden.
Jedoch ergeben sich mit einer Selbstevaluation zahlreiche Vorteile, die im Rahmen der Evaluationsplanung eine beachtliche Relevanz haben: Gegenüber Fremdevaluatoren würden sich Praktiker häufig reserviert bis ablehnend verhalten, da sie selbst nur bedingt in die Evaluationsprozesse einbezogen werden könnten, und die Untersuchung in Ermangelung der Transparenz für die einzelnen Mitarbeiter eher Kontrollängste hervorrufen würde als die Bereitschaft zu aktiver Mitarbeit und Öffnung. Zweitens haben Selbstevaluatoren in der Regel einen unkomplizierteren Zugang zu den für die Untersuchung benötigten Informationen und Daten. Die unmittelbare Praxisnähe bedeutet für Selbstevaluatoren zwar gleichzeitig auch Praxisdruck auf Grund laufender Tätigkeiten, dennoch sind die zur Verfügung stehenden Ressourcen für eine Evaluation für sie leichter erreichbar. Die Wahrscheinlichkeit formativer Auswirkungen (schrittweise Praxisveränderung) ist wegen der vermutlich höheren Transparenz und Akzeptanz des Vorhabens und der intensiveren Einbindung der Fachkräfte um einiges größer als bei einer Fremdevaluation. Geschieht Selbstevaluation integriert in den Praxisalltag, kann sie im Vergleich zu externen Formen ohne weiteres zeitsparender und kostengünstiger, also effizienter, gestaltet werden. Zusätzlich wirken sich selbstevaluative Aktivitäten auf die Persönlichkeiten der Fachkräfte aus: Es werden methodisches Vorgehen trainiert, Handlungs- und Methodenbewusstsein angeregt, Veränderungsbereitschaft vorangetrieben, Entscheidungs- und Tätigkeitsverantwortung bewusst gemacht und die berufliche Identität gefördert.
Von SPIEGEL macht die Ziele und die Bedeutung von Selbstevaluation mithilfe von vier Perspektiven deutlich – Kontrolle, Aufklärung, (fachliche) Qualifizierung sowie Innovation:
„1. Man kann mit geeigneten Methoden die geleistete Arbeit bilanzieren und bewerten (Option der Kontrolle).
2. Man kann das Wissen über Prozesse innerhalb der Sozialen Arbeit vertiefen (Option der Aufklärung).
3. Man kann die berufliche Tätigkeit unter fachlichen Gesichtspunkten überprüfen (Option der Qualifizierung).
4. Und man kann sie als Hilfsmittel bei Planungen und Umstrukturierungen einsetzen (Option der Innovation)“
(von SPIEGEL 1993, 220).
Eine fünfte Perspektive fügt KÖNIG (2000, 49) hinzu: Selbstevaluation dient der Selbstvergewisserung und der Stärkung der Daseinsberechtigung.
Der Autor räumt aber ein, dass dieses Motiv „Legitimation“ Zusammenfassung und Ergebnis der vorgenannten Perspektiven ist.
Der Ansatz der Selbstevaluation birgt nicht ausschließlich Vorteile und Vorzüge, auch er ist beispielsweise an Rahmenbedingungen (u. a. Freiwilligkeit, zeitlicher Freiraum, Entlastung vom Praxisdruck) gebunden, ohne die der Erfolg der Untersuchung zweifelsohne ausbleiben würde. Soll eine Selbstevaluation, wie oben gefordert, systematisch und methodengeleitet stattfinden, sind hierfür bereits besondere sozialwissenschaftliche Kenntnisse (z. B. aus dem Bereich der empirischen Sozialforschung) und Fertigkeiten erforderlich, wie sie von den meisten externen Evaluatoren erwartet werden könnten. Vor diesem und vor dem Hintergrund der Gefahr von Selbsttäuschungen erscheinen kombinierte Verfahren der Fremd- und Selbstevaluation oder aber die Umsetzung angeleiteter Selbstevaluationskonzepte sinnvoll.
2.3 Zum Verhältnis von Praxisforschung und Selbstevaluation
Eine längere Tradition als der Ansatz der Selbstevaluation hat die sozialwissenschaftliche Praxisforschung. Sie verfolgt im Wesentlichen drei Ziele:
- die Erforschung sozialer Probleme, auf welche die soziale Arbeit reagiert,
- die Untersuchung der sozialen Arbeit, insbesondere im Hinblick auf ihre Ausgestaltung und Prozessmerkmale sowie auf ihre Rahmenbedingungen und Strukturmerkmale und
- die Erforschung der Effekte sozialer Arbeit (vgl. MÜLLER 1988, 17; HANSBAUER/ SCHONE 1998, 378).
Besonders die beiden zuletzt genannten Aufgaben von Praxisforschung stellen Schnittstellen zur Selbstevaluation dar. Sozialpädagogisches Handeln, seine Rahmenbedingungen, Settings sowie Wirkungen liegen im Zentrum des Untersuchungsinteresses. HEINER (1988a, 7 f.) unterscheidet drei Modelle von Praxisforschung: ein Konzept ohne Partizipation der Praktiker an der Forschungstätigkeit, einen zweiten Typus mit teilweiser Einbeziehung von betroffenen Fachkräften (z. B. wissenschaftliche Begleitforschung) sowie ein drittes Modell mit gleichberechtigter Mitwirkung der Praktiker am Forschungsprozess. Unabhängig von einer etwaigen Generalisierbarkeit dieses Gliederungsbeispiels kann festgestellt werden, dass keine der genannten Typen von Praxisforschung auf die Mitwirkung eines Vertreters der Sozialwissenschaft verzichtet. Dies ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal gegenüber der Selbstevaluation, bei welcher der Praktiker „zum ,Forscher‘ in eigener Sache“ (HEINER 1988b, 7) werden kann. Praxisforschung soll zwischen den Ebenen von Praxis und Wissenschaft eine Verbindung herstellen, und wäre gegenstandslos, wenn eines dieser Systeme fehlte.
Eine andere Betrachtungsweise schildert KODITEK (1997, 51). Da sozialpädagogische Evaluation „professionelle Standards in der sozialen Arbeit begründen und weiterentwickeln“ (ebd.) soll, wird sie hier nicht nur als Ergänzung, sondern auch als Bestandteil von Praxisforschung ausgewiesen. FILSINGER/HINTE (1988, 51 f.) beschreiben Praxisforschung als anwendungsbezogene, die Arbeit der Praktiker begleitende Forschungstätigkeit. Hier ordnen sie Evaluationsforschung als eine „klassische Form von Praxisforschung“ (ebd.) ein. Auch MOSER (1998, 18 ff.) weist darauf hin, dass Evaluationsforschung (neben Praxisuntersuchungen und der Aktionsforschung) einer der drei Forschungsansätze innerhalb der Praxisforschung ist. „Sie (Evaluationsstudien, d. Verf.) unterscheiden sich von den anderen Formen dadurch, daß sie direkt auf das Praxissystem bezogen sind und dort stattfindendes Handeln überprüfen“ (ebd., 21). Mithilfe der Evaluationsforschung soll – ähnlich wie bei der Selbstevaluation – sozialarbeiterisches Handeln einer Messung und Bewertung unterzogen werden. FILSINGER/HINTE (ebd.) räumen zwar in diesem Kontext die zu erwartende geringere Objektivität von Bewertungsergebnissen bei der Selbstevaluation ein, betonen aber, dass die Vielzahl subjektiver Betrachtungen für beide Bereiche von Bedeutung ist. Wenn die Evaluationsforschung in diesem Sinnzusammenhang vorwiegend die Gewinnung von Feedbacks zum Ziel hat, um „Entwicklungsprozesse zu steuern, Handlungsprozesse zu modifizieren und professionelles Handeln zu optimieren“ (ebd.), dann gleicht sie zumindest aus diesem Blickwinkel dem Ansatz der Selbstevaluation.
Die damit verbundene Frage, ob Selbstevaluation nicht auch als Form oder als Bestandteil von Praxisforschung angesehen werden kann, macht eine erneute Rückschau auf das Verständnis von Selbstevaluation und Evaluationsforschung erforderlich: Evaluationsforschung impliziert ausdrücklich die Anwendung von wissenschaftlichen Forschungsmethoden. Wie oben bereits ausgeführt (vgl. 2.1.1), ist das kein explizites Merkmal von sozialpädagogischer Evaluation im weiteren Sinne, sondern vielmehr ein für sie erhobener Anspruch (MITTAG/HAGER 1998, Uni Köln 2000, Univation e.V. 2001). Im Unterschied zur alltäglichen Selbstreflexion soll auch Selbstevaluation systematisch und datenbasiert erfolgen – daraus ableitend ließe sich eine enge Verwandtschaft zur Praxisforschung interpretieren. Dennoch existieren mehrere Unterscheidungskriterien, die eine Abgrenzung herstellen. Sozialwissenschaftliche Praxisforschung ist auch auf die Untersuchung der Ursachen sozialarbeiterischen Handelns ausgerichtet (soziale Probleme, Benachteiligungen, etc.), Selbstevaluation in erster Linie jedoch auf die Tätigkeit der Fachkräfte und Anbieter sozialer Arbeit. Im Rahmen sozialwissenschaftlicher Forschungstätigkeit sollen Zusammenhänge in der Praxis erkannt bzw. untersucht werden, wovon hier im Gegensatz zur Selbstevaluation vornehmlich die wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung und Theoriebildung profitieren. Das Einfließen von gewonnenen Erkenntnissen in die Gestaltung der sozialarbeiterischen Praxis erfolgt in der Regel nur mittelbar und ist unter anderem abhängig von der Einbeziehung von Praktikern in den Forschungsprozess. Während die Selbstevaluation handlungsbezogene Erkenntnisse liefern und sich gegebenenfalls auf künftige Hilfeprozesse auswirken soll, ist die Praxisforschung gekennzeichnet von der Absicht, verallgemeinerbare Aussagen formulieren zu können. Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass Selbstevaluation nicht bedenkenlos als Form von Praxisforschung gesehen werden kann. Es bestehen dennoch sehr zahlreiche Anknüpfungspunkte, die beide Konzepte einander ergänzen lassen. Insbesondere im Hinblick auf die Verknüpfung der Systeme von Theorie und Praxis der sozialen Arbeit leisten beide einen maßgeblichen Beitrag.
2.4 Der Standort des Methodenbegriffs
Wenngleich das Wort „Methode“ im Alltagsgebrauch ohne weiteres mit „Vorgehensweise“ oder „Praktik“ synonymisiert werden kann, gibt es innerhalb des sozialwissenschaftlichen Diskurses nur wenige andere Begriffe, die mit so unterschiedlichen und zum Teil nicht eindeutig abgrenzbaren Bedeutungen verbunden werden. Angesprochen werden u. a. die Perspektiven der klassischen/primären Methoden sozialer Arbeit (Soziale Einzelfallhilfe, Soziale Gruppenarbeit, Gemeinwesenarbeit), das gegenwärtig aktuelle Methodenspektrum (Multiperspektivische Fallarbeit, Case-Management, Non-direktive Gesprächsführung, Erlebnispädagogik etc.), zugleich aber auch die Ebene der Handlungsweisen innerhalb von Konzepten und Methoden, z. B. in unserem Kontext „Selbstevaluations-Methoden“. Folgt man der Auslegung von GEISSLER/HEGE (1999, 22 ff.), so sind mit Methoden Teilaspekte von Konzepten gemeint: Während unter Konzept ein „Handlungsmodell, in welchem die Ziele, die Inhalte, die Methoden und die Verfahren in einen sinnhaften Zusammenhang gebracht sind“ (ebd., 23) zu verstehen ist, ist die Methode hier eine zielgerichtete, fachlich und theoretisch begründbare und geplante Vorgehensweise, die bezogen auf wissenschaftliche Forschung erkenntnis- und in der sozialpädagogischen Praxis handlungsleitend ist.
Neben der Gliederung in primäre und sekundäre Methoden (Beratung, Supervision etc.) der sozialen Arbeit schlägt GALUSKE (1999, 151) die Klassifizierung in klientenbezogene und professionsbezogene Konzepte und Methoden vor. Erstere beziehen sich vornehmlich auf die Interaktion zwischen Helfern und Klienten. Letztere berühren die Klienten und die Intervention nur indirekt, vielmehr richten sie sich an die Helfer bzw. an das Hilfesystem (z. B. Jugendamt). In diesem Zusammenhang benennt GALUSKE (ebd., 253, 261) neben der Supervision auch die Selbstevaluation als professionsbezogene Methode sozialer Arbeit. Vergleicht man das Verständnis von Selbstevaluation mit dem von der Methode, dann werden die Kriterien anerkannter Methoden zumindest durch die Ansprüche von Selbstevaluation durchaus erfüllt: Reflexivität, theoretische Fundierung, Systematik und Zielgerichtetheit, Nachvollziehbarkeit und Prüfbarkeit, um nur einige zu nennen. Selbstevaluation könnte in diesem Rahmen als professionsbezogene Methode sozialer Arbeit verstanden werden. Dennoch lassen ihre Merkmale und Settings keine ausgeprägte Trennschärfe zum Verständnis als „Arbeitsfeld“ oder gar als „sozialpädagogisches Konzept“ im Sinne eines komplexeren Handlungsmodells zu. Der Betrachtung von Selbstevaluation als Methode sozialer Arbeit sollte daher kritisch gegenüber gestanden werden.
Wenn von Methoden der Selbstevaluation gesprochen wird, ist die begründete Vorgehensweise gemeint, mit welcher das Vorhaben vollzogen wird. Sie sind Bestandteil des Evaluationsverfahrens, welches oben (2.1.2) bereits als „zentrales Element“ beschrieben wurde. Ihren Ursprung haben (Selbst-) Evaluationsmethoden in der Regel in der qualitativen und quantitativen empirischen Sozialforschung. Bei der systematischen Reflexion eigenen professionellen Handelns liegt die Nutzung qualitativer Methoden (Fallstudien, Text-/Aktenanalyse, Interviews etc.) sehr nahe. Eine Ursache hierfür ist, dass sich soziale Prozesse kaum standardisieren lassen, unterscheidet sich doch stets ein Fall vom anderen. Verbunden mit individuellen und qualitativ ausgerichteten Aktivitäten der Selbstevaluation sind allerdings Mängel in der Objektivität der Untersuchung sowie in der Validität ihrer Ergebnisse zu befürchten. Zudem kann eine „Reduktion der sozialen Wirklichkeit“ (HEINER 1987, 82 ff.), die für das Strukturieren und Verstehen sozialer Prozesse, sowie für den Erkenntnisgewinn notwendig ist, eher nicht stattfinden. Eine hinreichende Reduktion von Komplexität kann von der Umsetzung quantitativer Erhebungsmethoden (standardisierte Befragungen, Stichprobenerhebungen etc.) erwartet werden. Sie jedoch spiegeln die Individualität von Einzelfällen bzw. sozialarbeiterischer (Interventions-/Hilfe-) Prozesse in nur ungenügendem Maße wider.
Zugeschnitten auf den Ansatz der Selbstevaluation und die Praxis der sozialen Arbeit stellte von SPIEGEL folgendes Methodenset zusammen:
1. Journal
2. Auswertung des dokumentierten Materials
3. Analyse der Teamprotokolle
4. Erhebung von Erfolgskriterien und Zielen
5. Einschätzung zur Realisierung der Arbeitsprinzipien
6. Dokumentation der Handlungsregeln
7. Analyse der tatsächlichen Handlungen
8. Zeitbudget-Analyse
9. Lautes Denken – Zwiegespräch mit dem Diktiergerät
10. Situationsporträt
11. Arbeit mit Schätzskalen
12. Bestandsaufnahme der Ausstattungsdefizite und -benefite (Kompetenzatlas)
13. Netzwerkanalyse
14. Kartographische Evaluation (Aktionsradien)
15. Rollenspiel
16. Projektive Verfahren
17. Gutachterliche Einschätzung unabhängiger Expertinnen
18. Zeitleiste
(von SPIEGEL 1998b, 305-322).
Von SPIEGELs Auflistung erhebt weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch darauf, universelle Methodensystematik zu sein. Sie macht aber deutlich, dass für selbstevaluative Aktivitäten innerhalb der sozialen Arbeit zahlreiche und sehr differenzierte Methoden zum Einsatz kommen können. Weitere Methoden und systematische Herangehensweisen finden sich in den von HEINER veröffentlichten Fallbeispielen (1987, 1988b, 1994, 1998a). In von SPIEGELs Methodenkatalog wird der wesentliche Vorzug von Selbstevaluation sichtbar, dass notwendige Daten und Informationen nicht generell erst erhoben werden müssen. Vielfach sind sie bereits vorhanden, bedürfen lediglich einer entsprechenden Aufbereitung oder lassen sich bereits bei der Nutzung von Anamnese- bzw. Interventions-Instrumenten gewinnen. Wählt der Sozialarbeiter beispielsweise die „Analyse der Teamprotokolle“ als Evaluationsmethode, so kann er auf früher erstellte, vorhandene Instrumente, nämlich Teamprotokolle, zurückgreifen. Auch MÜLLER (1997, 133) argumentiert, dass Evaluation (Selbstevaluation, d. Verf.)[3] leichter wird, „wenn man dafür verfügbare und einfach zu handhabende Instrumente (und Methoden, d. Verf.)[4] der Dokumentation und Praxisforschung nutzt“. MOSER (1999, 58 f.) spricht in diesem Kontext von zwei Möglichkeiten der Datengewinnung („Spurensicherung“): Bei der „Spurensuche“ werden schon vorhandene Daten bzw. Instrumente, z. B. Berichte, Protokolle, Statistiken, nutzbar gemacht. „Spurenlegung“ bedeutet, noch nicht vorliegende Daten/Informationen einzuholen, z. B. mit Stimmungsbarometern oder Soziogrammen. Unter anderem im Rahmen des bei von SPIEGEL (1998b, 305-322) benannten Rollenspiels, durch Netzwerk- und Zeitbudgetanalysen ergeben sich „Spuren, die aktiv ,gelegt‘ werden“ (MOSER 1999, 58) müssen.
3 Selbstevaluation als Bestandteil sozialpädagogischer Fallarbeit
3.1 Die Phasierung des Hilfeprozesses
Eine Möglichkeit, die häufig sehr komplexen und schlecht überschaubaren Handlungssituationen der sozialen Arbeit übersichtlich und für die Bearbeitung verständlich abzubilden, wird durch abstrahierende Aufgliederungen und Strukturierungen geschaffen. GALUSKE (1999, 73) zufolge ist es ein „Verdienst der Sozialen Einzelfallhilfe“, dass die wohl häufigste Phasierung von Hilfeprozessen die Abfolge von Anamnese, Diagnose und Intervention ist. In der ersten Phase des „Dreischritts“, der Anamnese, geht es um die wertungsfreie Erkundung der Vorgeschichte des Klienten, in der sozialarbeiterischen Beratung wird zu diesem Zeitpunkt der „Beratungsvertrag“ geschlossen. Die Anamnese bedeutet, ähnlich wie im medizinischen Bereich, Fakten und Informationen zu sammeln, die für eine Hilfeleistung relevant sein können. Deren Interpretation erfolgt allerdings noch nicht. GALUSKE bezeichnet die Diagnose als „eine Art zusammenfassende und verdichtende Deutung der gesammelten Befunde“ (ebd.). Das (tatsächliche) Problem des Ratsuchenden/ Hilfsbedürftigen, mögliche Ursachen, der Hilfebedarf, Lösungswege, aber auch Gegenanzeigen, werden im Rahmen dieses Handlungsschrittes herausgearbeitet. Wesentlich dabei ist unter anderem die Suche nach vorhandenen internen und externen Ressourcen für den Berater und den Klienten. Die Ausführung konkreter Hilfeangebote, vergleichbar mit der „Behandlung“ in der Medizin, erfolgt in der dritten Phase des Hilfeprozesses, der Intervention. Gemeinsam mit dem Klienten und ggf. anderen Beteiligten/Fachkräften wird die während der Diagnose erarbeitete Lösungsstrategie verwirklicht. Unter Umständen wird erst jetzt die Notwendigkeit von veränderten Zielstellungen deutlich. Im Idealfall ist der Klient zum Ende dieser Phase derart gestärkt und in seinen Kompetenzen so weit aufgebaut, dass sich sein Hilfebedarf verringert und zunehmend schwindet.
Der beschriebene „Dreischritt des Hilfeprozesses“ wurde von MÜLLER (1997, 126 ff.) um die Phase der (Selbst-) Evaluation ergänzt, um die systematische Reflexion im Fallgeschehen fest zu verankern. Im ungegenständlichen Verlaufsschema wird dem Helfer in der letzten Phase angezeigt, sich von dem Klienten abzulösen. Der strukturierte, gemeinsame Rückblick auf den Hilfeprozess, die Analyse von Schwachpunkten, Erfolgen und Misserfolgen sowie der Vergleich des Ist-Standes mit den vorherigen Zielsetzungen sind Gegenstände der Evaluationsphase. Nach der Analyse (Anamnese), Planung (Diagnose) und Durchführung (Intervention) würde also die Auswertung der Maßnahme als Aufgabe der Evaluation erfolgen. Eine solche Phasierung des Hilfeprozesses ist jedoch kein allgemein gültiges Handlungsschema für die Bearbeitung eines sozialpädagogischen Falles. Sie dient lediglich dem besseren Verständnis der komplexen Zusammenhänge. Die Reihenfolge der einzelnen Phasen kann im beruflichen Alltag nicht so, wie es hier abstrakt geschildert wurde, eingehalten werden. Außerdem ist es der Fachkraft kaum möglich, festzustellen, in welcher Phase sie sich gerade befindet. Die Trennung der Phasen ist daher nur als abstrahierendes Schema zu sehen und nicht ohne weiteres auf den Ablauf alltäglicher Vorgänge übertragbar. In fast jedem Gespräch lassen sich Elemente aller vier Handlungsschritte ausmachen. Nicht selten findet beispielsweise eine Intervention vor der eigentlichen Anamnese statt, man denke hier an Inobhutnahmen von Kindern durch das Jugendamt oder an Kriseninterventionen bei Suizidversuchen. Burkhard MÜLLER (1997, 87) weist darauf hin, dass die Anamnese niemals vollständig sein kann und immer wieder neu stattfindet, da ständig neue Aspekte eine Rolle im Fallgeschehen spielen. Auch während der Intervention werden die vorliegenden Fakten und Informationen permanent in neue Zusammenhänge gebracht und somit unterschiedlich bewertet. Soll Selbstevaluation ihren praxisbezogenen Anspruch erfüllen und formativ wirken, wäre es falsch, sich mit derartigen Vorhaben erst zum Abschluss der Fallarbeit zu beschäftigen. Sie sollten ständig stattfinden. Dennoch ist es MÜLLER gelungen, die Gleichwertigkeit von (Selbst-) Evaluation gegenüber den drei klassischen Schritten festzustellen und zu betonen. Aus diesem Blickwinkel muss (Selbst-) Evaluation als Bestandteil sozialpädagogischer Fallarbeit verstanden werden.
3.2 Verpflichtung zur Selbstevaluation?
Es „gehört (...) zu den vornehmsten Pflichten einer Profession (...), daß ihre Angehörigen sich selbst bzw. gegenseitig kontrollieren und somit ihre professionellen Standards überwachen“ (von SPIEGEL 1993, 124)[5].
Die angesprochene Selbstkontrolle gewinnt für die Fachkräfte sozialer Arbeit zunehmend an Bedeutung und Verbindlichkeit. Die Hintergründe dafür lassen sich aus verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Soziale Arbeit ist zum großen Teil Element oder Ausdruck staatlich organisierter Wohlfahrtspflege und damit Instrument von sozialer Absicherung. Die innerhalb dieses Rahmens erforderlichen Eingriffe sowie Formen der Einflussnahme auf die Lebenssituation Einzelner bzw. auf soziale und gesellschaftliche Prozesse sollen verantwortbar, begründbar und nachvollziehbar sein. Und dies nicht nur im Hinblick auf formelles und politisches Handeln, sondern auch in fachlicher Hinsicht bei der Umsetzung in der sozialen Praxis. Klienten erwarten von professionellen Dienstleistungen, wie z. B. der Arbeit eines Steuerberaters, Rechtsanwaltes oder Arztes, höchstmögliche Kompetenz des Vertreters der Berufsgruppe/Profession sowie eine maximale Qualität der Arbeit. Obwohl Maßnahmen sozialer Arbeit nicht ohne weiteres mit den vorgenannten Arbeitsbereichen vergleichbar sind, sollten auch sie, gleich ob in Form von Angeboten oder unfreiwilligen Eingriffen, den Ansprüchen klientenorientierter Dienstleistungen genügen. Hiernach ist zumindest die Qualität sozialarbeiterischen Handelns unverzichtbar, weshalb es adäquater Verfahren bedarf, diese Qualität zu stabilisieren und ständig weiterzuentwickeln. Dabei rückt Selbstevaluation neben Weiterbildungen und anderen Qualifizierungstraditionen wie Organisationsberatung, Supervision und Evaluation (von SPIEGEL 1993, 14 ff.) zunehmend ins Blickfeld.
Für die soziale Arbeit ergibt sich zusätzlich eine hohe Verantwortung, weil durch sie Lebensumstände und Lebensläufe beeinflusst werden, die teilweise für die Betroffenen sogar Konsequenzen auf existenzieller Ebene haben (Krisenintervention, Hilfen zur Erziehung, etc.). Hinzu kommt eine Verantwortung über den angemessenen Einsatz geeigneter und ausreichender Kräfte und Mittel im beruflichen Alltag. Gerade vor dem Hintergrund knapper werdender öffentlicher Mittel erscheint die Verpflichtung zur effizienten Ressourcenausnutzung evident[6].
Berufsethische Standards und Prinzipien geben der sozialen Arbeit wertebezogene Leitlinien, aber auch die Möglichkeiten des Vergleichs mit ihnen und der (Selbst-) Kontrolle. Auch aus ihrem Blickwinkel werden die im Zusammenhang mit selbstevaluativen Bestrebungen stehende kritische Reflexivität der sozialen Arbeit und ihrer Fachkräfte sowie die Identifizierung der Praktikerrolle im Hilfeprozess thematisiert und zur Forderung gemacht. Das Erkennen beruflicher und persönlicher Grenzen, die Förderung des Einsatzes breiten beruflichen Wissens sowie die Anwendung angemessener Methoden in der Entwicklung und Absicherung des Wissens gehören zu den allgemeinen Standards ethischen Verhaltens, welche von der International Federation of Social Workers (IFSW) formuliert worden sind (DBSH, 8). Zusätzlich wird gefordert, Rechenschaft abzulegen, und zwar „gegenüber KlientInnen und der Gesellschaft in Form von Tätigkeitsberichten, die die Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der professionellen Dienstleistung“ (ebd., 10) aufzeigen. Außerdem werden „konstruktive Kritik am Beruf sowie seinen Theorien, Methoden und Arbeitsweisen“ sowie die Förderung neuer „Arbeitsweisen und Methoden“ (ebd., 11) zu Standards der sozialen Arbeit erhoben. Die berufsethischen Prinzipien des Deutschen Berufsverbandes für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Heilpädagogik e.V. (DBSH) verlangen ebenfalls implizit nach selbstevaluativen Aktivitäten: „Die Mitglieder des DBSH dokumentieren die in Ausübung ihres Berufes gewonnenen Erkenntnisse und getroffenen Maßnahmen. Dies dient der Planung und Reflexion des Arbeitsprozesses. (...) Darüber hinaus sind sie zu Innovation und Forschung bereit“ (ebd., 14).
Eine allgemein gültige und verbindliche gesetzliche Verpflichtung zur Selbstevaluation existiert in Deutschland nicht. Es ist trotzdem in einigen Arbeitsfeldern möglich, ihre Notwendigkeit aus dem geltenden Recht abzuleiten. Dies soll hier am Beispiel des Kinder- und Jugendhilferechts geschehen.
Die oben (3.1) ausgeführte Phasierung des Hilfeprozesses wird bei Burkhard MÜLLER (1997, 61 ff.) mit einem Hilfeplanverfahren nach § 36 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) in Verbindung gebracht: „Als Grundlage für die Ausgestaltung der Hilfe sollen sie (die Fachkräfte, d. Verf.) zusammen mit dem Personensorgeberechtigten und dem Kind oder dem Jugendlichen einen Hilfeplan aufstellen, der Feststellungen über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie die notwendigen Leistungen enthält; sie (die Fachkräfte, d. Verf.) sollen regelmäßig prüfen, ob die gewählte Hilfeart weiterhin geeignet und notwendig ist“ (§ 36 Abs. 2 Satz 2 KJHG). Die Klärung des erzieherischen Bedarfs vergleicht MÜLLER (ebd.) mit einer Anamnese, die Entscheidung über die Notwendigkeit und Eignung einer Hilfeart mit einer Diagnose sowie die notwendige Leistung mit einer Intervention. Evaluation[7] findet hier in der Form statt, dass regelmäßig eine Prüfung stattfindet. Diese gesetzlich vorgeschriebene wiederkehrende Prüfung erfolgt spätestens zum Ende des Hilfeplanzeitraums unter Mitwirkung aller Betroffenen und am Fall Beteiligten. Im Ergebnis einer solchen „Evaluation“ erfolgt dann eine Hilfeplanfortschreibung – wenn weiterhin das Erfordernis einer Hilfe nach den §§ 27 bis 35a KJHG angezeigt ist (vgl. auch unten, 5.4.2). Der Gesetzestext macht die „regelmäßige Prüfung“ zwar zur Pflicht des Jugendamtes bzw. des (Allgemeinen) Sozialen Dienstes in der Verwaltung, schreibt aber keine selbstevaluativen Maßnahmen vor. Ob in der Praxis halbjährliche Hilfeplangespräche stattfinden, oder ob die benannte „Prüfung“ laufend geschieht, vielleicht sogar bewusst als Form von Selbstevaluation, wird dem Aufgabenträger überlassen. MÜLLER (ebd.) beabsichtigt vordergründig, das von ihm um die Evaluation erweiterte Phasierungsmodell anhand des Hilfeplanverfahrens zu veranschaulichen, doch er interpretiert § 36 KJHG auch als gesetzliche Grundlage, in welcher die (Selbst-) Evaluation als Pflichtaufgabe des Jugendamtes verankert ist.
Auf eine Verknüpfung zwischen Recht und Evaluation im weiteren Sinne macht BEYWL (Uni Köln 2000) aufmerksam, indem er auf § 80 KJHG (Jugendhilfeplanung) verweist. Darin verpflichtet das Gesetz die Träger der öffentlichen Jugendhilfe (z. B. Landkreise) dazu, „den Bedarf (an Einrichtungen, Diensten und Vorhaben, d. Verf.) unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln“ (§ 80 Abs. 1 Pkt. 2). Damit enthält Jugendhilfeplanung, zumindest im Bereich der Bedarfsanalyse, Elemente von Evaluation. Paragraf 78b KJHG kann so verstanden werden, dass er ebenfalls auf die Umsetzung von Selbstevaluation abzielt. Hier ist geregelt, dass als Grundlage für die Engeltübernahme für erbrachte Leistungen neben der Leistungs- und der Entgeltvereinbarung zwischen der öffentlichen Jugendhilfe und dem Leistungsträger auch eine Qualitätsvereinbarung abgeschlossen werden muss. In dieser müssen u. a. geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung der Leistungsqualität vereinbart werden.
Zu diesen Maßnahmen werden neben der Qualitätssicherung bzw. in deren Rahmen auch selbstevaluative Ansätze gezählt (Uni Köln 2000). Rechtsverbindlichkeit für eine Selbstevaluation in der Praxis ergibt sich jedoch auch hier nicht. Es muss festgehalten werden, dass unter den beschriebenen rechtlichen Aspekten nicht erkennbar ist, dass selbstevaluative Vorgänge explizit vorgeschrieben sind. Sie können aber mittelbar als Bestandteil von gesetzlich normierten Aufgabenstellungen begriffen werden.
3.3 Dimensionen sozialpädagogischer Handlungskompetenz
Der doppelte Auftrag der Selbstevaluation, zum einen Erkenntnisse über die praktische Umsetzung sozialer Arbeit zu vermitteln und zum anderen die Praxis sozialer Arbeit positiv zu verändern, ist oben (2.2.2) bereits angesprochen worden. Ausgehend davon, dass vor allem die Fachkräfte selbst in Vorhaben der Selbstevaluation eingebunden sind, werden deren professionelle Kompetenzen verbessert. Dies geschieht sowohl durch die Ergebnisse der Evaluation als auch schon durch den Evaluationsprozess überhaupt.
Professionelle Kompetenz bedeutet in diesem Sinne weder das Innehaben von Vollmachten oder Befugnissen, noch das Ausüben bestimmter Funktionen innerhalb der Rollenverteilung und Hierarchie in sozialen Organisationen. Vielmehr richtet sich der Begriff an die Fähigkeiten des Praktikers und die Art und Weise, mit welcher er seinen Beruf ausübt. Im sozialwissenschaftlichen Diskurs existieren unterschiedliche Ansichten darüber, welche Merkmale ein Sozialarbeiter aufweisen muss, um als kompetent zu gelten, und was sozialarbeiterische Kompetenz eigentlich ausmacht. KREFT (1996, 271 f.) beschreibt drei für die Berufstätigkeit besonders zentrale Kompetenzprofile: Erstens benennt er die fachliche Kompetenz, welche das Zurückgreifen auf fachbezogenes Wissen sowie dessen Anwendung im Arbeitsalltag gestattet, und je nach Arbeitsfeld verschiedenartig spezialisiert ausgeprägt ist. Zweiter Profilbereich ist die kommunikative Kompetenz als Fähigkeit und Bereitschaft zum kommunikativen Austausch mit Klienten, Angehörigen der eigenen Organisation und anderen Fachkollegen bzw. Beteiligten.
Drittens verweist KREFT auf die administrative Kompetenz, welche die Fähigkeit zur Umsetzung sozialarbeiterischer Zielstellungen und Inhalte bei gegebenen Rahmenbedingungen und strukturellen Voraussetzungen möglich macht. Das von GEISSLER/HEGE (1999, 227 ff.) formulierte Modell sozialarbeiterischer Handlungskompetenz sieht eine Zergliederung in instrumentelle, reflexive und soziale Kompetenz vor. Die Autoren meinen mit instrumenteller Kompetenz, bei KNÜPPEL/ WILHELM (1987, 273 ff.) im Wesentlichen durch theoretische und methodische Kompetenz ersetzt, „die Beherrschung von Fähigkeiten und Fertigkeiten bis hin zu Verhaltensroutinen und die Verfügbarkeit von Fachwissen“ (GEISSLER/HEGE 1999, 227 ff.). Betont wird in diesem Kontext, dass Methoden und Verfahren nicht nur bekannt sein sollen, sondern vor allem auch in der Praxis erprobt und kontrolliert trainiert werden müssen. Deshalb ist festzuhalten, dass Selbstevaluation einerseits Methoden-Bewusstsein bzw. Methoden-Anwendung vorantreibt. Andererseits kann sie eingesetzt werden, wenn es um das „kontrollierte“ Training von Verfahren und Methoden geht. Kontrolle ist hier nicht als Zensur durch Vorgesetzte oder als Folge fachlicher Unselbstständigkeit zu interpretieren, sondern im Sinne von systematischer Reflexion, z. B. als Selbstkontrolle. Die Fähigkeit zur Selbstevaluation kann damit gleichzeitig Element von instrumenteller Kompetenz sein, schließlich erfordert auch dieser Ansatz methodische Kenntnisse und Fähigkeiten. Dabei ergibt sich folgende Wechselwirkung: Instrumentelle Kompetenz erhöht das Potenzial an selbstevaluativen Fähigkeiten, und umgekehrt dient Selbstevaluation der Weiterentwicklung instrumenteller Kompetenz.
„ Reflexive Kompetenz “ beziehen GEISSLER/HEGE (ebd.) eher nicht auf die prüfende Rückschau auf sozialarbeiterische Hilfeprozesse. Eine Fachkraft besitzt in dem hier verwandten Sinne vielmehr dann reflexive Kompetenz, wenn sie in der Lage ist, den Einfluss der eigenen lebensgeschichtlichen Erfahrungen auf die berufliche bzw. fallbezogene Tätigkeit zu hinterfragen. Selbstevaluation und reflexive Kompetenz stehen trotzdem in einem (indirekten) Zusammenhang: Je höher die Bereitschaft ist, seine eigene Person zu reflektieren, und sei es ausschließlich im Hinblick auf Helferrolle und Berufsidentität, desto wahrscheinlicher sind die Veränderungsbereitschaft und die Motivation des Sozialarbeiters, die tägliche Arbeit zu evaluieren. In der entgegengesetzten Perspektive kann die reflexive Kompetenz erweitert werden, je intensiver ein selbstkritisches Hinterfragen, z. B. in Gestalt von Selbstevaluation, eingeübt und praktiziert wird.
Da sie sich zum größeren Teil auf die Persönlichkeit, die Biografie und das Befinden des Helfers richtet, bedeutet reflexive Kompetenz nicht bereits die Fähigkeit zur Selbstevaluation. Es ergeben sich für sie deutlichere Schnittstellen zur Supervision als zur Selbstevaluation.
Eine Fachkraft verfügt dann über soziale Kompetenz, wenn sie dazu fähig ist, Empathie aufzubringen, trotzdem aber auch eine ausreichende Rollendistanz zu wahren (ebd.). Die soziale Kompetenz bezieht sich also zunächst auf die Form des Umgangs mit der Klientel, auf die Wechselbeziehung zwischen Helfer und Klienten. GEISSLER/HEGE ordnen diesem Kompetenzprofil eine weitere Komponente zu, welche von FRÜCHTEL (1995, 64) als strukturelle Kompetenz bezeichnet wird: „Die Reflexion der eigenen sozialpädagogischen Praxis als Bestandteil gesellschaftlicher Strukturen und gesellschaftlicher Prozesse (z. B. der gesellschaftlich etablierten Formen von Arbeitsteilung)“ (GEISSLER/ HEGE 1999, 234). Hier befindet sich ein sehr wesentlicher Anknüpfungspunkt für die Selbstevaluation. Denn deren erklärte Zielstellung ist, solche Reflexionen über praxisrelevante Zusammenhänge systematisch und methodengeleitet zu gestalten, um die Wirkungen sozialer Praxis einer Wertung unterziehen zu können. Daraus ableitend lässt sich argumentieren, dass soziale und strukturelle/administrative Kompetenzen als Voraussetzungen bzw. als Bestandteile selbstevaluativer Bestrebungen verstanden werden können.
Die benannten Komponenten sozialarbeiterischer Handlungskompetenz stehen obigen Aussagen zufolge in direkter bzw. mittelbarer Wechselwirkung zur Selbstevaluation. Das gilt insbesondere für individuelle Selbstevaluation und für Untersuchungen auf der Mikroebene, z. B. als Teamselbstevaluation. Ausdruck von professioneller Handlungskompetenz ist demnach auch die Anwendung selbstevaluativer Verfahren, gleichzeitig sind diese für die Entwicklung bzw. Festigung von Handlungskompetenz förderlich.
4 Möglichkeiten der Umsetzung von Selbstevaluations-Vorhaben
4.1 Ablauf und individuelle Charaktergestalt
Noch differenzierter als ihre Einsatzgebiete gestalten sich die denkbaren Varianten und in der einschlägigen Fachliteratur (HEINER 1988b, 1994, 1996, von SPIEGEL 1998b, KÖNIG 2000) angeführten Verfahren von Selbstevaluation. Die Form ihrer Umsetzung bestimmt sich zunächst nach dem Evaluator und nach der Ebene, auf welche sich das Vorhaben richtet. Wie bereits angeführt, ist es das Wesensmerkmal von Selbstevaluation, dass Fachkräfte ihr eigenes professionelles Handeln sowie dessen Auswirkungen untersuchen und bewerten. Im Zentrum des Interesses können die Ebenen der Organisation oder Institution, die des Organisationsausschnittes, z. B. die des Teams bei der Teamselbstevaluation, aber auch – bei der individuellen Selbstevaluation – die Ebene der einzelnen Fachkraft (vgl. 2.2.1) stehen. Abhängig davon, wo eine Evaluation stattfindet (Arbeitsfeld), wer mit ihr betraut ist (einzelne Personen oder mehrere Fachkräfte) und je nach der zu untersuchenden Organisationsebene machen sich also verschiedene Verfahren, Methoden und Techniken erforderlich. Die Betrachtung anwendbarer Methoden allein dient jedoch nicht dem hinreichend tiefgründigen Vergleich von selbstevaluativen Aktivitäten. Das oben (2.4) zitierte „Methodenset“ Hiltrud von SPIEGELs impliziert schließlich nicht, dass lediglich 18 Verfahren für die systematische und methodengeleitete Praxisreflexion in Frage kommen. Bei LIEBALD (1998, 14), MOSER (1999, 15) sowie KÖNIG (2000, 56 ff.) werden allgemein gültige Empfehlungen für die Planung und den Ablauf von Selbstevaluations-Vorhaben in strukturierten Arbeitsschritten formuliert. Die Modelle eignen sich gleichsam für eine ggf. nachträgliche Analyse und den Vergleich von Evaluationsprozessen. Nachfolgend soll KÖNIGs (2000, 57) m. E. besonders praxisrelevantes Schema dargestellt und kommentiert werden.
1. Arbeitsschritt: Ziele festlegen.
Begründungsfrage: Warum soll eine Selbstevaluation durchgeführt werden?
Im ersten Arbeitsschritt werden die Ziele festgelegt, welche mit der Evaluation verfolgt werden sollen. Nach KÖNIG (ebd., 58 ff.) lassen sie sich aus den fünf Hauptnutzen (Kontrolle, Aufklärung, Qualifizierung, Innovation, Legitimation; vgl. 2.2.2) ableiten. LIEBALD (1998, 29) schlägt im Rahmen der Zielklärung vor, alle denkbaren Ziele zu sammeln, um die „wichtigsten oder dringlichsten“[8] anschließend in eine/mehrere endgültige Zielformulierung(en) einfließen zu lassen. Eine in Frageform gebrachte Zielstellung für eine Selbstevaluation im Bereich der Jugendberufshilfe könnte lauten: Werden die Bedürfnisse der lernbeeinträchtigten Jugendlichen in unseren Stützunterricht-Kursen ausreichend berücksichtigt?
2. Arbeitsschritt: Rahmenbedingungen klären.
Bedingungsfrage: Wann, unter welchen Bedingungen kann ich evaluieren?
Rahmenbedingungen beziehen sich zum einen auf materiell-institutionelle Ressourcen. Dazu zählen die Nutzbarkeit von Geräten und Räumlichkeiten sowie die Schaffung finanzieller und personeller (z. B. arbeitszeitbezogener) Freiräume. HEINER (1987, 82 ff.) verweist zum anderen auf kollegiale Akzeptanz. Auch sie gehört, verbunden mit der Freiwilligkeit aller am Vorhaben Beteiligten und einer gewissen Veränderungsbereitschaft der Fachkräfte zu den notwendigen Voraussetzungen einer Selbstevaluation. Nützlich sind zudem Formen der Begleitung von außen, z. B. durch Evaluationsberatung oder Einbeziehung eines Sozialwissenschaftlers. Die vorhandenen Rahmenbedingungen sind bereits in der Planungsphase abzuklären bzw. herzustellen.
3. Arbeitsschritt: Gegenstand bestimmen.
Gegenstandsfrage: Was will ich evaluieren?
Bei der Formulierung des Untersuchungsgegenstandes geht es um die möglichst genaue und eingegrenzte Bestimmung dessen, was evaluiert werden soll. In dieser Phase wird eine/werden mehrere konkrete und von allen Beteiligten getragene(n) Fragestellung(en) erarbeitet, auf die sich die Selbstevaluation ausrichten soll. Beispiel: Ist die Methodik und Didaktik des Stützunterrichtes zielgruppengerecht?
4. Arbeitsschritt: Gegenstand operationalisieren.
Indikatorenfrage: Was genau will ich evaluieren?
Da selbst kleine Ausschnitte sozialarbeiterischer Praxis dem Problem der kaum möglichen Messbarkeit unterliegen, müssen in diesem Schritt Indikatoren entwickelt werden, mit denen Aussagen über den Evaluationsgegenstand getroffen werden können. An o. g. Beispiel des Stützunterrichtes anknüpfend, könnte als einer von mehreren Indikatoren die Anzahl der Teilnehmer in den Benachteiligten-Kursen in Frage kommen, oder auch, ob das Angebot in kleinen Gruppen stattfindet. Nach KÖNIG (2000, 76) ist die Operationalisierung die Zergliederung des Gegenstandes der (Selbst-) Evaluation in messbare Indikatoren. LIEBALD (1998, 49) folgend beschreibt sie jedoch auch schon die „konkrete Form, wie der Indikator (...) gemessen werden kann (...) zum Beispiel in Form einer Frage für einen (später zu entwickelnden, d. Verf.) Fragebogen“.
5. Arbeitsschritt: Bewertungskriterien entwickeln.
Kriterienfrage: Woraufhin, vor welchem Hintergrund will ich evaluieren?
Im Mittelpunkt steht hier die Entwicklung der Maßstäbe, mithilfe derer die zuvor festgelegten Indikatoren beurteilt werden können. Es geht also um die Möglichkeit des Vergleichs der Messergebnisse mit (Arbeits-) Zielen, Standards und anerkannten Werten, die z. B. aus gesetzlichen Vorgaben, dem Leitbild der Organisation oder aus der Leistungsvereinbarung/dem Leistungsangebot hervorgehen. Ebenso wenig zu vernachlässigen sind selbst bzw. im Team formulierte Zielstellungen und die Wünsche sowie Bedürfnisse der Klienten. Kriterium für zielgruppengerechten Stützunterricht in der Benachteiligtenförderung ist beispielsweise die Arbeit in Kleingruppen, die u. U. auch mit einer maximalen Teilnehmerzahl definiert werden kann.
6. Arbeitsschritt: Informationsquelle auswählen.
Stichprobenfrage: Wen will ich evaluieren? (Wer liefert geeignete Daten?)
Als Informationsquellen können die eigene Person, Kollegen, Klienten und andere Beteiligte geeignet sein. Von Bedeutung sind außerdem möglicherweise vorhandene Instrumente zur Dokumentation der sozialpädagogischen Tätigkeit. Daten zur Bewertung der Zielgruppenorientierung des Stützunterrichtes hinsichtlich der operationalisierten Gruppengröße (obiges Beispiel) könnte man sowohl von den Kursteilnehmern und Stützlehrern, aber auch mithilfe der vorhandenen Anwesenheits-/Teilnahmenachweise gewinnen.
Die Entscheidung über Informationsquellen sollte nach Gesichtspunkten der Ergiebigkeit (Effektivität), aber auch des Aufwand-Nutzen-Verhältnisses (Effizienz) erfolgen.
7. Arbeitsschritt: Methoden entwickeln.
Methodenfrage: Wie will ich evaluieren?
Methoden zur Selbstevaluation müssen nicht generell neu entwickelt werden, sondern lassen sich in der Regel aus den Bereichen der empirischen Sozialforschung bzw. Praxisforschung (vgl. oben, 2.4) schöpfen und den jeweiligen Erfordernissen entsprechend anpassen. Gerade bei der Selbstevaluation im sozialen Bereich, welche für Kritik in Bezug auf die Glaubwürdigkeit und Validität ihrer Ergebnisse empfindlich ist, sollte erwogen werden, ob im Wege der Triangulation (MOSER 1998, 28 f.) verschiedene Methoden/Instrumente (z. B. durch Klientenfragebögen und Leitfaden-Interviews), oder aber verschiedene Informationsquellen (z. B. durch die Befragung von Klienten und von Fachkräften) zur multiperspektivischen Beleuchtung des Untersuchungsgegenstandes angewendet werden sollten.
8. Arbeitsschritt: Daten erheben und auswerten.
Durchführungsfrage: Wie kann ich evaluieren?
Die Datenerhebung erfolgt entsprechend des Methodenplans und möglichst nach einem Pretest. Für die Auswertung werden jeweilige quantitative (z. B. Datenmatrix) bzw. qualitative Verfahren (z. B. Inhaltsanalyse) angewandt.
9. Arbeitsschritt: Qualität der Ergebnisse beurteilen.
Qualitätsfrage: Wie gut kann ich evaluieren?
Eine prüfende Rückschau auf das Evaluationsvorhaben ist Inhalt dieses Arbeitsschrittes. KÖNIG (2000, 115 ff.) hebt die Kriterien der Angemessenheit der angewandten Methoden, der Realisierbarkeit des Vorhabens (hier auf die Planungsphase abzielend), der Regelgeleitetheit der Vorgehensweise, der Gültigkeit der Erkenntnisse sowie der Verwertbarkeit der Ergebnisse für die (künftige) Praxis besonders hervor.
10. Arbeitsschritt: Ergebnisse verwerten.
Verwertungsfrage: Wozu will ich evaluieren?
Die Verwertung der Ergebnisse beschränkt sich nicht auf die Erstellung eines Abschlussberichtes, der einer ausgewählten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. In erster Linie geht es m. E. um die Auswertung der gewonnenen Erkenntnisse gegenüber sich selbst bzw. dem Team. Die Option der möglichen Praxisveränderung sollte dabei ins Auge gefasst werden.
Die Berücksichtigung der mit diesem Schema strukturierten Gesichtspunkte ist einem jeden (Selbst-) Evaluator unbedingt anzuraten. Einerseits kann auf diese Weise der notwendigen Systematisierung und Regelgeleitetheit des Untersuchungs-/Bewertungsprozesses entsprochen werden – was unumgänglich ist, wenn von Selbstevaluation im engeren Sinne die Rede ist. Andererseits wird dem Vorhaben die für die an Planung, Durchführung und Auswertung beteiligten Personen vorteilhafte Transparenz verliehen. Die empfohlene Orientierung an KÖNIGs Modell bedeutet allerdings nicht, dass die aufgezählten Schritte in ihrer dargestellten Form und Reihenfolge zwanghaft kongruent abgearbeitet werden müssen, um einen Evaluationserfolg zu erzielen. Soziale Arbeit trägt keinen statischen Charakter, weshalb z. B. mit Veränderungen von Rahmenbedingungen und Gegenstandsbestimmungen der Untersuchung zu rechnen ist. Es besteht generell eine Wahrscheinlichkeit, dass sich erst während der Durchführung herausstellt, einen geplanten Evaluationsgegenstand (z. B. die Nutzerfreundlichkeit einer Einrichtung) noch stärker eingrenzen bzw. operationalisieren zu müssen (z. B. zur Nutzerfreundlichkeit einer Einrichtung, in Bezug auf junge Mütter und anhand von Indikatoren wie Häufigkeit der Besuche und Telefongespräche). Ebenso wird u. U. erst während der Datenerhebung sichtbar, dass Erhebungsmethoden bzw. -techniken einer Korrektur oder Ergänzung bedürfen, z. B. durch zusätzliche telefonische Befragungen.
Es ist evident, dass die angeführten Planungs-/Arbeitsschritte in den verschiedenen Settings sozialarbeiterischer Praxis jeweils auch unterschiedlich behandelt werden müssen, und dass die Beantwortung der an diese Schritte gebundenen Fragestellungen keine identischen Ergebnisse zulässt. Die logische Folge ist, dass Verfahren der Selbstevaluation nicht ohne weiteres von einem Schauplatz sozialer Arbeit auf den nächsten übertragen werden können. Darauf begründet sich das Erfordernis, aber auch der Anspruch von Selbstevaluation, individuell ausgerichtet und auf die vielfältigen Ziele, Anforderungen und Bedingungen ihrer Anwendungsorte zugeschnitten zu sein.
Nachfolgend werden einige einfache und weniger komplexe Verfahren der Selbstevaluation, die veröffentlichten Erfahrungsberichten entstammen, beispielhaft angeführt.
4.2 Verfahren auf der Ebene des Teams
4.2.1 Strukturierte Verlaufsnotizen
Als Form der fallbezogenen Selbstevaluation werden von HÖING (1988, 140 ff.) „strukturierte Verlaufsnotizen“ beschrieben. Wollte man dieses Verfahren in das Methodenset Hiltrud von SPIEGELs einordnen, so könnte man es mit einem „Journal“ oder mit der „Auswertung strukturierten Materials“ (siehe 2.4) vergleichen. Die Evaluation fand in der Gruppenarbeit in einer Psychotherapie-Station eines Zentralkrankenhauses statt. Die Ziele bzw. die den Gegenstand beschreibenden Fragestellungen des Vorhabens näherten sich den Perspektiven Aufklärung, Erfolgskontrolle und Innovation an:
„[1] Welche der therapeutischen Interventionen waren hilfreich?
[2] Wie weit haben sich die Überlegungen über den psychodynamischen Konflikt bestätigt?
[3] Welche alternativen Interventionen wären möglich?“ (HÖING 1988, 141).
Trotz des Ansatzes der Gruppenarbeit sollten mit Hilfe der Selbstevaluation die Auswirkungen der eigenen sozialpädagogischen bzw. therapeutischen Tätigkeit auf die einzelnen Patienten untersucht und bewertet werden. Aufwändige Rahmenbedingungen brauchten nicht abgesichert zu werden, es genügten ein kollegialer Konsens sowie die Verfügbarkeit eines geringen Anteils der täglichen Arbeitszeit. Die wie bei KÖNIG (2000, 72 ff.) vorgeschlagene Bildung von Indikatoren und Kriterien benennt HÖING (1988, 140 ff.) zumindest nicht explizit. Der Autor macht aber auf die im Team vereinbarten Zielstellungen für den Beispielfall des „Patienten A.“ aufmerksam, womit also Wertmaßstäbe in Form von Zielstellungen vorlagen.
„Das Team kam zu dem Ergebnis, die therapeutischen Bemühungen darauf zu richten,
(a) die positiven Selbstrepräsentanzen aufzugreifen (...);
(b) Rückzugstendenzen anzusprechen und dabei andere Kontaktmöglichkeiten aufzuzeigen;
(c) ärgerliche Impulse Frauen gegenüber in der Gruppe aufzugreifen und eine Auseinandersetzung damit einzuleiten“ (ebd., 144).
Da auf der Station bis dato ohnehin ein Tagebuch geführt wurde, entschloss man sich, dieses Dokumentationsinstrument durch eine Strukturierung weiterzuentwickeln, um es für eine Selbstevaluation tauglich zu machen. Es entstand ein Erhebungsbogen in Form einer 3-spaltigen Tabelle, in welcher Aussagen zu folgenden Bereichen notiert werden konnten:
- Verhalten und Erleben des Klienten innerhalb der Gruppe,
- Verhalten des Klienten außerhalb der Klinik und
- Hypothesen, Interventionen der Therapeuten (vgl. ebd.).
Die untenstehende Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus den zum Fall des Herrn A. geführten Strukturierten Verlaufsnotizen. Die Eintragung der Notizen erfolgte jeweils unmittelbar nach den Gruppensitzungen. Mit der Trennung des beobachtbaren Verhaltens des Klienten von der Intervention bzw. der Interpretation der Fachkraft wurde das Ziel verfolgt, die Auswirkungen des therapeutischen Handelns zu erforschen und mögliche Konsequenzen in Bezug auf alternative Interventionsmöglichkeiten zu ziehen. Auf das Klientenverhalten folgende situative Interpretationsmuster des Therapeuten sollten erkannt und hinterfragt werden können. Bei der Auswertung der angefertigten Notizen (Datenauswertung) konnte im vorliegenden Fallbeispiel u. a. festgestellt werden, dass die positiven Selbstrepräsentanzen des Klienten zu selten aufgegriffen wurden. An dieser Stelle wurde also das Nicht-Erreichen einer Zielvorgabe konstatiert. Wäre dies bereits während des Hilfeprozesses deutlich geworden, hätte man das Helferverhalten eher korrigieren können (Praxisveränderung, Innovation). Im Hinblick auf die Entwicklung des Patienten während des Hilfeprozesses wurde dennoch deutlich, dass sich beim Klienten sehr positive Verhaltensänderungen einstellten. HÖING bilanziert, „dass die regressive Haltung des Patienten zurückgegangen und er aktiver geworden ist“ (ebd., 150).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Eine kritische Beurteilung der Selbstevaluation (neunter Arbeitsschritt bei KÖNIG 2000, 113 ff.) hat HÖING nicht ausgelassen: Er bemerkt, dass bei der Anwendung der entwickelten Untersuchungsmethode die emotionale Einbindung des Therapeuten nicht dokumentiert wurde, obwohl Interventionen von den Empfindungen des Helfers wesentlich charakterisiert bzw. beeinflusst werden. Die Ergebnisse der Selbstevaluation wurden insofern verwertet (zehnter Schritt bei KÖNIG, ebd.), als dass sie, wie die Auswertung der Verlaufsnotizen auch, im Team vorgestellt und diskutiert wurden. Das Verfahren zeichnet sich durch eine Prozesshaftigkeit aus, da es parallel zum Hilfeprozess verläuft, und zu jedem Zeitpunkt eine Auswertung in Form einer Zwischenbilanz erfolgen kann. Damit hat es einen formativen Wert, denn noch während des Fallgeschehens wirken sich die gewonnenen Erkenntnisse auf die Hilfeleistung aus.
4.2.2 Evaluation von Teamsitzungen mithilfe von Schätzskalen
Ein nicht auf den einzelnen Fall, sondern auf die fallübergreifende Arbeit im Team gerichtetes Verfahren ist die Evaluation von Teamsitzungen, vorgestellt von WENZEL (1994, 211 ff.) am Beispiel eines Stadtteilprojektes. Zielstellung des Vorhabens war die Steigerung der Kooperation und Vernetzung der einzelnen Mitarbeiter untereinander.
Gegenstand der Untersuchung wurde das Klima während der regelmäßigen Teamsitzungen, wobei sich an diesem Beispiel seine Operationalisierung sehr gut veranschaulichen lässt. Ein exemplarischer Indikator wird durch die im späteren Fragebogen (Abb. 2) formulierte Frage gebildet: „3. War das Klima im allgemeinen so, daß ich meine Themen einbringen konnte?“ (ebd., 214). Zur näheren Bestimmung erfolgte die Zergliederung in die zwei weiteren Fragen: „3.1. War es dabei locker/ruhig/angespannt/hektisch?“ und „3.2 Fühlte ich mich akzeptiert?“ (ebd.). Als Kriterium könnte hier der wünschenswerte Zustand gegenübergestellt werden, beispielsweise eine im Allgemeinen sehr positiv zu bewertende Sitzungsatmosphäre, die sehr locker und ruhig ist, und in welcher sich die Fachkraft akzeptiert fühlt. Die Daten/Informationen zur Bewertung des Klimas stammen von den Mitarbeitern selbst. Als Erhebungsmethode wurde eine standardisierte Befragung mit quantifizierbaren Schätzskalen festgelegt. Der entwickelte Fragebogen (Abb. 2) konnte von den einzelnen Mitarbeitern nach jeder Teamsitzung ausgefüllt werden und nahm einen im Verhältnis zur Arbeitszeit sehr geringen Aufwand in Anspruch. Mit der Ermittlung der jeweiligen Mittel- und Modalwerte[9] der Eintragungen der einzelnen Mitarbeiter und des Teams im Ganzen geschah zunächst die Auswertung der Erhebung, welche anschließend grafisch abgebildet werden konnte.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In die Gestaltung der weiteren Arbeit flossen danach die Ergebnisse einer auf dieser Auswertung beruhenden Diskussion zwischen den Kollegen. WENZEL (ebd., 219 f.) berichtet, dass bereits das individuelle Ausfüllen des Fragebogens fruchtbringende Feedback-Prozesse anstoßen konnte, innerhalb derer beispielsweise vorliegende Stimmungstiefs einzelner Mitarbeiter klärend aufgegriffen wurden. Schon die Tatsache, dass ein gemeinsamer Konsens in dem Wunsch nach mehr Kooperation bestand, und dass sich alle Beteiligten in die praktische Umsetzung der Maßnahme einbanden, erzeugte WENZEL (ebd., 222) zufolge ein von allen getragenes Bedürfnis des „Zusammenrückens“.
4.3 Verfahren auf der Ebene der einzelnen Fachkraft
4.3.1 Netzwerkanalyse
Eine sehr gut in den Prozess der sozialpädagogischen Fallarbeit integrierbare Form von Selbstevaluation ist das Verfahren der Netzwerkanalyse (HEINER 1987, 82 f. und von SPIEGEL 1998, 317). Sie erleichtert die Reflexion von zwischenmenschlichen Bindungen und Beziehungen, die für den Klienten, den Helfer oder/und den Hilfeprozess von zentraler Bedeutung sind. Ziele des Vorhabens sind auch hier Aufklärung und Erfolgskontrolle, da aufgezeigt werden soll, wie intensiv bestehende Beziehungen als Einflussfaktoren für den Hilfeprozess berücksichtigt worden sind. Andererseits werden Elemente von Qualifizierung sowie Innovation angesprochen, weil auf Verbesserungen bei der Verknüpfung bzw. Erschließung von Problemlösungs-Ressourcen abgezielt wird. Evaluationskriterium ist die zuverlässige Einbindung des Klienten in das betrachtete Netzwerk.
Die Netzwerkanalyse beginnt mit der grafisch-abstrakten Darstellung der Ansprechpartner und (eher externen) Ressourcen des Klienten in Form eines Sterns oder eines Spinnennetzes. Bei der Spinnennetz-Variante beispielsweise kann der Klient als Netzknoten in den Mittelpunkt der Grafik gezeichnet werden, und um ihn herum satellitenartig, in unterschiedlichen Entfernungen, seine Ansprechpartner aus dem privaten und/oder institutionellen Umfeld. Die Beziehungen zu (ggf. auch zwischen) den von den Netzknoten verkörperten Personen und Institutionen lassen sich durch die Linienart der Netzfäden veranschaulichen. Ähnlich wie im Fallbeispiel (Abb. 3) können zerrissene Linien für sehr lose, unzuverlässige Beziehungen stehen, doppelte oder sehr fette hingegen für enge, dauerhafte oder zuverlässige Bindungen. Die Variante in der nachfolgenden Abbildung bezieht sich auf ein Fallbeispiel (HESSE 1998, 15 ff.) aus dem Vormundschaftswesen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grafisch dargestellt sind hier zunächst nur die Beziehungen von Helfer (Amtsvormund) und der Klientin (Katrin Bauer[10], Mündel), die subjektiv als besonders wichtig eingestuft worden sind. Eine zweite Vormundschaft, welche für Katrins Tochter geführt wurde, ist hier nicht berücksichtigt worden. Die Beziehungen zwischen Dritten, z. B. das konfliktreiche Verhältnis des Vaters zur Vormundschaftsrichterin, wurden ebenfalls nicht erfasst. Es ist abzuwägen, ob sie auf Grund ihrer Bedeutung für das Fallgeschehen in die Grafik aufgenommen oder der Übersicht halber weggelassen werden sollten. Ebenso möglich ist die ausschließliche Darstellung des persönlichen (natürlichen) oder des institutionellen Netzwerks um den Klienten. An diesem Punkt ergibt sich ein relativ großer Spielraum für zahllose Varianten der Methode. Ähnlich kann die Wahl der Linienarten beliebig erfolgen. Für die Netzwerkanalyse sprechen außerdem der geringe Aufwand, die Eignung auch als Anamnese- und Diagnoseinstrument, vor allem aber die Tatsache, dass der Klient sehr gut einbezogen werden kann. Skizzen zur Netzwerkanalyse können regelmäßig, prozessbegleitend erfolgen und auf diese Weise miteinander verglichen werden.
In der Skizze wurde u. a. die zum Zeitpunkt ihrer Erstellung besonders enge Bindung des Mündels Katrin zu ihrem Vater deutlich, gleichzeitig aber auch das offensichtlich unbefriedigende Verhältnis zwischen Herrn Bauer und dem Amtsvormund. Die Kontakte des Amtsvormundes zu weiteren institutionellen Ansprechpartnern, z. B. zur Richterin und den Kollegen im Amt wurden hingegen eher positiv eingeschätzt. Solche Aussagen hätten bereits Gegenstand einer Auswertung (Ergebnisverwertung) sein können, um die Auswirkungen der Beziehungen auf den Hilfeprozess (ggf. gemeinsam mit der Klientin) zu erörtern und daraus Vorschläge für positive Veränderungen zu entwickeln. In diesem Kontext wirkt sich auch die Netzwerkanalyse formativ, also bereits während der Fallarbeit auf deren weitere Gestaltung aus.
4.3.2 Zielsetzungsprotokollierung
Ein Aspekt von Selbstevaluation kann sein, vereinbarte Zielstellungen regelmäßig mit dem erreichten Ist-Zustand zu vergleichen, um daraus entsprechende Schlussfolgerungen für die Schwerpunkte und die Ausrichtung der weiteren Arbeit abzuleiten. In einer wenig komplexen und gut nachvollziehbaren Form geschieht das bei KÄHLER (1988, 152 ff.) mithilfe von Zielsetzungsprotokollen. Als zentrales Erhebungsinstrument dient ein mehrspaltiger Protokollbogen (Abb. 4), in dessen erste Hauptspalte die mit dem Klienten erarbeiteten Ziele des Hilfeprozesses (Indikatoren) untereinander in der Folge ihrer Vorrangigkeit eingetragen werden. In der zweiten Hauptspalte, bestehend aus einer durchgängigen Schätzskala, wird die zum Zeitpunkt der Ausgangslage (z. B. vom Klienten oder vom Helfer) subjektiv eingeschätzte Entfernung vom angestrebten Ziel (Kriterium) veranschaulicht. Wird hier die „1“ angekreuzt, befindet sich der Klient sehr weit weg vom Ziel, das Ankreuzen der „5“ bedeutet, nahe am gewünschten Ziel zu sein. Mit der dritten Hauptspalte, ebenfalls eine Schätzskala, wird die gleiche Erhebung zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt, das heißt, es wird wieder eingetragen, in welchem Abstand der Klient zum gesetzten Ziel steht. Dieser Vorgang kann in regelmäßigen Abständen wiederholt und mit dem Klienten besprochen werden. Die Abbildung 4 zeigt, wie ein solcher Protokollierungsbogen ausgefüllt aussehen könnte. Es wird Bezug genommen auf ein Fallbeispiel, in welchem die Entwicklung des Jungen Jens Schleusinger[11], der sich seit dem 1. April 1997 in einer Heimeinrichtung befand, betrachtet wurde. Die Eintragungen hätten beispielsweise von der Bezugserzieherin des Jungen im Rahmen einer von ihr durchgeführten Selbstevaluation vorgenommen werden können. In der Abbildung sind sie abgeleitet aus einem Hilfeplangespräch vom 10. Juni 1998 (HESSE 1998, III.I.). Das Beispiel zeigt die positive Entwicklung, aber auch einen weiterhin bestehenden Hilfebedarf des Jungen im Hinblick auf die festgehaltenen Zielstellungen. Eine Auswertung der Zielsetzungsprotokolle kann vom Sozialarbeiter problemlos anhand von Tabellen oder Diagrammen anschaulich gemacht und einer anschließenden Auseinandersetzung und Reflexion zu Grunde gelegt werden. Gleichzeitig hilft die wiederholte Vergegenwärtigung der mit den Protokollbögen übersichtlich erfassten Arbeitsziele und individuellen Entwicklungswerte dem Sozialarbeiter bei der Vorbereitung von Beratungsgesprächen. Das Interesse, also das Evaluationsziel, welches mit diesem einfachen, gut in die sozialarbeiterische Praxis integrierbaren Verfahren verfolgt wird, ist zunächst eines der Selbstkontrolle. Möglichkeiten für die Perspektiven der Aufklärung, Qualifizierung und Innovation ergeben sich erst mit der Reflexion der ermittelten Einschätzung. Diese Reflexion kann durch den Sozialarbeiter selbst, sollte m. E. aber gemeinsam mit dem Klienten und im fachlichen Austausch mit anderen Fachkräften erfolgen.
Trotz überzeugender Vorzüge des Verfahrens der Zielsetzungsprotokollierung, nämlich, wenig aufwändig zu sein und individuell auf einzelne Fälle zugeschnitten werden zu können, sollte stets eine (selbst-) kritische Distanz zu dieser Evaluationsmethode gewahrt werden. Gründe dafür liegen nicht nur in der Dokumentierung sehr subjektiver Bewertungen, sondern auch in der Tatsache, dass die Entwicklungsziele, welche hier erfasst werden sollen, nicht in jedem Fall beständig sind, sondern in ihrer Art, Wichtigkeit und Dringlichkeit erfahrungsgemäß variieren. Es besteht immer die Möglichkeit, dass sich die persönlichen Umstände, Konflikte, Ressourcen und Wahrnehmungen des Klienten verändern und deshalb Ziele ergänzt, modifiziert oder weggelassen werden müssen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Gewichtung einzelner Arbeitsziele würde die Ermittlung von Gesamtpunktzahlen für die jeweilige Erhebung gestatten, aus welchen eine Einschätzung über die Klientenentwicklung (stets nur bezogen auf die Indikatoren in Form von Arbeitszielen) abgeleitet werden könnte. Die Gesamtpunktzahl könnte dabei durch der Summe der zielbezogenen Produkte aus den Gewichtungsfaktoren und den eingetragenen Schätzwerten gebildet werden. Dies würde allerdings einen Mehraufwand für die Selbstevaluation bedeuten. Außerdem wäre bei einer Änderung von Zielen bzw. Zielgewichtungen ein Vergleich von Entwicklungsstationen anhand der Gesamtpunktzahlen nicht mehr möglich.
Ginge man davon aus, dass sich die Gewichtung der Arbeitsziele und damit die Bewertungsfaktoren nicht änderten, erschiene als kleinster Skalenwert die „0“ sinnvoller als die „1“, da so die kleinste ermittelbare Punktzahl nicht von Indikator zu Indikator (Arbeitsziele) verschieden, sondern stets „0“ wäre. KÄHLER (1988, 154) berichtet, dass er aus Gründen des Aufwandes auf eine matrixartige Gesamtwert-Ermittlung verzichtete. Doch auch ohne diese wird die Klientenentwicklung mit Hilfe der Protokollierung von Zielsetzungen in der Art veranschaulicht, dass bei entsprechender Auswertung, z. B. durch Klientengespräche, von Selbstevaluation die Rede sein kann.
5 Zur Anwendung in der sozialen Praxis
Im vorangegangenen Teil der Arbeit wurden das Wesen der Selbstevaluation sowie die Umsetzbarkeit ihrer Verfahren fast ausschließlich aus der theoretischen Perspektive sowie in Anlehnung an die angeführte einschlägige Fachliteratur erörtert. Geht es um die Anwendung selbstevaluativer Verfahren in der Praxis, erscheint jedoch die Einbeziehung der Sichtweise von Praktikern nicht nur sinnvoll, sondern unumgänglich. Zu diesem Zweck wurden sieben Leitfadeninterviews mit Fachkräften der Jugendhilfe in Nordthüringen durchgeführt (vgl. Interviewleitfaden im Anhang). Die Gesprächspartner (vgl. Auflistung im Anhang) waren vier Praktikerinnen (SA 1, SA 2, SA 3, SA 7) sowie drei männliche Berufskollegen (SA 4, SA 5, SA 6). Alle befragten Personen wirken in den Arbeitsfeldern der Hilfen zur Erziehung, der Familiengerichtshilfe oder/und der Jugendgerichtshilfe, eine Person außerdem in der Jugendberufshilfe. Zwei von ihnen arbeiten in Einrichtungen in freier Trägerschaft, die restlichen fünf in drei verschiedenen Nordthüringer Jugendämtern. Vor der Befragung war den Personen lediglich das Thema der vorliegenden Arbeit bekannt. Zielstellung der Interviews war weder die Ableitung von Bewertungen von Organisationen, Einrichtungen oder einzelnen Fachkräften, noch die Erbringung des Nachweises, ob Selbstevaluation in der Praxis stattfindet oder nicht. Die Gesamtheit der gewonnenen Informationen brauchte deshalb zu keinem Zeitpunkt Ansprüchen der Repräsentativität zu genügen. Aufgaben der Befragung waren vornehmlich:
- die Erkundung des Umgangs mit (Praxis-) Reflexion im beruflichen Alltag,
- die Erhebung von Informationen darüber, in welcher Form Aktivitäten, die sich einer Selbstevaluation annähern, ihr gleichen, sie ergänzen oder eine Alternative zu ihr bilden, stattfinden – oder aus dem Blickwinkel der Befragten vorstellbar sind – sowie
- die Ermittlung von Fachkräfteaussagen über die Vorstellung vom Begriff sowie von möglichen Verfahren der Selbstevaluation.
5.1 Formen der Reflexion und Dokumentation sozialarbeiterischen Handelns
Die wohl häufigste Form der reflexiven Auseinandersetzung mit der eigenen Tätigkeit ist die unsystematische Reflexion, welche ständig und oft unbemerkt geschieht und das tägliche Handeln beeinflusst. Auch nach von SPIEGEL (1993, 143 f.) erfolgt sie in der Regel situativ, und sie findet dabei ihren Anstoß in besonderen Gefühlslagen. Eine im Rahmen der Leitfadeninterviews befragte Sozialpädagogin bemerkte, „das Gespräch mit meiner Kollegin, das ist natürlich auch eine Reflexion“ (SA 1), eine andere betonte ebenfalls „das tägliche Gespräch“ (SA 2) und nannte es in einer Aufzählung der ihr bekannten Reflexionsformen zuerst. „Maßgeblicher (als die Teamberatungen, d. Verf.) ist für mich vielleicht, ja, mit einzelnen Sozialarbeitern das Gespräch zu suchen, täglich“ (SA 3), schätzte die dritte Interviewpartnerin, Sozialarbeiterin in einem Jugendamt, ein. Ihr Kollege bestätigte dies wenig später und fasste treffend zusammen: „Eigentlich geht’s ja, sag ich mal so, beim Frühstück los (...), dass wir hier über bestimmte Sachen einfach sprechen, die uns irgendwie auf der Seele brennen oder einfach beschäftigen. (...) Und auch in den ganzen Gesprächen, die man so auf dem Flur führt, oder geht in ein anderes Zimmer (...). Da reflektieren wir eigentlich alle“ (SA 4). Fast schockierend wirkte die bedauernde Antwort in einem anderen Jugendamt. Da dort aus Kostengründen keine Supervision möglich ist und Fortbildungen zu selten stattfinden, „müssen wir auf die Selbstheilungskräfte der Mitarbeiter in den Teams vertrauen“ (SA 6). Auf die Frage nach den Möglichkeiten einer Praxisreflexion antwortete der Leiter des aufgesuchten Kinderheimes: „Die Tür zum Heimleiterbüro wird nicht nur einmal am Tag geöffnet, wenn ich drin sitze. (...) Das ist auch ‘ne Form einer nicht standardisierten Reflexion“ (SA 5). Interessant ist seine Einschätzung, dass die individuelle Rückschau sowie die Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle im Hilfe- oder Erziehungsprozess durch die Schaffung von Distanz gefördert werden kann. Eine solche Perspektivenveränderung bzw. -erweiterung wäre beispielsweise durch den Einsatz in verschiedenen Arbeitsbereichen möglich (ebd.).
Den Befragten wesentlich bewusster als die zunächst erwähnten Formen von alltäglicher Reflexion sind die überall installierten Gremien der Team- oder Dienstberatungen, in denen z. B. Fallbesprechungen Platz finden:
„Wir haben einmal in der Woche (...) Teamberatung zur Diskussion aktueller Probleme und Fallberatung“ (SA 1). „Also wir haben ja jeden, jede Woche Dienstberatung“ (SA 2). „Ansonsten, wie gesagt, unsere Teamgespräche“ (SA 3). „Müssen uns dann im Prinzip den Fragen dieses Gremiums von fünf Leuten stellen“ (SA 4). „Es gibt diese Möglichkeiten in verschiedenen Stufen, in der Gruppenberatung, die regelmäßig stattfindet (...), in Leitungssitzungen (...). Wir haben Dienstberatungen (...), und es finden einzelne Gespräche statt (SA 5). „Teamberatungen“ (SA 6). „So was (Praxisreflexion, d. Verf.) passiert meistens, wenn wir im Team zusammen sind“ (SA 7).
Aus den Gesprächsausschnitten ableitend ist festzuhalten, dass mit der Reflexion der eigenen Praxis auch die für das Team angesetzten regelmäßigen Beratungen verbunden werden. Der kollegiale Austausch zu den Hilfeprozessen, in welche man selbst involviert ist, hat daher recht hohen Stellenwert. Hält man sich jedoch vor Augen, dass die Rückschau auf den Hilfeprozess einerseits und andererseits das anlassbezogene Bedürfnis, Vorschläge für Strategien in unübersichtlichen oder scheinbar unlösbaren Situationen zu erhalten, auch empfindliche Punkte der eigenen Persönlichkeit betreffen können, wird evident, dass in der Praxis jene Gespräche größere Bedeutung haben, welche nicht in institutionell installierten Settings geschehen. Gemeint sind die „Fallbesprechungen“, die zwar jenseits vom „Kaffeeklatsch“, doch aber in geschützter Atmosphäre mit ausgewählten, vertrauten Gegenübern stattfinden. Eine Sozialarbeiterin äußerte dazu, „zumal es ja so ist, dass ich mir für dieses lockere, oder individuelle Gespräch Partner suche, mit denen ich von vornherein glaube, dass ich dieses Thema, dieses Problem bearbeiten kann. Und vielleicht auch ein bisschen tiefer reinkomme, als wenn ich dieses vorgesetzte Team habe“ (SA 3).
Einige der Interviewpartner richteten das Augenmerk auch auf individuelle Möglichkeiten: „Es gibt ja wirklich auch Fälle, (...) die einen auch zu Hause dann noch beschäftigen“ (SA 4). „Im Jugendamt die Kollegen, die suchen auch mal eine Beratungsstelle auf, für sich alleine, gehen hin und beraten dann mit der Psychologin ihre Probleme“ (SA 7). Eine Sozialpädagogin berichtete sogar, „dass man sich da schon auch mal irgendwie hinsetzt und Gedanken macht. (...) Also es ist manchmal ganz hilfreich, wenn man irgendwie an ‘nem Punkt ist, wo man nicht weiter weiß, dass man ein paar Stichpunkte macht (...), dass man (...) Ressourcen (...) um denjenigen aufstellt (...).
Wenn man schreibt, hat man ja dann doch andere Bilder vor Augen“ (SA 2). Individuelle Reflexion beginnt auch hier bereits damit, sich gelegentlich Gedanken über die Arbeit zu machen, wenngleich man sich stets einer hinreichenden professionellen Distanz vergewissern sollte. Zum Stift zu greifen und seine Gedanken festzuhalten, verhilft natürlich eher noch dazu, einen anderen Blickwinkel auf das Fallgeschehen einnehmen zu können. Außerdem eröffnen sich dadurch Möglichkeiten für ein methodisches Vorgehen, wie beispielsweise in Form der o. g. nachträglichen Ressourcenanalyse.
Burkhard MÜLLER (1997, 133) ist zuzustimmen, wenn er sagt, dass Evaluation erleichtert wird durch die Verwendung verfügbarer und einfach zu handhabender Instrumente der Dokumentation. Das gilt in diesem Kontext genauso für die Selbstevaluation. Deshalb liegt es nahe, dass angewandte Dokumentationsverfahren gleichsam zur Einbeziehung in die Reflexion sozialarbeiterischen Handelns geeignet sein können. In der Praxis wird mit sehr unterschiedlichen Verfahren und Instrumenten dokumentiert. In allen Einrichtungen, in denen die Leitfadeninterviews vorgenommen wurden, ist es üblich, Akten zu führen. „Fallakten. Jaja. Ja, na klar“ (SA 1), „es muss in jedem einzelnen Fall, wo ‘ne Hilfe geleistet wird, eine Akte geführt werden“ (SA 3), „ja, wir haben unsere Akten, Fallakten“ (SA 4), „wir haben in der Heimleitung eine zentrale Akte (...). Es gibt des Weiteren eine Handakte, die jeder Betreuer hat“ (SA 5) und: „Meinen Sie jetzt Aktenführung und solche Dinge?“ (SA 7), antworteten die Gesprächspartner auf die Frage nach praktizierten Dokumentationsformen. Darüber hinaus und nahezu bei allen Befragten spielten Aktenvermerke, Gesprächsvermerke, aber auch Hilfe- bzw. Förderpläne eine wesentliche Rolle für die Dokumentation beruflichen Handelns und der Entwicklung der Klienten. Ferner wurden Protokolle benannt, aber auch Statistiken, z. B. Krankenstatistiken (SA 1), Jugendgerichtshilfe-Statistiken und Statistiken über gewährte Hilfen zur Erziehung (SA 2). In der Heimeinrichtung führt man sogar für jeden Einzelnen „ein Tagebuch (...) zu besonderen Ereignissen“, welches derzeit neu strukturiert wird (SA 5). Dort „ist (es) auch so, dass (...) jeder Jugendliche durch seine Bezugserzieherin ein Fotoalbum geführt bekommt“ (ebd.).
Nur ein Gesprächspartner machte ohne Nachfrage auf das Problem der Dokumentation aufmerksam, „dass man zum einen (...) nicht genug Informationen haben kann (...), und zum anderen (...) nicht in den Informationen ertrinken sollte, aber auch gesetzliche Grenzen hat, auch ethische“ (SA 5). Ein Nutzen von Dokumentationsverfahren für die tägliche Arbeit wird hingegen auch von den anderen Personen beschrieben. „Ich denke mir mal, man reflektiert sich täglich selbst, wenn man zum Beispiel seinen Aktenvermerk schreibt oder so, und dann überlegt“ (SA 2). Demnach würde schon die Tätigkeit des Dokumentierens zu einer Auseinandersetzung mit dem verhelfen, was zu dokumentieren ist. Dennoch hat das Erfordernis der Dokumentation, insbesondere mittels Aktenführung, einen überwiegend anderen Hintergrund, nämlich den der Nachweisführung und Legitimation. Zum Beispiel des freien Trägers gegenüber seinen Geldgebern (Jugendämter, Bundesanstalt für Arbeit, etc.), aber auch gegenüber den direkt oder mittelbar Betroffenen (Klienten, Eltern, etc.). Für die öffentlichen Träger der Jugendhilfe, in diesem Kontext die Jugendämter, ergibt sich ein großer Legitimationsdruck innerhalb der Organisation, z. B. auf Fachkräfte durch Vorgesetzte. Die Führungskräfte wiederum haben den Einsatz öffentlicher Mittel und die Qualität der Aufgabenerfüllung nach außen zu verantworten, z. B. gegenüber der Öffentlichkeit und der Politik. Ein Interviewpartner äußerte Betroffenheit, aber auch kollegiale Solidarität, während er davon berichtete, dass wenige Tage zuvor im Zuständigkeitsbereich einer Amtskollegin im Südthüringer Raum eine Mutter ihr Kleinkind verhungern ließ. Er war sich sicher, dass dort im Zuge der Ermittlungen auch das zuständige Jugendamt in Bezug auf Kenntnis und Tätigwerden befragt werden würde (SA 6).
Das „Festhalten (...) von Fakten, (...) um (etwas) nachzuweisen, wenn wirklich etwas passiert, passieren sollte“ (SA 7), ist den Praktikern in seinem Stellenwert zumindest sehr bewusst, auch wenn die tägliche Arbeit kaum von wie oben geschilderten dramatischen und im Zentrum öffentlichen Interesses stehenden Kriminalfällen bestimmt wird. Neben den Funktionen der Akte als Beweismittel und als Instrument zur Sicherung der kontinuierlichen Sachbearbeitung bei Mitarbeiterwechsel (LUKAS 1996, 26 f.) dient sie außerdem, wie andere Dokumentationsmittel auch, der Handlungsplanung, der Selbstkontrolle und der Reflexion beruflichen Handelns: „Das (Dokumentieren, d. Verf.) nutzt man natürlich auch, um zu überprüfen, was man gemacht hat in seiner Arbeit, die ganzen Aktennotizen, die man so hat, Momentaufnahmen, das können Randnotizen sein, im Terminkalender, einfache Gesprächsnotizen, egal ob es ein Telefonat war oder ein persönliches Gespräch“ (SA 2).
„So was (während des Interviews erwähnte Dokumentationsinstrumente, d. Verf.) regt auch dazu an, im Nachhinein das Leben in der Einrichtung zu reflektieren“ (SA 5). In einer aufgesuchten Einrichtung wurde u. a. mit Hilfe der angefertigten Krankenstatistiken analysiert, aus welchen Gründen die Teilnehmer an den Jugend-ABM zu bestimmten Zeiten gehäuft Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigungen einreichten: Man erkannte einen Zusammenhang mit dem Ort, an welchem die Klienten jeweils eingesetzt waren (SA 1). Hilfe- bzw. Förderpläne, zu denen unten weitere Ausführungen erfolgen, machen geleistete Hilfen einer Prüfung zugänglich, wenn bei deren Fortschreibungen kontrolliert wird, „ob die Ziele (...) erfüllt wurden oder nicht erfüllt wurden“ (SA 2).
Es wird deutlich, dass (Selbst-) Reflexion, teilweise gestützt durch Formen der Dokumentation, für die Praxis nicht nur gefordert wird, sondern auch aus der Sicht der befragten Fachkräfte für die tägliche Arbeit von höchster Bedeutung ist. Reflexive Aktivitäten sind einerseits der beruflichen Hygiene sehr zuträglich. Zum anderen ist es wünschenswert, dass sie sich tatsächlich auch auf die laufende Arbeit auswirken. Das geschieht nach Einschätzung einiger Praktiker: „Ich denke da in jedem Fall, dass es da positive Anregungen gibt“ (SA 1), „gerade in solchen Sachen, wo man denkt, man kommt nicht weiter, (...) da hilft manchmal schon ein klärender Hinweis“ (SA 4), „gerade für mich als Neuanfänger (...) ist es ganz wichtig, was andere Leute so für ‘ne Perspektive haben (...), wir sollen ja multiperspektivisch arbeiten“ (SA 2).
5.2 Zum Umgang mit den Effekten der eigenen Tätigkeit
Eng verbunden mit der Problematik der Reflexion und Bewertung sozialarbeiterischen Handelns ist die Frage, ob dessen Wirkungen überhaupt gemessen werden können. Bestandteil der Leitfadeninterviews war daher auch die Befragung zur Wahrnehmung von Effekten, Erfolgen und Misserfolgen sowie zu den Möglichkeiten der Effektmessung. Bei der Auswertung der Interviews hat sich gezeigt, dass mit dem Begriff „Erfolg“ individuell sehr unterschiedlich umgegangen wird. Ähnlich wie bei von SPIEGEL (1993, 111 f.) sind zwei Dimensionen zu erkennen, in denen sich der Begriff abbildet: erstens die Ebene der Klientenentwicklung und zweitens die Ebene der Helfer-Klient-Beziehung. Für einen Gesprächspartner hieß Erfolg, „dass aus (...) der vorgefundenen Situation heraus eine Entwicklung geschehen ist, oder auch, wenn Verschlimmerung absehbar gewesen wäre, ein Stand gehalten werden konnte“ (SA 5), für einen anderen, „wenn bei den Klienten die Problemerkennung bewirkt wird“ (SA 6). „Also für mich persönlich ist ein Erfolg, wenn ich einen Menschen so weit gebracht habe, dass er in der Lage ist, sein Problem selber zu erkennen (...), um daraus Handlungsschritte abzuleiten“, erklärte eine Sozialpädagogin (SA 1). Ähnlich lautete diese Einschätzung: „Wenn man dann schon die Eltern so weit bringt, OK, die kommen von selber drauf (...). Es sind eigentlich schon die kleinen Erfolge, die reichen“ (SA 4). Das hiermit dargestellte Verständnis von „Erfolg“ bezieht sich vornehmlich auf die Dimension der Klientenentwicklung. Bei den zwei letzten Aussagen ließe sich jedoch auch ein gewisser Zusammenhang zur Arbeitszufriedenheit und zu einem positiv wahrgenommenen Verhältnis zum Klienten herstellen. Für eine weitere Praktikerin ist die Harmonie in der Helfer-Klient-Beziehung offensichtlich ein zentrales Kriterium: „Erfolge sind, wenn die Bürger dann wiederkommen, und sagen, also bedanken sich mal, oder wenn die Kinder sagen, es hat uns gefallen“ (SA 7).
Das folgende Zitat deutet auf das Erfordernis eines kritischen Umgangs mit „persönlichen“ Erfolgen und eigenen Anteilen am Hilfeprozess hin: „Und es ist eben auch ein Erfolg, wenn die Eltern dann eben auch an ihrer Situation was ändern, beispielsweise, dass die Kinder wieder nach Hause kommen können, wenn sie eben Ratschläge von mir annehmen“ (SA 2). Auf wessen fachliches Handeln die Wiedereingliederung eines Kindes in die Ursprungsfamilie zurückzuführen ist, bleibt bei dieser Betrachtung unreflektiert. Am Fallgeschehen ist schließlich nicht nur die Mitarbeiterin des Jugendamtes beteiligt, sondern bei zeitweiliger Heimerziehung neben dem Klientensystem vorwiegend auch die Heimeinrichtung. In ähnlicher Form ist es auch für eine zweite Interviewpartnerin ein Erfolg, „wenn ein Kind lange in ‘ner neuen Familie leben kann, was sich gut integriert, was sich ganz einfach auch gut entwickelt“ (SA 3)[12].
Die Aussagen zu Misserfolgen bezogen sich bei allen befragten Fachkräften im Gegensatz zum Erfolgserleben kaum auf Entwicklungen bei den Klienten oder das Ausbleiben positiv zu bewertender Wirkungen, sondern eher auf Enttäuschungen, Vertrauensbrüche, mangelnde Kooperationsbereitschaft, Ablehnung und das Gefühl, bei der Fallbearbeitung zu wenig oder das Falsche für den Klienten getan zu haben. Als Misserfolge nahmen die Befragten wahr, wenn „Bürger sich dann abfällig äußern“ (SA 7), „wenn ich den Dialog nicht hinbekomme, (...) ständiges Entreißen, (...) Hintertürchen, (...) Austricksen“ (SA 3), wenn „dann beide Elternteile sich auf einmal gegen uns stellen“ (SA 4), „wenn nicht mitgearbeitet wird“ (SA 1), „wenn ich am Ende einer Maßnahme das Gefühl habe, dass ich nicht das eingebracht habe, was ich persönlich, glaube ich, zu leisten vermocht hätte“ (SA 5) oder „wenn die Hilfe nicht so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe“ (SA 2).
Auf die gezielte Frage hin ist es den Fachkräften schwer gefallen zu formulieren, was aus ihrer Sicht die Effekte, also die Wirkungen ihres beruflichen Handelns sind. Vorwiegend wurden sie verglichen mit Erfolgen und verwirklichten Zielen, kaum jedoch mit negativen Ergebnissen oder Begleiterscheinungen. Effekte äußern sich u. a. in Erfolgen und Misserfolgen, wenn man diese als positive bzw. negative Wirkungen ansieht. Problematisch ist hier natürlich die zwangsläufige Subjektivität der einer Zuordnung zugrunde liegenden Bewertung, welche von gegebenenfalls unterschiedlichen Wert- und Zielvorstellungen abhängig ist. Abzugrenzen von dem sich an der Entfernung von Arbeitszielen orientierenden Erfolgs- bzw. Misserfolgsverständnis ist die Wahrnehmung persönlicher Erfolge bzw. Misserfolge in Gestalt von persönlichen Höhepunkten und individueller Leistungssteigerung bzw. von persönlichen Tiefpunkten und individuellem Leistungsversagen einzelner Fachkräfte. Oben zitierte Aussagen der Interviewpartner belegen beispielhaft die Möglichkeit dieser Unterscheidung.
Nach MERCHEL (1992, 237 f.) „hat bei der Beurteilung von Erfolg in der sozialen Arbeit nicht nur ein sichtbares ‚Ergebnis‘ Bedeutung, sondern gleichermaßen die Art der Problembearbeitung“. Während sich einzelne Ergebnisse, z. B. das Erlangen eines Schul- oder Ausbildungsabschlusses, noch mit quantitativen Methoden messen ließen, würden auf diese Weise längst keine Erkenntnisse über die Qualität der Arbeit (z. B. nach Effizienz- oder ethischen Kriterien) und negative Begleiteffekte (z. B. die Verringerung von Selbsthilfepotenzialen oder sozialen Kontakten) gewonnen werden können. In der Produktion ist es möglich, hergestellte Werkstücke zu zählen, um die Effekte des Mitarbeitereinsatzes oder des Produktionsverfahrens (Methode) zu messen. Die Frage nach der Eignung eines bestimmten sozialpädagogischen Arbeitsansatzes in einer Erziehungsberatungsstelle könnte man dagegen nicht allein durch das Zählen der „Beratungserfolge“ beantworten. Schon aufgrund der individuellen Merkmale von Klienten (-systemen), Problemlagen, Lebenswelten und der Vielfalt von Rahmenbedingungen und Handlungssettings ergibt sich für den Hilfeverlauf ein unbekannter, aber wesentlicher Einflussfaktor. Zum einen bestimmt dieser den Hilfeprozess maßgeblich, zum anderen lässt er sich im Vorfeld nicht determinieren. Zu erzielende Ergebnisse können daher nicht vereinfacht als mathematische Funktionen von Ausgangssituation und sozialarbeiterischem Handeln begriffen werden. Bedingt durch diese „fehlende Kausalität“ (von SPIEGEL 1998, 362) ist es für die soziale Arbeit kaum möglich, klare Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge festzustellen. Eine Sozialarbeiterin bestätigte: „Manche Beratungen oder Gespräche (...) sind sehr intensiv, und auch über einen längeren Zeitraum, (...) und manche Gespräche eben ganz kurz“ (SA 7). Eine Ursache dafür wurde in einem anderen Jugendamt genannt, nämlich, „wir sind alles Menschen und jeder Mensch reagiert anders“ (SA 5), und: „Jede Situation ist anders, und man kann im Vorfeld auch nicht sagen, in welche Richtung das geht“ (ebd.). „Es wird hier mit Menschen gearbeitet, nicht mit Gegenständen“, formulierte der befragte Jugendamtsleiter (SA 6), „es ist zum Beispiel nach außen nicht abrechenbar, was genau die eingestellten Mittel bewirken, ob mit 75.000 Mark für eine Personalstelle 150.000 Mark bei der Heimerziehung eingespart werden“ (ebd.). „Es ist natürlich schlimm, in der sozialen Arbeit alles nur in Zahlen auszudrücken“, meinte die Mitarbeiterin des Jugendhilfevereins (SA 1).
Eine differenziertere Sichtweise brachte diese Sozialpädagogin ein: „Es fällt schwer, also die Wirksamkeit von so ‘ner Hilfe (...), also wenn die gesteckten Ziele des Hilfeplans erreicht wurden, dann denke ich mal, kann man das messen da dran“ (SA 2). Mit Effektmessung verband sie vermutlich nicht, die Häufigkeit des Eintretens bestimmter Wirkungen infolge definierter Handlungen zu erheben, sondern Aussagen über die Klientenentwicklung und den Hilfeprozess anhand festgelegter Indikatoren und Kriterien („Ziele des Hilfeplans“) abzuleiten. Ähnliches erklärte der Leiter der Heimeinrichtung: „Ich denke, dass man sie (Effekte, d. Verf.) messen kann. Ich glaube nicht, dass man mit diesen Ergebnissen platt umgehen darf. Sondern sie sollen in erster Linie für die Personen eine Rolle spielen, an denen sie erhoben werden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man mit kurzen Fragebogen zum Beispiel Empfindungen, Wahrnehmungen eines Kindes oder von Eltern erhebt. Auch von Jugendämtern, wie sie die Betreuung und Begleitung empfinden, natürlich auch von den Mitarbeitern“ (SA 5). Auf die hiermit angesprochene Weise könnten die Perspektiven von verschiedenen Beteiligten anhand von festgelegten Indikatoren (Fragestellungen) untersucht werden, um die eigene Sichtweise auf den Fall um eventuell verborgene Aspekte zu erweitern.
Im Kontext von Reflexion und Selbstevaluation ist der Begriff „Effektmessung“ nicht geeignet, das Erforschen von sozialpädagogischer Tätigkeit und ihrer Auswirkungen zu beschreiben. Auch die Betrachtung der beiden letzten Interviewausschnitte verlangt die Auseinandersetzung mit dem Begriff.
Unter einem „Messen“ von „Effekten“ kann bedenkenlos die Erhebung von quantifizierbaren Kausalzusammenhängen verstanden werden. Wie oben bereits dargestellt worden ist, existieren diese jedoch kaum in der sozialen Praxis. Im engeren Begriffsverständnis ist das „Messen“ ein Vergleichen von Merkmalen mit vorhandenen Maßstäben (in der Geometrie z. B. der Vergleich der Seitenlänge einer Figur mit dem Längenmaßstab des Lineals). Innerhalb der Untersuchung von Stationen und Ergebnissen im Hilfeprozess wird dann „gemessen“, wenn verglichen wird, inwiefern Vorgaben und Ziele mit dem Erreichten übereinstimmen. Indikatoren von Ist-Ständen werden dabei an den Maßstab von Kriterien gelegt. Geht man davon aus, dass sich die Wirkungen des eigenen beruflichen Handelns aus dem Zusammenspiel von Ausgangssituationen, der Art und Weise der Interventionen und der beschriebenen Komponenten anderer, weitestgehend nicht kalkulierbarer Einflüsse ergeben, so kann man lediglich Aussagen über Entwicklungsstände im Hilfeprozess sowie über mögliche förderliche und hemmende Faktoren (in der Erziehungsberatung z. B. der Beratungsort, die Tageszeit) herausarbeiten. Hier findet aber eine Form von Reflexion statt, die mehr oder weniger systematisiert ablaufen kann.
5.3 Von der Reflexion zur Selbstevaluation
Als Bestandteil der täglichen Berufsausübung sind Vorgänge der Reflexion und Auswertung eigenen Handelns aus der sozialen Arbeit nicht wegzudenken. Wie oben (5.1) bereits geschildert und mit Interviewausschnitten bekräftigt, finden Reflexionen permanent und in allen Bereichen statt. Dabei handelt es sich jedoch in den seltensten Fällen um Verfahren der Selbstevaluation. LÜDERS (1998, 26) spricht hier von einer „3-i-Evaluation“ und bezeichnet damit „jene Evaluationsprozesse, die in jeder Einrichtung vorrangig i ntern, i nformell und weitgehend i ntuitiv ablaufen.“ Die damit angesprochenen Möglichkeiten der Aus- und Bewertung der sozialarbeiterischen Praxis sind beispielsweise Gespräche unter Mitarbeitern, gedankliche Auseinandersetzungen und fachliche Austausche, unter Umständen auch Fallbesprechungen. Die „3-i-Evaluation“ verlangt nicht das Ausweisen konkreter Evaluationsgegenstände, festgelegter Kriterien, aussagefähiger Indikatoren und anzuwendender Methoden. Obwohl sie deshalb nicht systematisch erfolgt, spielt sie eine zentrale Rolle für das tägliche „Überleben“ im Berufsalltag (vgl. oben, 5.1).
MÜLLER (1997, 58) kritisiert das verbreitete eingeengte Verständnis von Evaluation und fordert, sie ausgedehnter und weiter gefasst zu begreifen[13]. Ihm zufolge ist Selbstevaluation die Auswertung von Fällen durch den professionell Handelnden selbst (ebd.). An anderer Stelle räumt er ein, dass von „Evaluation im engeren Sinne (...) aber erst dort zu reden (ist), wo solche selbstkontrollierte Praxis spezielle Instrumente benutzt und dies bewußt tut. Zweitens (...), wo ausdrücklich Kriterien genannt und benutzt werden, um ein Stück praktischer Arbeit zu überprüfen“ (ebd., 126). Da sich die Aussagen MÜLLERs auf „Selbstkontrolle“ beziehen, vor allem aber generell auf „Evaluation“, wäre abzuleiten, dass auch Selbstevaluation Instrumente und Kriterien benötigt. Von MÜLLER (ebd., 127 ff.) vorgeschlagene Instrumente sind Berichte, Gespräche[14] und Hilfsmittel aus den Bereichen der Dokumentation und Praxisforschung. Im Weiteren benennt er Kriterien der Effektivität, Effizienz, Ethik, und der Realitätsprüfung. Eine solche Beschreibung von Evaluation bzw. Selbstevaluation träfe ohne weiteres auf die „3-i-Evaluation“ zu, und damit auch auf die während der Leitfadeninterviews von den Praktikern erwähnten Reflexionsformen. Das würde bedeuten, dass bereits das Schreiben eines Aktenvermerkes, die Dienstberatung, sogar die tägliche Frühstückspause, Verfahren der (Selbst-) Evaluation wären, wenn dort nur, gleich in welcher Form, Praxisauswertung stattfinden würde. Die Instrumentalisierung wäre aus der Tatsache heraus, dass ein Schriftstück (Aktenvermerk, Bericht) vorliegt oder ein Gespräch erfolgt, bereits gegeben. Die Anwendung von Kriterien ließe sich ebenso mühelos nachweisen: In den meisten kollegialen Gesprächen zur Reflexion eigener Anteile der Arbeit werden Fragen zur Sinnhaftigkeit und Wirkung einer bestimmten Reaktion, Handlungsweise oder Maßnahme aufgeworfen, also Effektivitäts- oder Effizienzkriterien angelegt. Es wird deutlich, dass es einer verbindlicheren Differenzierung zwischen Reflexion und Selbstevaluation bedarf.
„Selbstevaluation und Auswertung bedeuten (...) nicht dasselbe. (...) Selbstevaluation strukturiert Reflexion und Auswertung und verhilft ihr somit zu einer Richtung“, betont Hiltrud von SPIEGEL (1993, 144).
Mit den durchgeführten Leitfadeninterviews konnten keine direkten Aussagen darüber gewonnen werden, auf welche Weise Reflexion strukturiert werden kann. Indirekt jedoch wurde die Umsetzung von strukturierten Reflexionsformen bestätigt, zum Beispiel durch die Erwähnung von fortzuschreibenden Förderplänen, der Analyse von Krankenstatistiken und eines Bogens zur Selbst- und Fremdeinschätzung (SA 1). Weitere Fachkräfte verwiesen auf die Fortschreibung von Hilfeplänen, bei welcher auch Zielerreichungsbögen genutzt werden (SA 2, SA 3, SA 4). Mehrere Gesprächspartner benannten Instrumente, z. B. Formulare für Fallbesprechungen (SA 3, SA 4, SA 5). Eine bewusste Strukturierung der Verfahren zur Auswertung beruflichen Handelns ist dennoch keine zwingende Bedingung für eine Reflexion. Der lockere kollegiale Austausch, welcher außerhalb der institutionell eingerichteten Reflexionsformen, z. B. nicht in den Teamberatungen, sondern auf dem Flur stattfindet, ließe sich gar nicht systematisieren. Eine Sozialarbeiterin erklärte sogar zur Teamberatung, gar nicht zu wissen, was sie sich „da methodisch für andere Sachen einfallen lassen muss. (...) Wenn ich jetzt, sag ich mal, Fragen- oder Antwortkarten oder irgendwelche Dinge machen würde, ich denke, das, das mögen sie (die Kollegen, d. Verf.) nicht so gerne. Dann würden sie sich auch nicht so öffnen“ (SA 7). Diese Einschätzung sei hier erwähnt, jedoch ohne sie unkritisch übernehmen zu wollen.
Dazu befragt, ob Reflexion im Allgemeinen möglichst strukturiert sein sollte, antwortete ein Praktiker, dass auch eine offene Reflexion „für den Start eine wichtige Hilfe“ sei, und dass „man dann (...) Punkte hat, an denen man sich orientieren kann. Da ist natürlich auch für jeden Mitarbeiter ein unterschiedliches Maß an Struktur notwendig. Also es gibt Mitarbeiter, die eine sehr hohe Strukturiertheit in ihrem eigenen Leben haben, und es gibt Mitarbeiter, die bei einer genauso hohen oder höheren pädagogischen Qualität vielleicht eher unstrukturiert an ihr Leben herangehen und, ich denke, die ich mit einer überfrachteten Strukturierung, vielleicht den ganzen Tagesablauf zu erfassen, pädagogisch ins Aus führen würde“ (SA 5).
Auf obige (2.2) Ausführungen zum Wesen der Selbstevaluation verweisend, sollte an dieser Stelle erneut eine Erklärung zum Begriffsverständnis gemacht werden: Selbstevaluation ist die Beschreibung, Be- und Auswertung des eigenen beruflichen Handelns. Es erfolgt dabei eine Betrachtung von Praxisausschnitten, welche zum Ziel hat, handlungsbezogene Erkenntnisse zu liefern und auf diese Weise Praxisinnovation zu fördern.
Um von Selbstevaluation sprechen zu können, ist das Vorhandensein von Merkmalen der Strukturierung und Systematisierung unabdingbar. Diese zentrale Voraussetzung wird dann erfüllt, wenn:
- ein eingegrenzter, klarer Evaluationsgegenstand formuliert worden ist,
- der Evaluationsgegenstand in geeigneter Form mit Indikatoren operationalisiert wurde,
- Kriterien existieren, denen die Indikatoren (ggf. mit ihren Werten) gegenübergestellt werden können,
- eine Datenerhebung mit speziellen Methoden und Instrumenten, z. B. aus dem Bereich der empirischen Sozialforschung, erfolgt und
- die Auswertung der Daten sowie die Ergebnisse der Selbstevaluation auf die weitere Entwicklung des untersuchten Praxisausschnittes Einfluss haben.
Angesichts dieser Merkmale, welche im übrigen auch von KÖNIGs (2000, 56 ff.) Ablaufschema (vgl. oben, 4.1) erfasst werden, wird die notwendige Abgrenzung zu einfachen Reflexionsarten sehr deutlich sichtbar. Reflexionen und Auswertungen, welche sich einer Selbstevaluation stark annähern und die Mehrheit derer Elemente einschließen (z. B. Fallbesprechungen nach besonderen Vorkommnissen), würde ich dennoch als „selbstevaluative“ Aktivitäten bezeichnen. Gleichsam können verschiedene anlassbezogene individuelle Formen der Auswertung von Praxisausschnitten (z. B. Gedankenprotokoll, Ressourcenanalyse) als selbstevaluative Vorgänge begriffen werden, wenn sie nicht sogar einer Selbstevaluation entsprechen.
Bei den Interviewbefragungen stellte sich heraus, dass einige Fachkräfte den Begriff Selbstevaluation weder erklären noch umschreiben konnten (SA 3, SA 4, SA 7). Ein Sozialarbeiter antwortete auf die Frage, ob er sich denn schon mal mit Selbstevaluation beschäftigt habe: „Eigentlich nicht. Wir haben das ja mehr als Feedback genommen“ (SA 4). Andere wiederum wussten Selbstevaluation in ihren Wesenszügen zu beschreiben: „Ja, es soll ja wohl die Überprüfung seiner eigenen Arbeit sein. Es ist ja sogar gesetzlich geregelt. Nicht?
Selbstevaluation, die Überprüfung der eigenen Arbeit, im SGB VIII, nicht? (...) Supervision ist mehr so eine persönliche Schiene, nicht? Eine emotionale, persönliche Schiene. Und ich denke, eine ganz normale Selbstevaluation betrifft eher die sachliche Schiene, die Sachebene“ (SA 1).
„Selbstevaluation ist, wenn man seine Arbeit hinterfragt, kontrolliert, guckt, ob’s denn alles so richtig ist, wie es beispielsweise das Gesetz auch vorschreibt, ja“, erklärte eine Berufskollegin (SA 2). Ein anderer Gesprächspartner verstand darunter, „an sich runterschauen, seine Tätigkeit werten“ (SA 6). Der aufgesuchte Heimleiter traf folgende Aussage: „Ich (...) möchte keine Definition in einer Prüfungssituation dazu bringen. Aber die strukturierte Betrachtung der eigenen Arbeit würde ich da einschließen. Zum einen Maßstäbe zu setzen, diese dann auch wieder zu prüfen“ (SA 5). Die Praktizierung von Selbstevaluation meinte eine Sozialpädagogin (SA 2) im Hilfeplanverfahren zu erkennen, wenn die Ziele des letzten Hilfeplans gemeinsam überprüft und daraus Rückschlüsse für die Hilfeplanfortschreibung gezogen werden. In ihren Augen ist das „sowohl Evaluation für mich selber, (als) auch für den Träger“ (ebd.). Es kann hier zumindest von einer (Selbst-) Evaluation nach MÜLLER (1997, 58 und 126 ff.) ausgegangen werden – die Gesprächspartnerin erwähnte sogar den Autor in diesem Zusammenhang. Darüber hinaus fühlte sie sich mit Selbstevaluation konfrontiert, „wenn man, wenn zum Beispiel nachgefragt wird, oder wenn ich nachdenke, inwiefern die Hilfe, ob das jetzt richtig war, wenn (...) es da Schwierigkeiten gibt oder so, dann ist es das (gemeint ist Selbstevaluation, d. Verf.) schon, wenn ich selber nachdenke, ist das noch geeignet, oder eben nicht geeignet“ (ebd.).
5.4 Selbstevaluative Aktivitäten in der Praxis
Im Folgenden werden Verfahren dargestellt, die von einigen der befragten Fachkräfte (SA 1, SA 2, SA 4, SA 5) zur strukturierten Reflexion eigener Praxis verwendet werden. Angelehnt an das im Abschnitt 5.3 erneut geklärte Begriffsverständnis wird jeweils erörtert, inwiefern sie einer Selbstevaluation gleichen.
5.4.1 Persönlichkeits- und Leistungsprofil bei Jugend-ABM
Befragt zu den Chancen einer systematischen Praxisreflexion äußerte eine Sozialpädagogin: „Was ist herausgekommen aus meiner Arbeit, (...) was hat sich verändert während der Hilfeprozesse, was hat sich bei dem Klienten verändert (...) innerhalb dieses einen Jahres? Das kann man, anhand dieser (...) Einschätzungsskalen kann man das ganz gut beobachten“ (SA 1). Sie berichtete, dass für die Teilnehmer an den Jugend-ABM in ihrer Einrichtung im Rahmen der Förderplanung Selbst- und Fremdeinschätzungen erhoben und ausgewertet werden, um den Förderprozess evaluieren und bedürfnisorientiert weiterentwickeln zu können. Auf den unten dargestellten Erhebungsbogen (Abb. 5) verweisend, erklärte sie, dass zum einen der Klient einen solchen Bogen auszufüllen hat, zum anderen auch sie als Sozialpädagogin gemeinsam mit dem zuständigen Anleiter. Die Ergebnisse der beiden Erhebungen zum Arbeits- und Sozialverhalten werden dann miteinander verglichen, und darüber hinaus ermöglicht die Datenverarbeitung am PC einen Längsschnittvergleich. Entwicklungen – zumindest der Einschätzungen – im Laufe des Hilfeprozesses können auf diese Weise gut nachvollzogen werden, besonders nach der grafischen Darstellung von Entwicklungswerten in Liniendiagrammen. Den Aussagen der Sozialpädagogin zufolge wird die Selbst- und Fremdeinschätzung im Rhythmus von sechs Wochen vorgenommen, parallel zu den Fortschreibungen der Förderpläne. Von zentraler Bedeutung ist, betonte die Sozialpädagogin, dass die getroffenen Einschätzungen im gemeinsamen Gespräch mit dem Klienten und dem Anleiter thematisiert werden, um daraus Rückschlüsse zu ziehen, die in die weitere Förderplanung eingearbeitet werden können.
Betrachtet man die Erstellung des Persönlichkeits- und Leistungsprofils hinsichtlich der Erfüllung der o. g. Merkmale von Selbstevaluation, lässt sich daraus eine sehr deutlich strukturierte Reflexion interpretieren. Zielstellungen sind die Kontrolle und Aufklärung eigener Arbeit anhand der Entwicklung des Klienten, mit der Option, die Schwerpunkte der sozialpädagogischen Begleitung bzw. pädagogischen Anleitung ggf. in ihrer
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ausrichtung zu korrigieren. Gegenstand der (Selbst-) Evaluation ist dabei das Arbeits- und Sozialverhalten des Teilnehmers an der Jugend-ABM. Die Rahmenbedingungen sind so weit stets hinreichend abgesichert, als dass die gemeinsame Auswertung von festgelegten Zeiträumen Bestandteil der Förderplanung ist, welche kontinuierlich zu erfolgen hat. Personelle, materielle und zeitliche Ressourcen sind damit von vornherein abgeklärt. Dem Erfordernis einer Gegenstands-Operationalisierung wird dadurch bereits Rechnung getragen, dass für mehrere Kategorien verschiedene Indikatoren, für den Bereich der kognitiven Fähigkeiten z. B. „schlussfolgerndes Denken“, „Formauffassung“, „Rechenfähigkeit“ usw. gebildet werden. Als Informationsquellen für die Datenermittlung dienen der Klient, der pädagogische Anleiter sowie die begleitende Sozialpädagogin, da von ihnen der oben dargestellte Erhebungsbogen (Instrument) durch Ankreuzen von Werten in den jeweiligen Spalten auszufüllen ist. Unter methodischen Gesichtspunkten findet damit eine schriftliche Befragung mit Schätzskalen statt. Bei der Datenauswertung, welche durch den Vergleich, das gemeinsame Gespräch und die grafische Darstellung geschieht, steht zwar die Reflexion individueller Entwicklungen im Vordergrund. Die Kriterienfrage (vgl. oben, 4.1) lässt sich aber zunächst damit beantworten, dass die zu den Indikatoren erhobenen Ist-Werte dem wünschbaren Zustand gegenübergestellt werden können. Beim Indikator „Fingergeschick“ ist z. B. der Wert „sehr hoch“ ein wünschbarer Zustand, und beim Indikator „Aggressivität“ der Wert „sehr gering“. Die Erkenntnisse, welche mit der kontinuierlichen Ermittlung und Reflexion solcher Persönlichkeits- und Leistungsprofile gewonnen werden, fließen nach Aussage der befragten Sozialpädagogin (SA 1) unmittelbar in die Förderplanung ein (Ergebnisverwertung). Auf diese Weise verhelfen sie zu einer Praxisinnovation, wenn das Hauptaugenmerk der Förderung verschoben oder präzisiert werden muss.
Zum Aspekt der Qualität des Evaluationsvorhabens kann hier – idealerweise – bemerkt werden, dass die Mitarbeiterin der Einrichtung äußerte, „aber von der Methode wollten wir dann eigentlich noch abweichen, wir sind dabei, eine neue Tabelle zu entwickeln“ (SA 1). Wie sie weiter ausführte, müssten die im Instrument angegebenen Indikatoren mit für die jugendlichen Klienten transparenteren Begriffen, evtl. einfachen Fragestellungen, formuliert werden. Erörtern ließe sich außerdem der Einfluss der jeweiligen Stimmungslage auf die Selbst- bzw. Fremdeinschätzung. Auf die relevante Individualität der Bedürfnisse, Schwächen und Stärken der verschiedenen Klienten könnte man mit wenig Aufwand durch die computergestützte Anpassung oder Ergänzung von Indikatoren eingehen.
Wäre ein Teilnehmer beispielsweise von sehr starken Ängsten geprägt, genügte der Indikator „Ängstlichkeit“ bei weitem nicht.
Das angeführte Verfahrensbeispiel ist zunächst eine Form interner Evaluation.
Da dieselben Personen, die mit der Durchführung des Hilfeprozesses betraut sind, auch die Auswertung vornehmen, ist es der Selbstevaluation zuzuordnen. Nach HEINER (1996, 35 ff., vgl. auch 2.2.1) findet sie im Setting der Teamselbstevaluation statt, wobei sich das Team im Beispiel aus dem Anleiter und der Sozialarbeiterin zusammensetzt.
5.4.2 Zielerreichungskontrolle im Hilfeplanverfahren
Von allen im Rahmen der Interviewbefragungen aufgesuchten Jugendamtsmitarbeitern (SA 2, SA 3, SA 4, SA 6, SA 7) wurde der Hilfeplan im Bereich der Hilfen zur Erziehung nicht nur als Grundlage für eine Hilfegewährung nach dem KJHG erwähnt. Nach Ansicht der Gesprächspartner gestatten seine Erstellung und Fortschreibung auch vielfältige Möglichkeiten der Reflexion. Zunächst „werden eben dort die Ziele festgelegt und dann alle halbe Jahre überprüft“ (SA 2). „Alle halbe Jahre, oder bei Bedarf auch früher, werden dann die Ziele, die wir hatten, kontrolliert, entweder weiter daran gearbeitet, oder es werden neue Ziele festgelegt. Natürlich wird dann bei der Auswertung immer dahinter geguckt, warum wurde das Ziel nicht erreicht, und wie könnte das Ziel erreicht werden“ (SA 4).
MÜLLER (1997, 58) zufolge wären allein die Aussagen dieser beiden Berufskollegen Belege genug für einen Nachweis der Umsetzung von Evaluation im Hilfeplanverfahren. Voraussetzung für (Selbst-) Evaluation nach oben (5.3) gemachtem Begriffsverständnis ist jedoch auch hier eine Strukturierung der Reflexion bei Hilfeplanfortschreibungen. Nachfolgend wird das Hilfeplanverfahren eines Jugendamtes im Hinblick auf seine (selbst-) evaluativen Anteile beschrieben[15].
Als zentrale Voraussetzung für eine Hilfegewährung enthält der gemeinsam mit allen Beteiligten (Kind/Jugendlicher/junger Mensch; Eltern; Einrichtung/Fachkräfte; Jugendamt) erstellte Hilfeplan im Wesentlichen:
- Festlegungen über Art, Dauer und Umfang der zu gewährenden Hilfe,
- die Darstellung der Ausgangslage vor der Hilfe,
- die Festlegung eines Globalzieles für den Hilfeprozess,
- die Vereinbarung von Hauptzielen für den Hilfeprozess und
- Handlungszielen für die einzelnen Beteiligten sowie
- weitere Vereinbarungen, z. B. über Zusatzleistungen.
Die Hauptziele werden im Hilfeplan in Handlungsaufträge konkretisiert und um die Angabe der jeweiligen Verantwortlichen (i. d. R. Beteiligte) sowie des Zeitraumes, innerhalb dessen die Zielerreichung erfolgen soll, ergänzt. Dies geschieht für folgende sechs Bereiche: persönliche Entwicklung, Familie, Versorgung, Bildung/Beruf, Verselbstständigung und sonstige Ziele. Daran anknüpfend erfolgt die Fortschreibung des Hilfeplanes stets im Ergebnis einer gemeinsamen Auswertung des Fallgeschehens („Hilfeplanfortschreibungs-Beratung“) in der Regel im Abstand von höchstens sechs Monaten. Die bis dahin verfolgten Ziele und Handlungsaufträge werden dabei auf den Grad ihrer Erreichung sowie ihrer Tauglichkeit geprüft. Die gemeinsame, systematische und instrumentalisierte Reflexion vollzieht sich – teilweise bereits in Vorbereitung der Fortschreibungs-Beratung – mithilfe verschiedener Verfahren und Instrumente. Mit dem nachfolgend abgebildeten Bogen (Abb. 6) ist die Beschreibung der aktuellen Situation als Bestandteil der Hilfeplanfortschreibung instrumentalisiert worden. Abbildung 7 zeigt einen Teil des verwendeten Formulars für die Dokumentation der konsensualen Einschätzung der Beteiligten über die Zielerreichung. Diese haben zur Vorbereitung einer solchen zusammenfassenden Darstellung bereits im Vorfeld ein inhaltlich identisches Formular auszufüllen und dem Sozialarbeiter des Jugendamtes zukommen zu lassen.
Evaluationsziele sind Aufklärung und Kontrolle in Bezug auf die Wirksamkeit der eingebrachten Aktivitäten, mit der Perspektive, den Hilfeprozess ggf. mit neuen oder veränderten Handlungszielen und -aufträgen zu modifizieren (Innovation).
Das Vorhaben ist in institutionellen Verfahrensabläufen fest installiert, weshalb zumindest die nötigen materiellen Rahmenbedingungen nicht erst einzurichten, sondern bereits vorhanden sind. Ins Auge gefasst werden bei der Untersuchung die Entwicklung des Klienten sowie der erreichte Ist-Stand im Hilfeprozess (Evaluationsgegenstand). Dies erfolgt anhand der im letzten Hilfeplan aufgestellten Zielstellungen und Aufträge (Indikatoren), die nach der Annäherung an ihre Verwirklichung (Kriterien) bewertet werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Da sowohl in die „Beschreibung der aktuellen Situation“ (vgl. Abb. 6), als auch in die Darstellung der „Entwicklung seit dem letzten Hilfeplangespräch“ (vgl. Abb. 7) alle Beteiligten mit ihren Sichtweisen einbezogen werden, sind diese gleichzeitig Informationsquellen für die Datenerhebung. Die Daten-/Informationsermittlung verläuft daher im gemeinsamen Gespräch sowie schriftlich, unter Verwendung von Dokumentationsmaterial, Berichten sowie Schätzskalen zur Zielerreichung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Ergebnisse dieser Reflexion von Hilfeverläufen gehen danach unmittelbar in die weitere Hilfeplanung ein, indem die vereinbarten Zielstellungen und Aufträge aufrechterhalten, geändert, weggelassen oder ergänzt werden (Ergebnisverwertung). Die Frage, ob bei diesem Teil des Hilfeplanverfahrens Selbstevaluation stattfindet, lässt sich trotz der hiermit gegebenen Erfüllung oben (5.3) angeführter Strukturmerkmale nicht eindeutig beantworten. Selbstevaluation wurde im vorangegangenen Teil der Arbeit als interne Evaluationsform vorgestellt. Hier jedoch läuft eine Reflexion ab, die als Produkt der Beiträge aller am Hilfeplan Mitwirkenden zu verstehen ist, weshalb die Beteiligten nicht lediglich Informationsquellen sind, sondern ebenfalls eine Be- und Auswertung ausüben. Die Evaluation wird also erstens nicht allein vom Sozialarbeiter des Jugendamtes umgesetzt, wenngleich er für sie verantwortlich ist. Zweitens bezieht sich die Untersuchung nicht allein auf die Arbeit des Jugendamtes bzw. des dortigen Sozialarbeiters. Vielmehr richtet sie sich auf einen gemeinsamen Hilfeprozess innerhalb eines Systems von mehreren Beteiligten. Es soll nicht behauptet werden, Selbstevaluation läge auch dann vor, wenn ein organisationsübergreifendes Hilfesystem die von seinen Aktivitäten ausgehenden Wirkungen untersucht.
Im engeren Sinne entspricht die beschriebene Zielerreichungskontrolle im Hilfeplanverfahren nicht einer Selbstevaluation. Selbstevaluative Aktivitäten hingegen finden statt, da sich trotz der gemeinschaftlichen Umsetzung jeder Mitwirkende auch mit seinen eigenen Anteilen am Fallgeschehen auseinander zu setzen hat. Betrachtet man beispielsweise die Bearbeitung des Zielerreichungsbogens (Abb. 7) durch die Hilfe leistende Einrichtung, so kann man hier durchaus von einer Selbstevaluation im engeren Sinne ausgehen, wenn die dortigen Fachkräfte das Formular nicht bloß als Zuarbeit für das Jugendamt verstehen, sondern damit die eigene Praxis in geeigneter Form intern bewerten und beeinflussen.
5.4.3 Strukturierte Fallbesprechung in der Heimerziehung
In der aufgesuchten Heimeinrichtung finden regelmäßig Gruppenberatungen statt, in deren Rahmen sich alle in der betroffenen Gruppe eingesetzten Fachkräfte sowie die Heimleitung in einer Fallbesprechung mit dem Erziehungsprozess jeweils eines Kindes auseinandersetzen. „Die Ergebnisse der Fallbesprechung sollen dann ganz konkret in die Erziehungsplanung eingehen. (...) Sie (die Fallbesprechungen, d. Verf.) sollen (...) eine Möglichkeit geben, (...) zu reflektieren (...), und vielleicht auch zu neuen Entwicklungen führen“ (SA 5). Die Fallbesprechung geschieht dabei nicht ohne Richtungsorientierung, sondern ist in ihrem Ablauf klar strukturiert. Das verwendete Grundgerüst dafür ist in Abbildung 8 wiedergegeben. Der Einstiegsphase, einer kurzen stärkenorientierten Anamnese, folgt die Gelegenheit für die Teilnehmer, klärende Rückfragen zu stellen. In der dritten Phase legt der Bezugserzieher die aktuellen „Hauptarbeitsfelder“, also die charakteristischen Eckpunkte und Kernziele des Hilfeprozesses dar. Viertens wird ein deutlicher Perspektivenwechsel vollzogen, indem versucht wird, den jungen Menschen aus einem völlig anderen Blickwinkel zu beschreiben, z. B. durch einen Methoden-/Technikwechsel, eine Fotodokumentation, eine Zimmerbesichtigung oder ein Rollenspiel. Der sich hieran anschließende und umfangreichste Schritt dient der eigentlichen gemeinsamen Reflexion des Erziehungsprozesses und der Bewältigung der Hauptprobleme des bzw. mit dem Betroffenen. Klare Zielstellung ist dabei die Entwicklung von Lösungsperspektiven bzw. die Neubewertung der Erziehungsziele. Bevor der Gesprächsleiter die Fallbesprechung zum Abschluss ergebnisorientiert zusammenfasst, werden die aus dieser Phase resultierenden Zielvorstellungen und Handlungsvorschläge von den Teilnehmern konkret formuliert und in Entwicklungszielen festgeschrieben (Ergebnisverwertung).
Zweifelsohne wird mit einer solchen Fallbesprechung eine deutlich strukturierte und systematische Reflexion eines Praxisausschnittes (Entwicklungs- und Erziehungsverlauf eines jungen Menschen) betrieben. Es erfolgt eine Bewertung der beruflichen Tätigkeit auf der Ebene des Teams. Unter diesen Aspekten ist auch diese Reflexion als Form von Selbstevaluation zu verstehen. Schwieriger gestaltet sich jedoch die Einschätzung, ob die oben im Abschnitt 5.3 benannten Strukturmerkmale erfüllt werden oder nicht. Evident ist, dass ein Evaluationsziel sowie ein -gegenstand vorliegen: Es wird geprüft und ausgewertet, wobei damit (Selbst-) Kontrolle und Aufklärung in Bezug auf die eigene Tätigkeit im Vordergrund stehen und sich innovativ auswirken sollen. Gegenstand der „Untersuchung“ ist dabei der Entwicklungsstand eines Kindes bzw. Jugendlichen. Nicht eindeutig nachvollziehbar sind hingegen die Gegenstands-Operationalisierung zu Indikatoren, die Kriteriengeleitetheit und die Methodenverwendung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Eine Indikatorenbildung kann im Verfahren der strukturierten Fallbesprechung nur individuell erfolgen, z. B. angelehnt an die bisher verfolgten Erziehungsziele und Hauptarbeitsfelder. Die Kriterien werden ebenso individuell von den Zielvorgaben und Wertvorstellungen des Teams bzw. der Beteiligten bestimmt. Der Grad der Strukturierung oder gar Quantifizierung von Indikatoren ist nicht von vornherein festgelegt und hängt von der inhaltlichen Aufbereitung und Darstellung des Bezugserziehers ab. Angemerkt sei außerdem, dass sich die Reflexion im Rahmen der Fallbesprechung nicht auf den Vergleich von festgelegten Indikatoren und Kriterien beschränken kann, sondern sich situativ auch auf andere Zusammenhänge, Vorgänge und Vorfälle bezieht, welche beispielsweise nicht Bestandteile der Erziehungsplanung und des Hilfeplans sind.
Es kann der Eindruck entstehen, dass keine empirischen Methoden zur Daten- und Informationsermittlung bzw. -auswertung gebraucht werden. Jedoch muss festgestellt werden, dass erstens die Möglichkeit offen gehalten wird, zur Falldarstellung und -reflexion geeignete Methoden anzuwenden, z. B. durch die Einbeziehung von Journalen, Beobachtungen, Schätzskalen u. ä. Zweitens ist die Fallbesprechung wenigstens gekennzeichnet von den Elementen der Moderationsmethode[16]. Innerhalb dieser finden zudem ungezählte methodische Verfahrensweisen und Techniken Platz, z. B. Diskussion, Brain-Storming, Visualisierungstechniken und Befragungen. Das gilt vor allem auch für die vorgestellte strukturierte Fallbesprechung in der Heimerziehung.
Unter der Voraussetzung, dass sich nach der vorangegangenen kurzen Erörterung das Vorhandensein der benannten Strukturmerkmale hinreichend ableiten lässt, kann davon ausgegangen werden, dass das angeführte Verfahren der strukturierten Fallbesprechung nicht nur als systematische kollegiale Beratung (Intervision) verstanden werden kann, sondern auch einer (Team-) Selbstevaluation gleicht.
5.5 Alternativen und Ergänzungen
Betrachtet man die vorstehenden Ausführungen und die dargestellten Ergebnisse der durchgeführten Interviewbefragungen, so fällt auf, dass Verfahren der Selbstevaluation nur einen kleinen Raum in der großen Bandbreite der denkbaren Reflexionsformen und Strategien zur Qualifizierung beruflicher Praxis einnehmen. Zum anderen sind sie innerhalb dieses Spektrums nicht immer trennscharf abgrenzbar gegenüber anderen Verfahren. Zur Differenzierung von „Qualifizierungstraditionen“ beschreibt von SPIEGEL (1993, 14 ff. und 113 ff.) die Supervision, Organisationsberatung und Evaluation. Alle drei widmen sich den vier Hauptnutzen, welche auch mit der Selbstevaluation verfolgt werden: Kontrolle, Aufklärung, Qualifizierung und Innovation. Gleichzeitig erfasst Selbstevaluation einzelne Elemente der Qualifizierungstraditionen: „Wie in der Supervision geht es um Selbstreflexion und darum, fachlich begründetes und situationsentsprechendes, persönlichkeitsadäquates Handeln zu realisieren. Wie in der Organisationsberatung sollen Fachkräfte Notwendigkeiten der Veränderung erkennen und selbst einleiten. Wie in der Evaluation sollen sie die eigenen Arbeitsprozesse bewerten und optimieren“ (ebd., 125 f.). Die benannten Qualifizierungstraditionen sind demnach verwandt mit der Selbstevaluation, z. B. bezogen auf ihre Intentionen. Sie besitzen aber einen höher entwickelten Stellenwert, an welchen die Bedeutung von Selbstevaluation bislang kaum heranreicht.
Auch in der Wahrnehmung der anlässlich der Leitfaden-Interviews aufgesuchten Fachkräfte spiegeln sich vorwiegend andere – teilweise mit Veränderungsbemühungen verbundene – Maßnahmen der Alltags-/Praxisbewertung wider. Formen der mehr oder weniger strukturierten Reflexion wurden oben (5.1, 5.3) bereits eingehend betrachtet. Darüber hinaus wurde von allen Gesprächspartnern die Supervision benannt, welche ihnen weitaus bekannter und vertrauter erschien: „Ja, wir hätten gern Supervision“ (SA 3). Es gab Supervision. Es ist schwer, Supervisoren für uns zu finden. Also der muss schon eine hohe Qualität haben“ (SA 5). Trotz ihrer anscheinend hohen Popularität wird professionelle Supervision derzeit nur von einer der befragten Fachkräfte in Anspruch genommen. Eine ebenfalls bedeutende Rolle spielen den Aussagen aller Praktiker zufolge Fortbildungen und längerfristige Qualifikationen.
Sie werden regelmäßig genutzt, um die eigenen Fähigkeiten zu festigen und weiterzuentwickeln, aber auch, um sich mit den anderen, meist organisationsfremden Berufskollegen auszutauschen.
Obwohl er die Selbstevaluation auslässt, fasst LIMBRUNNER (1998, 59) die in ihrem Umfeld gelagerten organisationsbezogenen Maßnahmen und Mittel (hier aus dem Blickwinkel der beruflichen Hygiene) zusammen: Supervision, kollegiale Beratung, Teambesprechung, informellen Gedankenaustausch, Fortbildungen etc. Es wird sichtbar, dass es nicht allein Aufgabe von Selbstevaluation ist (und auch nicht sein kann), die Qualität beruflichen Handelns und die Kompetenz der professionell Tätigen zu untersuchen und voranzutreiben. Evident ist jedoch auch, dass die meisten der in diesem Abschnitt erwähnten Maßnahmen – einschließlich Selbstevaluation – sich bei ihrer Umsetzung mitunter kaum unterscheiden lassen, und häufig auch gleichzeitig oder in ihren Elementen verknüpft vollzogen werden. Für die soziale Arbeit bedeutet das sowohl die Notwendigkeit als auch die Chance, ein gegenseitiges Ergänzen derartiger Mittel und Verfahren zuzulassen.
6 Zusammenfassende Schlussbetrachtungen
Mit dem Ziel, die Effektivität und Effizienz sozialer Arbeit zu stabilisieren und weiterzuentwickeln, stellt sich Evaluation oft unerkannt als geeignete Möglichkeit für die Untersuchung und Bewertung sozialer Arbeit dar. Dabei ist der Ansatz der Selbstevaluation für die Praxis besonders interessant, da seine Umsetzung von den Fachkräften selbst initiiert, geplant und vollzogen werden kann, und die Ergebnisse dieses Prozesses direkt in die weitere Arbeit einfließen können. Im Unterschied zur Praxisforschung ist Selbstevaluation deshalb nicht auf die aktive Mitwirkung von Vertretern des Bezugssystems „Wissenschaft“ angewiesen. Sie dient nicht vorrangig der Ermittlung wissenschaftlicher, sondern eher handlungsleitender Erkenntnisse. Insbesondere bei teambezogenen und individuellen Verfahren setzen sich die Praktiker selbst mit dem eigenen beruflichen Handeln auseinander. Damit verbunden wirken sich der vergleichsweise geringe materielle Evaluationsaufwand, die unmittelbare Praxisnähe sowie die zu erwartende höhere Akzeptanz möglicher Praxisveränderungen sehr vorteilhaft aus. Im Hinblick auf die Anwendung von Selbstevaluation kann vom professionellen Sozialarbeiter erwartet werden, über ein grundlegendes Methodenrepertoire zu verfügen, mindestens aber, es sich zugänglich zu machen.
Es wurde versucht, den Ansatz nicht als weiteren Arbeitsbereich, sondern als Bestandteil des täglichen sozialarbeiterischen Handelns darzustellen. Im Rahmen der abstrakten Hilfeprozess-Phasierung erscheint eine (selbst-) evaluative Phase beispielsweise ebenso bedeutsam wie die Anamnese. Gleichzeitig befindet sich Selbstevaluation in einer gegenseitigen Wechselwirkung mit den Elementen professioneller Handlungskompetenz. Obwohl ein Mangel an evaluativen Bemühungen die Qualifikationen und Fähigkeiten eines Sozialarbeiters nicht automatisch in Frage stellt, ist festzuhalten, dass das Praktizieren von Selbstevaluation zur Stärkung professioneller Handlungskompetenz beiträgt und parallel dazu auch als Indiz für sie gewertet werden kann. Es wurde außerdem beschrieben, dass eine explizit formulierte und allgemein gültige Verpflichtung zur Selbstevaluation nicht besteht. Dennoch geht das Erfordernis des systematischen Hinterfragens eigener beruflicher Tätigkeit bereits aus der Verantwortung der Aufgabenträger sozialer Arbeit gegenüber den Klienten hervor. Gestützt wird diese Auslegung von den berufsethischen Standards und den geltenden Rechtsnormen.
Es ist dargelegt worden, dass mit dem Begriff der Selbstevaluation keineswegs die bloße Auswertung des Berufsalltages zu verbinden ist. Stattdessen zeichnet sich der Ansatz durch eine Systematisierung und Strukturierung aus, womit eine klare begriffliche Abgrenzung zu einfachen Formen der Reflexion hergestellt wird. Dazu gehören die im Abschnitt 5.3 aufgestellten Merkmale, im Wesentlichen also ein Evaluationsziel, eine Gegenstands-Formulierung und -Operationalisierung, die Entwicklung angemessener Kriterien sowie die Verwendung von geeigneten Methoden und Instrumenten. Die in den Abschnitten 4.2 und 4.3 angeführten Verfahrensbeispiele aus der Fachliteratur haben ihren Ursprung in den Praxisfeldern der sozialen Arbeit und belegen auch deshalb sehr anschaulich, dass die Erfüllung dieser Bestimmungsmerkmale durchaus möglich ist. Sie machen außerdem folgende Vorzüge von Selbstevaluation sichtbar: Die anzuwendenden Methoden müssen, wie oben (2.4) bereits geschildert, nicht eigens für die Selbstevaluation entwickelt werden, sondern können der Sozialforschung entnommen und den Anforderungen entsprechend angepasst werden. Zweitens liegt der für die Untersuchung und Bewertung des Praxisausschnittes aufzubringende Aufwand in einem erträglichen und vertretbaren Rahmen. Die Verfahren sind u. U. gleichzeitig Hilfen für die Planung und Umsetzung der beruflichen Tätigkeit und lassen sich insbesondere auch deshalb gut in die Hilfeprozesse bzw. Arbeitsabläufe integrieren.
Auf der Grundlage der durchgeführten Interviews mit Fachkräften der – vorwiegend öffentlichen – Jugendhilfe Nordthüringens sollten die vorangegangenen Ausführungen um die Blickwinkel von Praktikern ergänzt werden. Dabei hat sich zunächst herausgestellt, dass die Gesprächspartner der reflexiven Betrachtung eigener Arbeit eine sehr hohe Bedeutung beimessen. Des Weiteren konnten sie verschiedene Reflexionsformen aufzählen. Erwähnt wurden nicht nur Fallbesprechungen, dokumentationsgestützte oder anderweitig instrumentalisierte Vorgehensweisen, sondern vorwiegend auch lockere kollegiale Gespräche, die Kaffeepause und gedankliche Auseinandersetzungen. Aus den Äußerungen der Gesprächspartner ist abzuleiten, dass das Bedürfnis nach Rückfragen, Austauschen und Reflexionen zum Berufsalltag und zu einzelnen Hilfeprozessen, ähnlich wie die wiedergegebene Wahrnehmung von Erfolgen und Misserfolgen, zu einem großen Teil von subjektiven Empfindungen und situativen Anlässen geprägt ist.
Obwohl allen das Hauptthema der vorliegenden Arbeit im Vorfeld mitgeteilt wurde, konnten nur vier Fachkräfte, darunter zwei diplomierte Berufsanfängerinnen, den Begriff Selbstevaluation in seinem weiteren Verständnis umschreiben. Schlussfolgerte man daraus, dass den Befragten das Wesen von Selbstevaluation kaum oder gar nicht bekannt war, könnte dies eine Ursache dafür sein, dass in keiner der aufgesuchten Einrichtungen von einer Umsetzung des Ansatzes berichtet wurde. Wohl aber wurde eingeschätzt, dass regelmäßig wiederkehrende Reflexionsverfahren in strukturierter und systematischer Weise geschehen.
Das Beispiel der Hilfeplanfortschreibung erwähnten vier von fünf Jugendamtsmitarbeitern, im Kinderheim wurde die Auswertung des Entwicklungsverlaufs innerhalb der Erziehungsplanung benannt, und beim Jugendhilfeverein die Förderplanung bei den Jugend-ABM. Für alle drei Arbeitsfelder ließ sich feststellen, dass sich die aufgeführten Vorgehensweisen einer Selbstevaluation stark annähern bzw. ihr sogar gleichen. Dass jedoch eine dahingehende Erörterung nicht prozessbegleitend in den jeweiligen Einrichtungen geschieht, sondern erst nachträglich von dritter Seite, z. B. im Kontext dieser Arbeit, ist ein deutlicher Hinweis darauf, wie gering die Aufmerksamkeit ist, welche der Selbstevaluation und dem Bewusstsein über sie in der Praxis entgegengebracht wird. Das gilt mindestens für die im Rahmen der Leitfadeninterviews besuchten Einrichtungen. Nicht hinreichend geklärt ist, inwiefern man derartige Reflexionsverfahren unbedingt unter dem Titel „Selbstevaluation“ führen muss, um professionelles Handeln auswerten und weiterentwickeln zu können. Man sollte es zumindest deshalb tun, weil durch die bewusste Systematisierung im Sinne oben (3, 5.3) gemachter Ausführungen die Qualifizierung von Reflexionsprozessen selbst maßgeblich gesteigert bzw. kontrolliert werden könnte.
Selbstevaluation bezieht sich auf das eigene professionelle Handeln. Untersuchungs- und Bewertungsgegenstand können neben den Wirkungen bei einzelnen Klienten auch fallübergreifende oder organisationsbezogene Fragestellungen sein. Darauf ausgerichtete selbstevaluative Aktivitäten – ein Beispiel ist die Evaluation der Teamsitzungen (4.2.2) – konnten in den Aussagen der Interviewpartner nicht erkannt werden. Sie fanden daher im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit kaum Berücksichtigung. Trotzdem sollten sie nicht ausgeblendet werden, wenn von Selbstevaluation gesprochen wird.
Wenngleich die Ergebnisse der geführten Leitfadeninterviews nicht repräsentativ für die Situation deutscher Sozialarbeit sein können, ist davon auszugehen, dass in der Praxis sozialer Arbeit, insbesondere in der sozialen Einzelfallhilfe, strukturierte Formen der Reflexion Anwendung finden. Bereits darin spiegelt sich deutlich die Praxisrelevanz von Selbstevaluation wider. Da sie bislang einer Vielzahl von Fachkräften trotzdem gänzlich unbekannt ist, bleibt zu hoffen, dass sie sich, ähnlich wie der Ansatz der Supervision, in den nächsten Jahren weiter etablieren kann.
Quellenverzeichnis
ARMBRUSTER, Jürgen (1998). Praxisreflexion und Selbstevaluation in der Sozialpsychiatrie. Systemische Beiträge zur Methodenentwicklung. Weinheim
BECK, Manfred (1998). Evaluation als Maßnahme der Qualitätssicherung. Tübingen
BEYWL, Wolfgang, BESTVATER, Hanne (1998). Selbst-Evaluation in pädagogischen und sozialen Arbeitsfeldern – Ergänzung und Alternative zur Fremdevaluation. In: Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung e.V. (Hrsg.) (1998). Qualitätssicherung durch Evaluation. Konzepte, Methoden, Ergebnisse – Impulse für die kulturelle Kinder- und Jugendbildung. Remscheid, 33-44
BEYWL, Wolfgang, GEITER, Christiane (2000). Evaluation – Controlling – Qualitätsmanagement in der betrieblichen Weiterbildung. Kommentierte Auswahlbibliographie. 3. Aufl. Bielefeld
BEYWL, Wolfgang, SCHEPP-WINTER, Ellen (2000). Zielgeführte Evaluation von Programmen. Ein Leitfaden. Broschürenreihe QS – Materialien zur Qualitätssicherung in der Kinder- und Jugendhilfe. QS 29. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.)
BMFSFJ = Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (1996). Der „Faktor Vier“ in der Jugendarbeit. In: KABI. Konzertierte Aktion Bundes Innovationen 29
BKE = Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V. (Hrsg.) (1996). Materialien zur Beratung. Bd. 3. Produkt Beratung. Materialien zur outputorientierten Steuerung in der Jugendhilfe. Fürth
BKJ = Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung e.V. (Hrsg.) (1998). Qualitätssicherung durch Evaluation. Konzepte, Methoden, Ergebnisse – Impulse für die kulturelle Kinder- und Jugendbildung. Remscheid
BORTZ, Jürgen, DÖRING, Nicola (1995). Forschungsmethoden und Evaluation. 2., vollst. überarb. u. akt. Aufl. Berlin
DBSH = Deutscher Berufsverband für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Heilpädagogik e.V. (o. J.). Professionell Handeln auf ethischen Grundlagen. Berufsethische Prinzipien des DBSH. Essen
FILSINGER, Dieter, HINTE, Wolfgang (1988). Praxisforschung: Grundlagen, Rahmenbedingungen und Anwendungsbereiche eines Forschungsansatzes. In: HEINER, Maja (Hrsg.) (1988a). Praxisforschung in der sozialen Arbeit. Freiburg i. B., 43-72
FRÜCHTEL, Frank (1995). Evaluierung in der Sozialen Praxis. St. Augustin
GALUSKE, Michael (1999). Methoden der Sozialen Arbeit. Eine Einführung. Weinheim
GEISSLER, Karlheinz A., HEGE, Marianne (1999). Konzepte sozialpädagogischen Handelns. Ein Leitfaden für soziale Berufe. 9., neu ausgestattete Aufl. Weinheim
GROHMANN, Romano (1997). Das Problem der Evaluation in der Sozialpädagogik. Reihe Europäische Hochschulschriften. Frankfurt a. M.
HANSBAUER, Peter, SCHONE, Reinhold (1998). Sozialpädagogische Praxisforschung. In: MERCHEL, Joachim (Hrsg.) (1998). Qualität in der Jugendhilfe. Kriterien und Bewertungsmöglichkeiten. Münster, 371-395
HEINER, Maja (1987). Selbstevaluation: Auf der Suche nach neuen Konzepten. In: Theorie und Praxis der sozialen Arbeit 3/87, 82-92
HEINER, Maja (Hrsg.) (1988a). Praxisforschung in der sozialen Arbeit. Freiburg i. B.
HEINER, Maja (Hrsg.) (1988b). Selbstevaluation in der sozialen Arbeit. Fallbeispiele zur Dokumentation und Reflexion beruflichen Handelns. Freiburg i. B.
HEINER, Maja (1989). Selbstevaluation. Orientierung und Bilanz in der sozialen Arbeit. In: OLK, Thomas, OTTO, Hans-Uwe (Hrsg.) (1989). Soziale Dienste im Wandel. Bd. 2. Entwürfe sozialpädagogischen Handelns. Neuwied, Frankfurt a. M., 169-198
HEINER, Maja (1992). Evaluation und berufliche Handlungskompetenz. In: Blätter der Wohlfahrtspflege – Dt. Zeitschrift für Sozialarbeit 5/92, 123-126
HEINER, Maja (Hrsg.) (1994). Selbstevaluation als Qualifizierung in der Sozialen Arbeit. Fallstudien aus der Praxis. Freiburg i. B.
HEINER, Maja (Hrsg.) (1996). Qualitätsentwicklung durch Evaluation. Freiburg i. B.
HEINER, Maja, MEINHOLD, Marianne, SPIEGEL, Hiltrud von, STAUB-BERNASCONI, Silvia (1998). Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit. 4., erw. Aufl. Freiburg i. B.
HEINER, Maja (1998a). Experimentierende Evaluation. Ansätze zur Entwicklung lernender Organisationen. Weinheim
HEINER, Maja (1998b). (Selbst-)Evaluation zwischen Qualifizierung und Qualitätsmanagement. In: MENNE, Klaus (1998). Qualität in Beratung und Therapie. Evaluation und Qualitätssicherung für die Erziehungs- und Familienberatung. Weinheim, 51-68
HESSE, Marc (1998). Praktikum im Landratsamt Nordhausen, Jugendamt, vom 01.09.1997 bis 03.07.1998. Praktikumsbericht an der Fachhochschule Erfurt, Fachbereich Sozialwesen (unveröffentlichtes Werk)
HÖING, Josef (1988). Strukturierte Verlaufsnotizen als Mittel der Evaluation von Kurzzeit-Gruppentherapien. In: HEINER, Maja (Hrsg.) (1988b). Selbstevaluation in der sozialen Arbeit. Fallbeispiele zur Dokumentation und Reflexion beruflichen Handelns. Freiburg i. B., 140-151
KÄHLER, Ronald (1988). Zielsetzungsprotokolle als Evaluationsverfahren in der ambulanten Beratung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. In: HEINER, Maja (Hrsg.) (1988b). Selbstevaluation in der sozialen Arbeit. Fallbeispiele zur Dokumentation und Reflexion beruflichen Handelns. Freiburg i. B., 152-162
KARBACH, Manfred (2001). Anmerkungen zum Wort Evaluation. http://schulen.hagen.de/GSGE/ew/EvalW.html am 13.03.2001
KARDORFF, Ernst von (1988). Praxisforschung als Forschung der Praxis. In: HEINER, Maja (Hrsg.) (1988a). Praxisforschung in der sozialen Arbeit. Freiburg i. B., 73-100
KNÜPPEL, Helmut, WILHELM, Johann (1987). Die Entwicklung selbstreflexiver Kompetenz in sozialwissenschaftlichen Studiengängen. Eine Feldstudie. Weinheim
KODITEK, Thomas (1997). Voraussetzungen sozialpädagogischer Wirkungsforschung. In: Evaluation der sozialpädagogischen Praxis. Broschürenreihe QS – Materialien zur Qualitätssicherung in der Kinder- und Jugendhilfe. QS 29. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.)
KÖNIG, Joachim (2000), Einführung in die Selbstevaluation. Ein Leitfaden zur Bewertung der Praxis Sozialer Arbeit. Freiburg i. B.
KREFT, Dieter, MIELENZ, Ingrid (Hrsg.) (1996). Wörterbuch soziale Arbeit. Aufgaben, Praxisfelder, Begriffe und Methoden der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. 4., vollst. überarb. und erw. Aufl. Weinheim, Basel
KREFT, Dieter (1996). Handlungskompetenz. In: ders., MIELENZ, Ingrid (Hrsg.) (1996). Wörterbuch soziale Arbeit. Aufgaben, Praxisfelder, Begriffe und Methoden der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. 4., vollst. überarb. und erw. Aufl. Weinheim, Basel, 271-273
KULBACH, Roderich (1996). Qualitätssicherung als Aufgabe der Träger sozialer Dienste. In: Soziale Arbeit 11/96, 367-371
LENZ, Albert, GMÜR, Wolfgang (1996). Qualitätsmanagement in der Beratung. Weiterentwicklung durch Evaluation. In: Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung e.V. (Hrsg.) (1998). Qualitätssicherung durch Evaluation. Konzepte, Methoden, Ergebnisse – Impulse für die kulturelle Kinder- und Jugendbildung. Remscheid, 52-73
LICHTENBERG, Karl Heinz (1999). Selbstevaluation in der Praxis. Ein Tagungsbericht (RAT). Remscheid
LIEBALD, Christiane (1996). Evaluation der kulturellen Kinder- und Jugendarbeit. Broschürenreihe QS – Materialien zur Qualitätssicherung in der Kinder- und Jugendhilfe. QS 1. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.)
LIEBALD, Christiane (1998). Leitfaden für Selbstevaluation und Qualitätssicherung. Broschürenreihe QS – Materialien zur Qualitätssicherung in der Kinder- und Jugendhilfe. QS 19. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.)
LIMBRUNNER, Alfons (1998). Soziale Arbeit als Beruf. Berufsanfang, Wiedereinstieg und Berufsfeldwechsel. Weinheim, Basel
LÜDERS, Christian (1998). Evaluationsforschung in der Kinder- und Jugendhilfe. Perspektiven und Grenzen. In: Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung e.V. (Hrsg.) (1998). Qualitätssicherung durch Evaluation. Konzepte, Methoden, Ergebnisse – Impulse für die kulturelle Kinder- und Jugendbildung. Remscheid, 23-32
LUKAS, Helmut (1996). Aktenführung. In: KREFT, Dieter, MIELENZ, Ingrid (Hrsg.) (1996). Wörterbuch soziale Arbeit. Aufgaben, Praxisfelder, Begriffe und Methoden der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. 4., vollst. überarb. und erw. Aufl. Weinheim, Basel, 26 f.
MEINHOLD, Marianne (1998). Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in der Sozialen Arbeit. Einführung und Arbeitshilfen. 3. Aufl. Freiburg i. B.
MENNE, Klaus (1998). Qualität in Beratung und Therapie. Evaluation und Qualitätssicherung für die Erziehungs- und Familienberatung. Weinheim
MERCHEL, Joachim (1992). Erfolg durch Erfolgskontrolle? in: Blätter der Wohlfahrtspflege – Dt. Zeitschrift für Sozialarbeit 9/92, 236-238
MITTAG, Waldemar, HAGER, Willi (1998). Entwurf eines integrativen Konzepts zur Evaluation pädagogisch-psychologischer Interventionen. In: BECK, Manfred (1998). Evaluation als Maßnahme der Qualitätssicherung. Tübingen, 13-40
MOSER, Heinz (1995). Grundlagen der Praxisforschung. Freiburg i. B.
MOSER, Heinz (1998). Instrumentenkoffer für den Praxisforscher. 2., erw. Aufl. Freiburg i. B.
MOSER, Heinz (1999). Selbstevaluation. Einführung für Schulen und andere soziale Institutionen. Zürich
MÜLLER, Burkhard (1997). Sozialpädagogisches Können. Ein Lehrbuch zur multiperspektivischen Fallarbeit. 3. Aufl. Freiburg i. B.
MÜLLER, C. Wolfgang (1988). Achtbare Versuche. Zur Geschichte von Praxisforschung in der sozialen Arbeit. In: HEINER, Maja (Hrsg.) (1988a). Praxisforschung in der sozialen Arbeit. Freiburg i. B., 17-33
MÜLLER, C. Wolfgang (1996). Evaluierung. In: KREFT, Dieter, MIELENZ, Ingrid (Hrsg.) (1996). Wörterbuch soziale Arbeit. Aufgaben, Praxisfelder, Begriffe und Methoden der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. 4., vollst. überarb. und erw. Aufl. Weinheim, Basel, 189 f.
SA 1 = Aufzeichnung eines Interviews mit einer Diplom-Sozialpädagogin bei einem Jugendhilfeverein, geführt am 05.04.2001 im Landkreis Nordhausen, Nordthüringen
SA 2 = Aufzeichnung eines Interviews mit einer Diplom-Sozialpädagogin bei einem Jugendamt (1), Sachgebiet Sozialer Dienst, geführt am 17.04.2001 in Nordthüringen
SA 3 = Aufzeichnung eines Interviews mit einer Sozialarbeiterin bei einem Jugendamt (2), Sachgebiet Sozialer Dienst, geführt am 18.04.2001 in Nordthüringen
SA 4 = Aufzeichnung eines Interviews mit einem Sozialarbeiter bei einem Jugendamt (2), Sachgebiet Sozialer Dienst, geführt am 18.05.2001 in Nordthüringen
SA 5 = Aufzeichnung eines Interviews mit dem Leiter eines Kinder- und Jugendheims, geführt am 02.05.2001 in Nordhausen, Nordthüringen
SA 6 = Aufzeichnung eines Interviews mit dem Leiter eines Jugendamtes (3), geführt am 03.05.2001 in Nordthüringen
SA 7 = Aufzeichnung eines Interviews mit der Leiterin des Sachgebietes Allgemeiner Sozialer Dienst eines Jugendamtes (3), geführt am 03.05.2001 in Nordthüringen
SPIEGEL, Hiltrud von (1993). Aus Erfahrung lernen. Qualifizierung durch Selbstevaluation. Münster
SPIEGEL, Hiltrud von (1997). Perspektiven der Selbstevaluation. In: MÜLLER-KOHLENBERG, Hildegard u. a. (1997). Evaluation der sozialpädagogischen Praxis. Broschürenreihe QS – Materialien zur Qualitätssicherung in der Kinder- und Jugendhilfe. QS 11. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.), 32-48
SPIEGEL, Hiltrud von (1998a). Selbstevaluation – Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung „von unten”. In: MERCHEL, Joachim (Hrsg.) (1998). Qualität in der Jugendhilfe. Kriterien und Bewertungsmöglichkeiten. Münster, 351-371
SPIEGEL, Hiltrud von (1998b). Arbeitshilfen für das methodische Handeln. In: HEINER, Maja, MEINHOLD, Marianne, SPIEGEL, Hiltrud von, STAUB-BERNASCONI, Silvia (1998). Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit. 4., erw. Aufl. Freiburg i. B., 254-322
TEXTOR, Martin R. (Hrsg.) (1994). Allgemeiner Sozialdienst. Ein Handbuch für soziale Berufe. Weinheim, Basel
Uni Köln = Universität zu Köln. Arbeitsstelle für Evaluation pädagogischer Dienstleistungen (2000). http://www.uni-koeln.de/ew-fak am 26.09.00
Univation e.V. (2001). http://www.univation.org am 05.02.01
WENZEL, Ludwig (1994). Selbstevaluation von Teamsitzungen in einem Stadtteilprojekt. In: HEINER, Maja (Hrsg.) (1994). Selbstevaluation als Qualifizierung in der Sozialen Arbeit. Fallstudien aus der Praxis. Freiburg i. B., 211-223
WOTTAWA, Heinrich, THIERAU, Heike (1990). Lehrbuch Evaluation. Bern
Anhang
1 Interviewleitfaden
(Eröffnungsphase)
A) Allgemeine Fragen zum Arbeitsplatz
- Mit welchen Aufgaben beschäftigt sich Ihr Träger/Ihre Einrichtung/Ihre Abteilung?
- Wie viele Kollegen haben Sie?
- Wie ist das Team, in welchem Sie arbeiten, zusammengesetzt?
- Was haben Sie gemacht, bevor Sie für diese Einrichtung gearbeitet haben?
- Welche Tätigkeiten üben Sie aus? (Was sind die Schwerpunkte Ihrer Arbeit? Wofür verwenden Sie die meiste Zeit/den größten Aufwand?)
B) Effekte und Dokumentation von sozialer Arbeit
- Was sind für Sie Erfolge?
- Was sind für Sie Misserfolge?
- Wie würden Sie die Effekte der sozialarbeiterischen Tätigkeit beschreiben?
- Glauben Sie, dass man die Effekte von sozialer Arbeit messen kann?
- Auf welche Weise werden die Hilfeprozesse und die Arbeitsergebnisse innerhalb Ihrer Einrichtung dokumentiert?
- Nutzen Sie selbst eigene Instrumente für Dokumentations- und Auswertungszwecke?
C) Bedeutung von Reflexion
- Wenn Sie einmal Ihr eigenes Handeln betrachten, denken Sie häufig über die Auswirkungen Ihrer beruflichen Tätigkeit, z.B. auf die Klienten, nach?
- Wie könnte man Ihrer Meinung nach seine eigene berufliche Tätigkeit reflektieren – sachbezogen, fallbezogen, fallübergreifend?
- Welchen Stellenwert hat eine solche Reflexion aus Ihrer Sicht für die soziale Arbeit?
D) Ausprägung von Praxisreflexion
- In welcher Form praktizieren Sie und Ihre Kollegen eine Praxisreflexion?
- Werden dabei spezielle Methoden verwendet? (Greifen Sie auf bestimmte Instrumente zurück, die immer wieder verwendet werden?)
- Wirken sich die Ergebnisse von prozessbegleitenden oder nachträglichen Betrachtungen zur fallbezogenen oder fallübergreifenden Tätigkeit direkt oder mittelbar auf die weitere Arbeit aus?
E) Konfrontation mit Selbstevaluation
- Kennen Sie den Begriff „Selbstevaluation“?
- Selbstevaluation ist ... systematisches, methodengeleitetes Reflektieren, Untersuchen, Bewerten des eigenen Handelns und dessen Auswirkungen, wobei man zum einen Erkenntnisse gewinnen, zum anderen eine Praxisveränderung erreichen kann ...
- Haben Sie sich schon einmal mit dem Thema Selbstevaluation beschäftigt? Wie?
- Kennen Sie Praxisbeispiele für Selbstevaluation?
- Wo sehen Sie die Stärken dieses Ansatzes? Wo die Schwächen?
- Was begünstigt aus Ihrer Sicht selbstevaluative Vorgänge?
- Verwenden Sie selbst bzw. Ihr Team Methoden oder Instrumente, die in ähnlicher Form den gleichen Zweck erfüllen, lediglich anders bezeichnet werden?
F) Alternativen und Ergänzungen zur Selbstevaluation
- Was trägt außer Selbstevaluation zur (positiven) Praxisveränderung bei?
- Was außer Selbstevaluation zielt ab auf Erfolgskontrolle, Aufklärung, Qualifizierung und Innovation?
- Was fördert außerdem die „berufliche Hygiene“?
(Abschlussphase)
2 Auflistung der Interviewpartner
Interviewpartner 1: Diplom-Sozialpädagogin
Arbeitsfeld: Jugendgerichtshilfe und Jugendberufshilfe bei freiem Träger
Arbeitsschwerpunkte: Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe; sozialpädagogische Begleitung von Jugend-ABM; Berufswahlvorbereitung
Interviewpartner 2: Diplom-Sozialpädagogin
Arbeitsfeld: Jugendamt 1, Sachgebiet Sozialer Dienst
Arbeitsschwerpunkte: Beratung zu Erziehung, Trennung, Umgang; Hilfen zur Erziehung; Familiengerichtshilfe; Jugendgerichtshilfe
Interviewpartner 3: Sozialarbeiterin
Arbeitsfeld: Jugendamt 2, Sachgebiet Sozialer Dienst
Arbeitsschwerpunkte: Adoptionsvermittlung und Pflegekinderwesen
Interviewpartner 4: Sozialarbeiter
Arbeitsfeld: Jugendamt 3, Sachgebiet Sozialer Dienst
Arbeitsschwerpunkte: Beratung zu Erziehung, Trennung, Umgang; Hilfen zur Erziehung; Familiengerichtshilfe
Interviewpartner 5: Diplom-Psychologe
Arbeitsfeld: stationäre Jugendhilfeeinrichtung (Kinderheim), freier Träger
Arbeitsschwerpunkte: Heimleitung im pädagogischen Bereich
Interviewpartner 6: Sozialarbeiter, Verwaltungswirt
Arbeitsfeld: Jugendamt 3
Arbeitsschwerpunkte: Amtsleitung; gelegentlich Übernahme und Bearbeitung von Einzelfällen aus dem Sachgebiet Allgemeiner Sozialer Dienst
Interviewpartner 7: Sozialarbeiterin
Arbeitsfeld: Jugendamt 3, Sachgebiet Allgemeiner Sozialer Dienst
Arbeitsschwerpunkte: Sachgebietsleitung; Leitung einer Jugendamts-Außenstelle
[...]
[1] valere (lateinisch): bei Kräften sein, wert sein
[2] Wird die Auffassung vertreten, dass die Fachkraft sowohl Evaluator und Evaluationsgegenstand ist (z. B. bei individueller Selbstevaluation), so muss die Fachkraft einschließlich und besonders im Hinblick auf ihr professionelles Handeln und dessen Auswirkungen gemeint sein.
[3] MÜLLER bezieht sich in seinen Ausführungen auf die Evaluation des eigenen beruflichen Handelns, also unter anderem auch auf Selbstevaluation.
[4] MÜLLER verwendet „Evaluationsinstrumente“ in diesem Kontext synonym für „Evaluationsmethoden“.
[5] Auf den Bezug zum Diskurs um den Professionalisierungsgrad der sozialen Arbeit wird an dieser Stelle verzichtet. Es wird davon ausgegangen, dass soziale Arbeit in diesem Kontext Merkmale einer Profession (u. a. Wissenschaftlichkeit, Selbstkontrolle) besitzt.
[6] Die Effizienz des Ressourceneinsatzes wird in der öffentlichen (Sozial-) Verwaltung u. a. auch schon durch Handlungsgrundsätze wie „Verhältnismäßigkeit der Mittel“ und „Übermaßverbot“ gefordert.
[7] Die bei B. MÜLLER beschriebene „Evaluation“ ist im Kontext seiner Ausführungen und nach dem vom Verfasser im Kapitel 2 dargestellten Begriffsverständnis weitgehend mit Selbstevaluation gleichzusetzen.
[8] KÖNIG (2000, 62) misst den „vorrangigen“ Zielen Priorität bei. Er beschreibt Vorrangigkeit als Produkt aus Dringlichkeit und Wichtigkeit.
[9] Der Modalwert ist der bei einer Frage am häufigsten eingetragene Wert. Beispiel: 4 wäre der Modalwert bei den Nennungen 3, 3, 5, 1, 2, 4, 4, 4, 2, 4, 2, 4, 4. Der Mittelwert (Durchschnittswert) wäre 3,2.
[10] Alle Personennamen wurden vom Verfasser geändert.
[11] Alle Personennamen wurden vom Verfasser geändert.
[12] Es ist anzumerken, dass bereits das Setting einer strukturierten mündlichen Befragung zu ungenauen und indifferenten Einschätzungen der Interviewpartner beigetragen haben kann.
[13] Auf diese Weise wird MÜLLERs Intention begünstigt, dem Leser das Praktizieren von Evaluation als integriertes Element sozialpädagogischer Fallarbeit nahe zu legen.
[14] Gespräche sollten m.E. eher als Verfahren, nicht als Instrumente betrachtet werden. Es handelt sich beim Gespräch um eine Situation, in der Interaktionen, kommunikative Tätigkeiten stattfinden. Ein Bericht ist ein Instrument, also ein professionell handhabbares Werkzeug, das Schreiben hingegen ist keines.
[15] Da in diesem Kontext vornehmlich Art und Weise der systematischen Reflexion von Interesse sind, wird auf die eingehende Darstellung des komplexen Hilfeplanverfahrens und -prozesses verzichtet.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Selbstevaluation in der sozialen Arbeit?
Selbstevaluation in der sozialen Arbeit ist ein systematischer Prozess, bei dem Fachkräfte ihr eigenes berufliches Handeln und dessen Auswirkungen untersuchen und bewerten. Ziel ist es, Erkenntnisse zu gewinnen und die Praxis zu verbessern.
Wie unterscheidet sich Selbstevaluation von anderen Evaluationsformen?
Im Gegensatz zu externen oder internen Evaluationen, bei denen externe Experten oder interne Mitarbeiter die Bewertung vornehmen, wird die Selbstevaluation von den Fachkräften selbst durchgeführt. Dies ermöglicht eine direktere und praxisnahe Reflexion.
Welche Vorteile bietet Selbstevaluation?
Selbstevaluation bietet mehrere Vorteile, darunter: unkomplizierterer Zugang zu Informationen, höhere Akzeptanz und Transparenz, Effizienzsteigerung, Kosteneinsparungen und Förderung der beruflichen Identität.
Welche Schritte sind bei der Umsetzung von Selbstevaluationsvorhaben zu beachten?
Ein allgemeines Planungsschema für Selbstevaluation umfasst: Ziele festlegen, Rahmenbedingungen klären, Gegenstand bestimmen, Gegenstand operationalisieren, Bewertungskriterien entwickeln, Informationsquelle auswählen, Methoden entwickeln, Daten erheben und auswerten, Qualität der Ergebnisse beurteilen und Ergebnisse verwerten.
Welche Methoden können bei der Selbstevaluation eingesetzt werden?
Es gibt verschiedene Methoden, die bei der Selbstevaluation eingesetzt werden können, darunter strukturierte Verlaufsnotizen, Evaluation von Teamsitzungen mithilfe von Schätzskalen, Netzwerkanalyse und Zielsetzungsprotokollierung.
Welche Rolle spielt die Reflexion in der sozialen Arbeit?
Reflexion spielt eine zentrale Rolle in der sozialen Arbeit. Sie ermöglicht es Fachkräften, ihr eigenes Handeln zu hinterfragen, ihre Kompetenzen zu erweitern und die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern.
Wie kann Selbstevaluation als Bestandteil sozialpädagogischer Fallarbeit verstanden werden?
Selbstevaluation kann als eine zusätzliche Phase im Hilfeprozess betrachtet werden, die nach Anamnese, Diagnose und Intervention folgt. Sie dient dazu, den Hilfeprozess systematisch zu reflektieren und auszuwerten.
Gibt es eine Verpflichtung zur Selbstevaluation in der sozialen Arbeit?
In Deutschland gibt es keine allgemein gültige und verbindliche gesetzliche Verpflichtung zur Selbstevaluation. Allerdings kann ihre Notwendigkeit in einigen Arbeitsfeldern aus dem geltenden Recht abgeleitet werden.
Welche Dimensionen sozialpädagogischer Handlungskompetenz werden durch Selbstevaluation gefördert?
Selbstevaluation kann die instrumentelle, reflexive und soziale Kompetenz von Fachkräften in der sozialen Arbeit fördern.
Wie kann die Qualität der Ergebnisse von Selbstevaluation beurteilt werden?
Die Qualität der Ergebnisse kann anhand von Kriterien wie Angemessenheit der angewandten Methoden, Realisierbarkeit des Vorhabens, Regelgeleitetheit der Vorgehensweise, Gültigkeit der Erkenntnisse und Verwertbarkeit der Ergebnisse für die Praxis beurteilt werden.
Welche Rolle spielen Zielvereinbarungen in Selbstevaluationsprozessen?
Zielvereinbarungen dienen als Bezugspunkt, anhand dessen die eigene Arbeit im Selbstevaluationsprozess gemessen werden kann. Die Zielerreichungskontrolle im Hilfeplanverfahren ist ein praktisches Beispiel dafür, wie diese Zielvereinbarungen eingesetzt werden können.
Welche Hindernisse gibt es bei der Umsetzung von Selbstevaluation in der sozialen Arbeit?
Zu den möglichen Hindernissen zählen Zeitmangel, mangelnde Ressourcen, fehlende Unterstützung durch die Organisation und Widerstand gegen Veränderungen.
Wie kann Selbstevaluation im Arbeitsalltag integriert werden?
Sie kann durch die Schaffung von Freiräumen für Reflexion, die Bereitstellung von Ressourcen und die Förderung einer Kultur der Offenheit und des Lernens im Team integriert werden.
Was ist das Ziel der Praxisforschung im Kontext der sozialen Arbeit und wie unterscheidet sich das von der Selbstevaluation?
Praxisforschung zielt im Wesentlichen auf die Erforschung sozialer Probleme, die Untersuchung der sozialen Arbeit und die Erforschung der Effekte sozialer Arbeit ab. Im Unterschied zur Selbstevaluation sind hier aber auch sozialwissenschaftliche Aspekte relevant.
Inwieweit wird der Datenschutz im Bereich der Selbstevaluation in der sozialen Arbeit berücksichtigt?
Der Datenschutz ist im Bereich der Selbstevaluation essenziell. Alle Daten müssen anonymisiert und vertraulich behandelt werden. Auch gilt es ethische Grenzen zu berücksichtigen.
Was bedeutet der Begriff Methodenbegriff im Kontext der Selbstevaluation?
Der Methodenbegriff bezeichnet die begründete Vorgehensweise, mit welcher ein Selbstevaluationsvorhaben vollzogen wird. Diese sind Bestandteil des Evaluationsverfahrens und haben ihren Ursprung in der qualitativen und quantitativen empirischen Sozialforschung.
- Citation du texte
- Marc Hesse (Auteur), 2001, Die Anwendung von Selbstevaluation in der sozialen Praxis. Grundlagen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111209