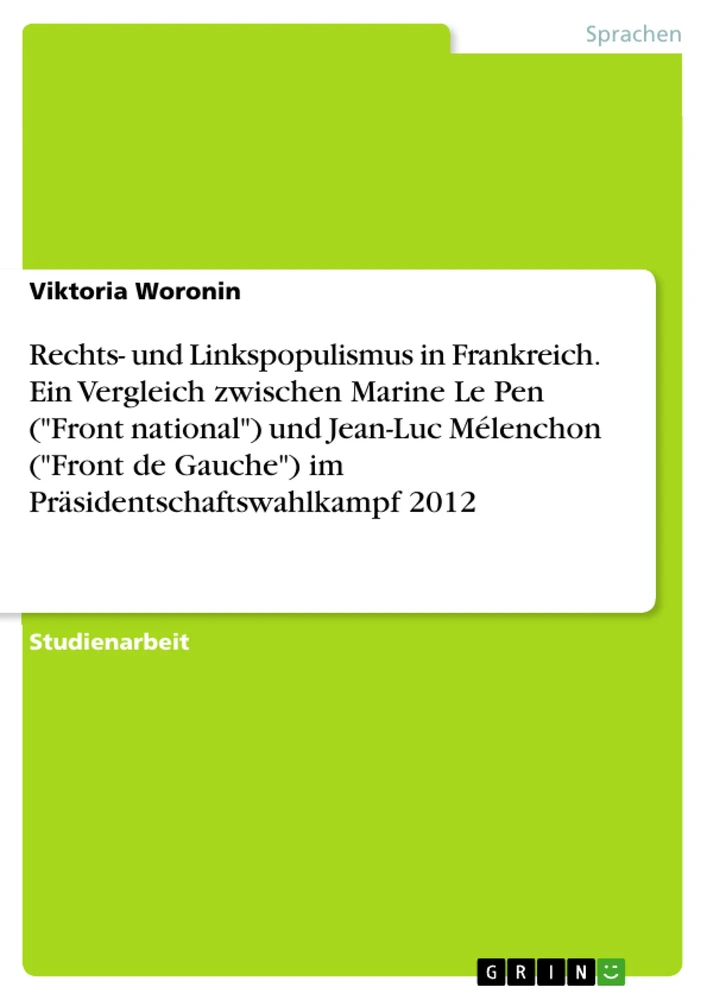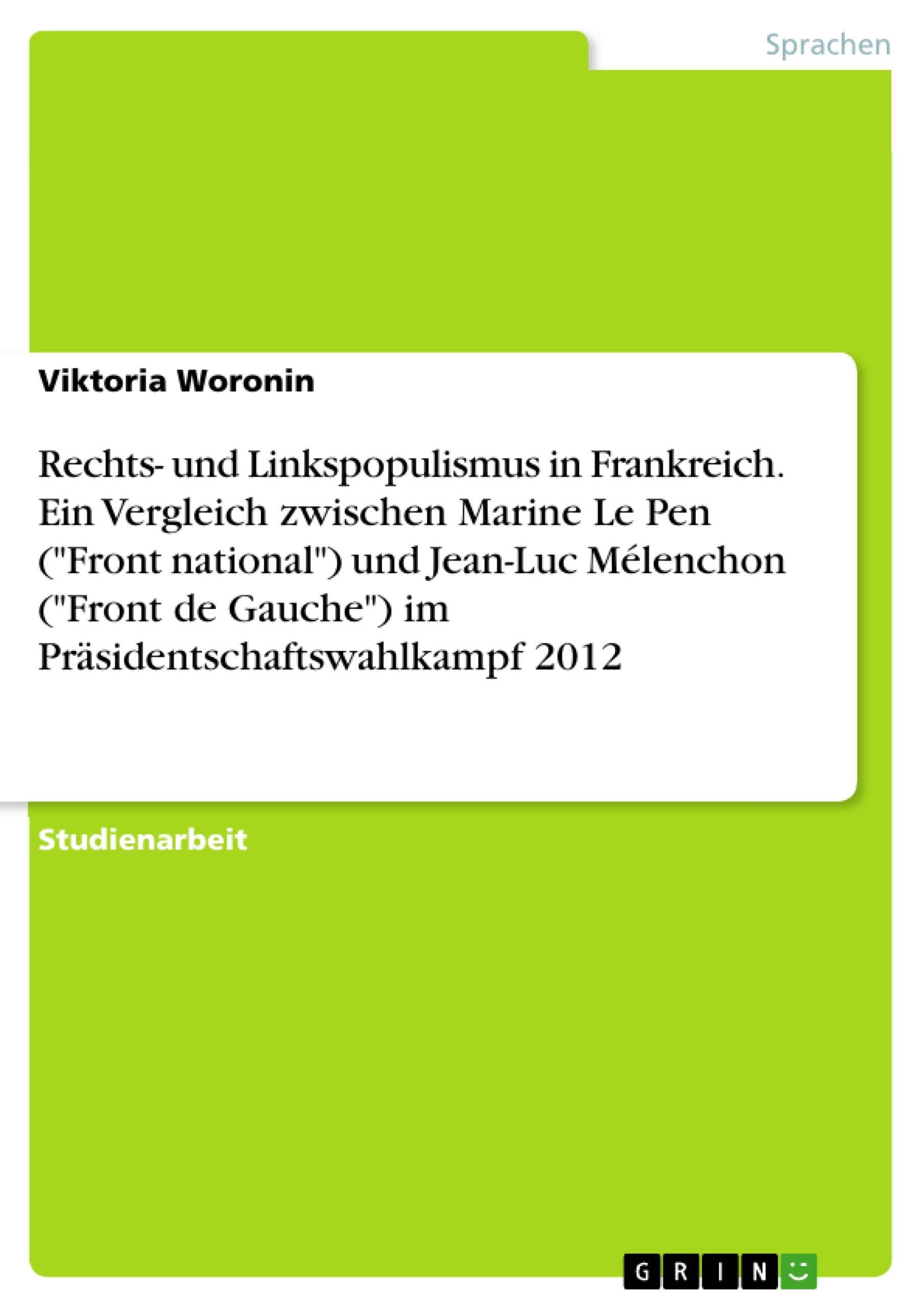Diese Hausarbeit untersucht, inwiefern es Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen rechts- und linkspopulistischen Diskursen in Frankreich gibt. Untersucht werden jeweils eine Rede von Marine Le Pen und Jean-Luc Mélenchon aus dem Präsidentschaftswahlkampf 2012.
Im Jahr 2002 schrieb die renommierte Populismusforscherin Margaret Canovan noch, dass eine sporadische Zunahme populistischer Bewegungen in vielen etablierten Demokratien festzustellen sei. 19 Jahre später sind rechts- wie linkspopulistische Parteien und Bewegungen in Europa omnipräsent geworden. Es gilt als Konsens, dass Populismus sich in liberalen Demokratien verbreitet und die Erklärungen dafür mannigfaltig sind. Taggart zufolge ist die starke Zunahme an rechtspopulistischen Parteien zu einer zentralen Eigenschaft gegenwärtiger europäischer Parteienpolitik geworden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Rahmen
- Definition von Populismus
- Schwierigkeiten
- Zentrale Aspekte von Populismus
- Populismus in Westeuropa
- Rechts- und Linkspopulismus in Frankreich
- Kontext: Präsidentschaftswahl 2012 in Frankreich
- Definition von Populismus
- Methodische Vorgehensweise
- Analyse
- Rede von Marine Le Pen am 5. Januar 2012, Voeux à la presse
- Rede von Jean-Luc Mélenchon am 4. Januar 2012, Vœux 2012 de Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de Gauche
- Vergleich der Reden
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen rechts- und linkspopulistischen Diskursen in Frankreich anhand von Reden von Marine Le Pen und Jean-Luc Mélenchon aus dem Präsidentschaftswahlkampf 2012. Das Ziel ist es, herauszufinden, inwiefern sich die Diskurse dieser beiden prominenten Figuren im Hinblick auf die Charakteristika von Populismus ähneln oder unterscheiden.
- Definition und Charakteristika von Populismus
- Verbreitung von Populismus in Westeuropa
- Rechts- und Linkspopulismus in Frankreich
- Analyse von Reden von Marine Le Pen und Jean-Luc Mélenchon
- Vergleich der Reden im Hinblick auf populistische Elemente
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen rechts- und linkspopulistischen Diskursen in Frankreich vor und erläutert die Relevanz der Fragestellung. Der theoretische Rahmen definiert Populismus und beleuchtet die Verbreitung von populistischen Bewegungen in Westeuropa sowie die Besonderheiten von Rechts- und Linkspopulismus in Frankreich. Die methodische Vorgehensweise beschreibt die Analyse von Reden von Marine Le Pen und Jean-Luc Mélenchon aus dem Präsidentschaftswahlkampf 2012. Die Analyse selbst befasst sich mit den jeweiligen Reden der beiden Politiker und untersucht sie auf populistische Elemente. Abschließend erfolgt ein Vergleich der Reden, um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Diskursen hervorzuheben.
Schlüsselwörter
Populismus, Rechtspopulismus, Linkspopulismus, Frankreich, Präsidentschaftswahl 2012, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Front National, Front de Gauche, Antielitismus, Volksbegriff, Medienpräsenz.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zentralen Merkmale von Populismus?
Zentrale Aspekte sind Antielitismus, die Berufung auf ein „wahres Volk“ und oft eine starke Medienpräsenz der Führungspersonen.
Wie unterscheiden sich Le Pen und Mélenchon im Wahlkampf 2012?
Die Arbeit vergleicht Marine Le Pen (Rechtspopulismus) und Jean-Luc Mélenchon (Linkspopulismus) hinsichtlich ihrer diskursiven Strategien und populistischen Elemente.
Was ist der „Front de Gauche“?
Es ist das politische Bündnis, für das Jean-Luc Mélenchon im französischen Präsidentschaftswahlkampf 2012 antrat.
Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Rechts- und Linkspopulismus?
Ja, beide nutzen oft eine ähnliche Rhetorik gegen das politische Establishment, unterscheiden sich aber in ihren ideologischen Kernbotschaften und Feindbildern.
Warum ist Populismus in Westeuropa so präsent?
Laut Forschung verbreitet sich Populismus besonders in liberalen Demokratien als Reaktion auf wirtschaftliche oder kulturelle Krisen und die gefühlte Entfremdung von den Eliten.
- Citation du texte
- Viktoria Woronin (Auteur), 2021, Rechts- und Linkspopulismus in Frankreich. Ein Vergleich zwischen Marine Le Pen ("Front national") und Jean-Luc Mélenchon ("Front de Gauche") im Präsidentschaftswahlkampf 2012, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1113093