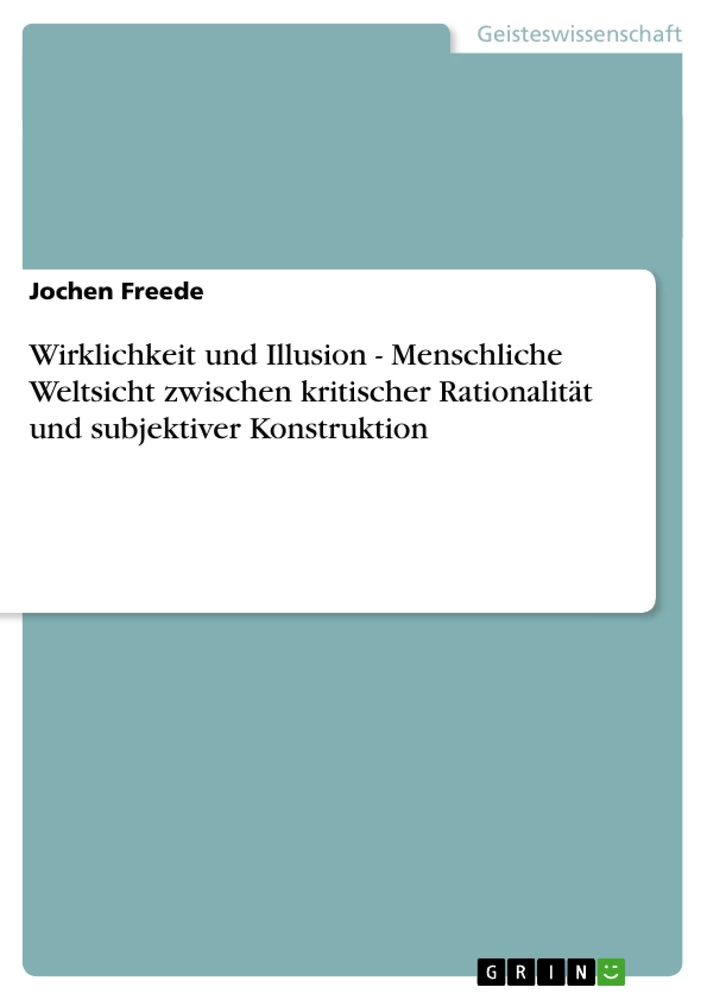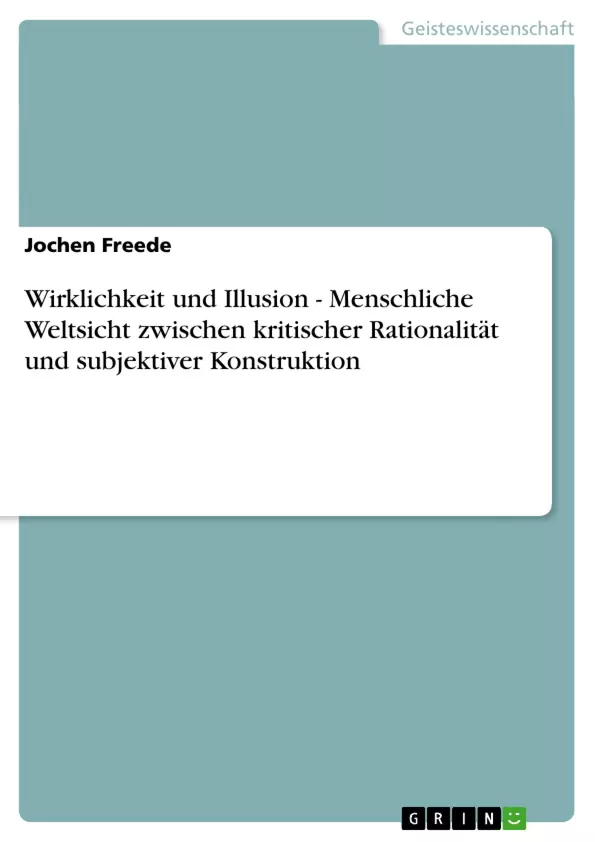Der Teil unserer Umwelt, welchen wir Menschen mit unseren Sinnen erfassen können, entspricht keineswegs – wie oft angenommen wird – der Wirklichkeit. Unser Weltbild ist nur unser Bild von der Welt und somit strenggenommen nichts anderes als ein Gedanke. Gibt es „Wirklichkeit“ nur relativ zu unseren Begriffen und sprachlichen Ausdrucksformen oder existieren Dinge auch unabhängig von unserem Denken? Wieso kommen wir trotz der Trugbilder einer subjektiven Schein-Realität, welche uns die menschliche Wahrnehmung vermittelt, im Alltagsleben ganz gut zurecht?
Wie funktioniert menschliches Erleben und Denken? Können wir mit Hilfe des Verstandes sicheres Wissen, also objektive Erkenntnis erlangen? Ist das, was wir genau zu wissen glauben, Wahrheit? Denken und handeln wir realitätsnah? Wie natürlich ist schließlich unsere Moral und die daraus resultierende Ethik?
Mit einer allgemein verständlichen Darstellung erkenntnistheoretischer Grundprobleme und anschließender Diskussion wesentlicher Sinnfragen des Lebens soll der philosophisch und naturwissenschaftlich interessierte Leser angesprochen werden. Das Buch möchte zum Nachdenken über einige Selbstverständlichkeiten unserer scheinbar so realen Welt anregen.
Inhalt
Hinweise zum Gebrauch des Textes
1. Einige Worte zuvor
2. Schon die alten Griechen ...
3. Grundfragen
3.1. In welchem Maß entsprechen unsere Vorstellung und unser Wissen von der Welt der Wirklichkeit?
3.1.1. Was ist Wissen?
3.1.2. Was ist Wahrheit?
3.1.3. Gibt es eine Außenwelt oder wie wirklich ist die Wirklichkeit?
3.2. Wie natürlich ist unsere Moral und die daraus resultierende Ethik?
3.3. Wie realitätsbezogen sind unsere menschlichen Hoffnungen, Wünsche und der religiöse Glaube?
3.4. Gibt es einen Lebenssinn?
4. Perspektiven
4.1. Manchmal ist weniger mehr
4.2. Ich sehe was, was du nicht siehst ...
4.3. Der Trost des religiösen Glaubens und die Nützlichkeit wissenschaftlicher Hypothesen.
4.4. Ohne Alternative: Der kritische Gebrauch der Vernunft.
5. Glossar
6. Verzeichnis der Abbildungen
7. Literatur- und Quellenangaben
8. Personenregister
9. Sach- und Stichwortverzeichnis
Hinweise zum Gebrauch des Textes
Fremdwörter und nicht in der Alltagssprache verwendete Begriffe werden – sofern sie nicht im Textzusammenhang erklärt werden – noch einmal gesondert im Kap.5 erläutert.
Ein Verzeichnis der Abbildungen befindet sich in Kap.6.
Den Zitaten vor den einzelnen Kapiteln sind die Bilder bzw. Fotos derjenigen Persönlichkeiten zugeordnet, von denen die Zitate stammen.
Textstellen aus den Werken anderer Autoren werden durch „Anführungszeichen“ gekennzeichnet. Ausdrücke oder Zitate nicht deutscher Sprache sind zusätzlich kursiv gedruckt. Dabei wird möglichst immer ein Hinweis auf den Ursprung des Zitates oder die verwendete Literatur gegeben (Kap.7).
Die im Text genannte Personen finden sich im Kap.8 mit der entsprechenden Seitenangabe. Bei der ersten Nennung einer Persönlichkeit wird im Text jeweils das Geburts- und Todesjahr (soweit bekannt) in Klammern hinter den Namen gesetzt.
Im Text vorkommende wichtige Begriffe finden sich mit entsprechender Seitenangabe im Kap.9.
Abkürzungen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] Wir lassen nie vom Suchen ab,
und doch, am Ende allen unseren Suchens
sind wir am Ausgangspunkt zurück
und werden diesen Ort zum ersten Mal erfassen.
Thomas Stearns Eliot (1888-1965)
1. Einige Worte zuvor
Der an den Sinnfragen des Lebens interessierte kritische Leser soll bei der Lektüre dieses Buches in verständlicher Sprache mit der Problematik subjektiver Wahrnehmungsfähigkeit und menschlichen Erkenntnisvermögens konfrontiert und mit den diesbezüglichen Ergebnissen biologisch-medizinischen, psychologischen und philosophischen Forschens vertraut gemacht werden. Der Autor möchte deutlich machen, wie subjektiv und individuell die Weltsicht jedes einzelnen Menschen ist. Anhand vieler Beispiele wird gezeigt, dass die Umwelt „in Wirklichkeit“ wohl ganz anders ist, als wir sie mit den Sinnen wahrnehmen.
Der Begriff „Wirklichkeit“ beinhaltet je nach Standpunkt eine Anzahl verschiedener Bedeutungen (J. Hoffmeister, 1955; G. Schischkoff, 1991). Der deutsche Ausdruck wurde von dem Mystiker Johann Eckhart (um 1260-1327) als Übersetzung des lateinischen Wortes actualitas geprägt, also dessen was wirkt, bzw. wirksam geworden ist, damit ins Dasein tritt und existiert. So enthält das Wort im deutschen Sprachgebrauch als wesentlichen Anteil die „Wirksamkeit“ oder das „Wirken“, wogegen „Wirklichkeit“ im Altgriechischen (alethea) und Lateinischen (res verae, verum, veritas) eher mit „Wahrheit“, im Französischen (realité) und im Englischen (reality) mit „Realität“ übersetzt wird. Im Deutschen unterscheidet sich die Wahrheit von der Wirklichkeit dadurch, dass sie an die Evidenz (lat. evidens = herausscheinend), also das Augenscheinliche und Einleuchtende gebunden ist, nicht an das Wirken. Die Realität hebt sich von der Wahrheit dadurch ab, dass sie auch das Mögliche enthält. So steht die Wirklichkeit im philosophischen Sprachgebrauch sowohl im Gegensatz zum bloß Scheinbaren als auch zum bloß Möglichen. Mit reiner Vorstellung oder Einbildung hat Wirklichkeit im Sprachgebrauch eigentlich nichts zu tun. Sollte dies aber dennoch der Fall sein, spricht man im allgemeinen von Schein, Täuschung oder Illusion (lat. illusio). Dass aber im täglichen Leben Wirklichkeit und Illusion selten einer strengen Trennung unterliegen, die Begriffe nicht nur gelegentlich verwechselt werden und nicht selten Täuschungen für Tatsachen, Schein für objektiv Seiendes gehalten wird, soll in diesem Buch dargestellt werden.
Der vorliegende Text soll erstens deutlich machen, was Menschen auf den ersten Blick oftmals unter „Wirklichkeit“ verstehen, und zweitens zeigen, wie weit entfernt diese Alltagsvorstellung von objektiver Realität ist. Dabei ergeben sich mancherlei Fragen: Ist uns überhaupt objektive Erkenntnis, sicheres Wissen über die Welt mit Hilfe von Wahrnehmung und Verstand möglich? Ist Erkenntnis ein Gegenstand der Philosophie oder der Naturwissenschaften? Ist das, was wir zu wissen glauben, tatsächlich wahr? Oder machen wir uns Illusionen und konstruieren lediglich eine subjektive Schein-Wirklichkeit? Haben Moral und Ethik etwas mit vorgegebener Natürlichkeit zu tun oder sind auch sie Produkte menschlichen Erfindungsgeistes? Orientieren sich unsere verschiedenen Glaubenssysteme und Religionen an der Wirklichkeit oder sind sie nur Bezugspunkte für menschliche Ängste und Hoffnungen? Bestimmen Tatsachen oder Wunschdenken unser Weltbild? Und schließlich: wie beantworte ich mit den gewonnenen Erkenntnissen die Sinnfrage meines eigenen Lebens?
Unter den Oberbegriffen „Erkenntnistheorie“ (bzw. „Epistemologie“ oder „Gnoseologie“) und „Kognitionswissenschaft“ gibt es für Fach-Philosophen und Naturwissenschaftler eine große Anzahl von Arbeiten, welche sich mit den oben angesprochenen Fragen beschäftigen. Oft sind diese Veröffentlichungen umfangreich und aufgrund der Kompliziertheit der angesprochenen Thematik für „Normalbürger“ und „Hobby-Philosophen“ recht schwer zu lesen. Hier möchte das vorliegende Buch mit dem Bemühen um eine verständliche Ausdrucksweise und durch die Beschränkung auf Wesentliches eine Lücke schließen. Fremdwörter und Fachbegriffe werden im Anhang (Kap. 5) noch einmal gesondert erklärt.
In der Erkenntnistheorie wird nicht wie in den empirischen Wissenschaften gefragt „Wie sieht die Welt aus?“, sondern „Wie sieht unser Wissen von der Welt aus?“. Bei der Erkenntnistheorie handelt es sich also um eine Theorie des Wissens und somit um eine typische Metadisziplin. Wissenschaftliche Forschungen, die sich zumeist in schriftlichen Veröffentlichungen niederschlagen, sind – genauso wie zum Beispiel Geschichte – ein Teil der Literatur. Ebenso sind Erkenntnistheorien keine unzweifelhaften Wahrheiten, sondern nichts anderes als sprachlich formulierte Ansichten über Erkenntnis, mit denen der Anspruch auf die Gültigkeit von bestimmten Behauptungen untermauert werden soll.
Der Autor möchte vermitteln, was er von der gegenwärtigen Realismus-Debatte für interessant was er auf dem Gebiet der Erkenntnistheorie für wichtig hält. Um durch Vielfalt nicht zu verwirren, werden bewusst Lücken gelassen und Akzente gesetzt. Trotzdem ist es für das Verständnis der angesprochenen Problematik und zur Orientierung unverzichtbar, zunächst eine – wenn auch möglichst kurzgefasste – Darstellung der erkenntnistheoretischen Geistesgeschichte Europas anzubieten (Kap. 2). Hier kann der Leser feststellen, wie viele Persönlichkeiten sich über die oben skizzierten Fragen Gedanken gemacht und so auch unsere Urteile über die Welt beeinflusst haben. Die Literaturhinweise (Kap. 7) bieten die Möglichkeit, sich mit dem Denken einzelner Autoren noch besser bekannt zu machen und bestimmte Themen weiter vertiefen zu können.
Zunächst kurz zu dem Begriff „Erkenntnis“. Das Wort weist nämlich eine gewisse Doppeldeutigkeit auf. Mit „Erkenntnis“ kann man sowohl einen Prozess oder Vorgang (nämlich den des Erkennens) meinen, als auch ein Resultat bezeichnen (nämlich das positive Ergebnis, den Erfolg von Erkenntnisbemühungen: das Wissen). In der Antike meint Erkenntnis noch allein das Wissen um das „Wesen der Dinge“. Heute betrachtet man Erkenntnis meist unter dem Aspekt der Nützlichkeit für die praktische Anwendung.
Grundlegend für alle Erkenntnisambitionen über das Wesen der Dinge, die „Wirklichkeit der Welt“ und die Struktur zu lösender Probleme sind folgende Fragen: Was ist Wissen, können wir überhaupt wahres Wissen erlangen – und wenn ja, wie – und wenn nein, warum nicht? Wie gelangen wir zu Wissen? Welche Probleme lassen sich damit lösen? Schließlich, wo sind die Grenzen des menschlichen Wissens?
Heute ist man – wie gesagt – im allgemeinen weniger an dem „Wesen der Dinge“ interessiert. Man legt den Schwerpunkt mehr auf eine Erkenntnis, welche ein praktisches Wissen (engl. know how) vermittelt. Von Erkennen spricht man überwiegend dort, „wo bezogen auf ein Wissen, auf eine zu beantwortende Frage oder auf ein zu lösendes Problem eine Antwort, eine Lösung und in diesem Sinne ein erfolgreicher Abschluss einer Bemühung gelingt“ (P. Janich, 2000). Ähnlich pragmatisch lässt sich Erkenntnis definieren als die „Fähigkeit zu unterscheiden, welcher Informationsstand für die Lösung eines wichtigen Problems relevant ist“ (N. Postman, 1999).
Bei den folgenden Erörterungen wollen wir uns nicht um formale Erkenntnis kümmern, wie sie in der Logik, der Mathematik und anderen Strukturwissenschaften angestrebt wird. Uns geht es in erster Linie um faktische Erkenntnis, um Wirklichkeitserkenntnis, um die Erkenntnis der realen Welt.
Hier im Text wird „Erkenntnis“ – soweit nicht anders vermerkt – in der allgemeinen Bedeutung von „Wissen“ – und zwar menschliches Wissen – verwendet. Dabei wird sowohl der philosophische als auch der wissenschaftliche Aspekt von „Wissen“ berücksichtigt: im Sinne von „kennen“ das, was eine Sache ausmacht (engl. knowing that), als auch im Sinne von „können“ das, wie man etwas tut (engl. knowing how).
Es soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit wir uns mit unserer Weltsicht an objektiver Wirklichkeit oder an subjektiven Denkkonstruktionen orientieren und warum wir oftmals trotz besseren „Wissens“ manche Ergebnisse des Nach-Denkens und des wissenschaftlichen Forschens ignorieren. Dabei sollen auch die Motive moralischer, religiöser oder mystischer „Erkenntnis“ kritisch beleuchtet werden. Wohin uns Vorurteile im Denken, menschliche Überheblichkeit und ein auf ungebremsten technischen Fortschritt setzendes Tun führt, wird an einigen Beispielen gezeigt. Einsichten, denen keineswegs der Rang ethischer „Erkenntnis“ zugebilligt wird, werden in Beziehung zur heutigen Moral gestellt und die sich daraus ergebenden Konsequenzen diskutiert.
Obwohl es in diesem Buch in erster Linie um die Beziehungen zwischen objektiver Realität und subjektiver Sicht geht, wird sich nicht nur auf die speziellen Fragen der Erkenntnistheorie nach dem Wissen beschränkt. Zusätzlich wird danach gefragt, wie Menschen denn mit diesem Wissen umgehen und welche Bedeutung dieses Wissen für ihren Alltag, ihre Hoffnungen und ihr Handeln hat. Letztlich geht es darum zu klären, welchen Sinn Erkenntnisse dem Leben geben können.
Der Autor wird im Text eine Reihe kritischer Anmerkungen machen, gelegentlich abschweifen und auch eigene Meinungen äußern. Das ist beabsichtigt. Trotzdem wird damit kein Anspruch auf Allgemeingültigkeit verbunden. Es liegt in der Natur der Sache, dass Aussagen schon allein durch die Auswahl der behandelten Themen und durch Schwerpunkte, welche gesetzt werden, subjektiv sind. Ebenso lassen sich Wiederholungen früher schon geäußerter Gedanken (1998, 2001) nicht ganz vermeiden.
Für diverse Denkanstöße im Rahmen manch‘ anregender Gespräche in den vergangenen Jahren sei an dieser Stelle den Freunden aus unserem philosophischen Gesprächkreis in Höxter gedankt: Dr. Jochen Faig, Dipl.Päd. Hans-Jürgen Kiesel, Dr. Anton Linzner, Dr. Christian Mignat und Dr. Wolfgang Unger.
Der Verfasser ist sich durchaus der Unzulänglichkeiten bewusst, welche in Kauf genommen werden müssen, wenn man sich als philosophischer Laie an die Bearbeitung eines so komplexen Themas wagt. Gleichzeitig jedoch hofft er, mit seiner Art und Weise der Erörterung epistemologischer Fragen auch bei anderen Hobby-Philosophen Interesse zu wecken und Denkanstöße zu geben, Zustimmung aber auch Widerspruch zu ernten. Dem Verfasser erscheint es besonders wünschenswert, wenn das vorliegende Buch auch für andere Sichtweisen als die seinen Raum lässt und die Leser dazu anregen kann, bestimmte Gewissheiten in Frage zu stellen. Man soll berücksichtigen, dass die vorliegende Abhandlung ein Versuch ist, auf allgemeinverständliche Weise den erheblichen Unterschied zwischen einer objektiven Wirklichkeit und der Illusion in unserem Denken und Empfinden zu verdeutlichen. Kritisch gesehen handelt es sich bei dieser Darstellung ja auch nur um eine subjektive Beschreibung der Wirklichkeitssicht des Autors!
Höxter, im Januar 2008
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten Ich weiß, dass ich nichts weiß.
Sokrates (469-399 v. Chr.)
2. Schon die alten Griechen ...
Wenn Menschen nach Erkenntnis streben, möchten sie meistens die Wahrheit über irgendwelche realen Zusammenhänge herausbekommen. Sie wollen ein möglichst sicheres Wissen von einer Sache oder einem Problem erwerben, um sich so eine richtige Überzeugung bezüglich bestimmter Bereiche der Wirklichkeit bilden zu können.
Das Bemühen zu erkennen, wie die Welt wirklich ist, und zu erklären, was hinter dem allen steckt, das wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, gibt es seit den Anfängen reflektierenden menschlichen Denkens. Zeugnis davon geben uns sowohl der vor etwa 4500 Jahren in Bildern strukturierte Sternenhimmel der Sumerer als auch alte Schriften aus Ägypten, Indien, Mesopotamien, Palästina und China (z.B. die Grabschriften in den Pyramiden der V. und VI. Dynastie, ca. 2600-2300 v.Chr.; die Rigveda-Hymnen, ca. 2000-1500 v.Chr.; das Gilgamesch-Epos, ca. 1200 v.Chr.; das Alte Testament der Bibel, ca. 1100 v.Chr.; das „Buch der Wandlungen“ - I Ging, ca. 1100 v.Chr.).
Der Begriff „Erkenntnistheorie“ taucht in der deutschen Literatur erst seit Anfang des 19. Jahrhunderts auf (A. Diemer, 1972). Einen Vorläufer dieses Begriffes kann man allerdings bereits in der „Wissenschaftslehre“ Johann Gottlieb Fichtes (1762-1814) sehen. Die ersten Fragen über Erkenntnis in der europäischen Geistesgeschichte stellen jedoch schon über 2000 Jahre zuvor in der griechischen Antike Leute, die man – da sie vor Sokrates leben – später als „Vorsokratiker“ bezeichnet hat. Diese Vorsokratiker sind Männer aus Milet, wie z.B. Thales (ca. 625-545 v.Chr.), der von seinen Landsleuten als ältester der „Sieben Weisen“ verehrt wird. Thales gilt als der Begründer der Philosophie, da er als erster ein Urprinzip (gr. arche) des Ganzen annimmt, nämlich das Wasser. Weitere bedeutende Vorsokratiker sind Anaximander (ca. 610-545 v.Chr.) und Anaximenes (ca. 584-525 v.Chr.). Der erstgenannte von beiden entwickelt die erste Sonnenuhr in Griechenland und macht u.a. den Versuch, eine Erdkarte zu zeichnen, um so ein abstraktes Bild der Erde zu entwerfen. Leute wie Anaximander und Anaximenes hat man auch Kosmonologen oder Hylozoisten genannt (gr. kosmos = wörtl.: geordnetes Gebiet, übertr. Ordnung; logos = wörtl.: Wort, Rede, Sprache, übertr. Gedanke, Begriff, Vernunft, Sinn; gr. hyle = Materie, zoe = Leben). Erwähnt werden müssen auch Pythagoras aus Samos (ca. 575-500 v.Chr.), Heraklit aus Ephesus (ca. 550-480 v.Chr.), Empedokles aus Arigent (ca. 490-430 v.Chr.) und Anaxagoras aus Klazomenae (ca. 500-428 v.Chr.). Ebenfalls zählen Demokrit (ca. 460-370 v.Chr.) und Protagoras aus Abdera (ca. 480-410 v.Chr.) zu den wichtigen Denkern dieser Ära. Sie alle bezeichnen sich noch nicht als „Philosophen“, denn dieses Wort (gr. philos = Freund, sophos = Klugheit, Weisheit) wird erst nach ihrer Zeit erfunden (W. Pape, 1908). Die Vorsokratiker setzen an Stelle „außerirdischer“ mythischer Deutungen vom Wirken der Götter rationell begründete „innerweltliche“ Erklärungen. Der Anfang der Philosophie ist somit zugleich der Beginn wissenschaftlichen vernunftgesteuerten Denkens. So sehen wir heute diese Persönlichkeiten des antiken Griechenlands wegen der von ihnen begründeten mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundsätze weniger als Philosophen, denn als Wissenschaftler an. In der Antike ist allerdings „Philosophie“ noch eine Sammelbezeichnung für alle Erkenntnisbemühungen einschließlich der Wissenschaften.
Die Vorsokratiker sind sich mancher Hürden und Unzulänglichkeiten ihres Denkens bewusst. So weiß man bereits in der Antike die Sinneswahrnehmung von der Erinnerung oder der Sinnestäuschung zu unterscheiden. Ebenfalls besteht Klarheit über die Problematik von gesicherter Erkenntnis und bloßer Meinung, von Behauptung und Begründung, von Wahrheit und Irrtum, von Glaube und Wissen. Beispielsweise erklärt Demokrit schon im 5. Jahrhundert v.Chr., „dass wir nicht erkennen können, wie in Wirklichkeit ein jedes Ding beschaffen oder nicht beschaffen ist“ (W. Capelle, 1953; H. Diels, 1957). Die Unterscheidung wahrer von scheinbarer Erkenntnis dient in der frühen griechischen Antike dem Bemühen, die Vielfalt des Erkennens auf wenige „Anfänge“, „Gründe“ oder „Ursachen“ (gr. dor. prin) zurückzuführen, möglichst gar auf ein einziges „Prinzip“ zu reduzieren (lat . principium = Anfang).
Die Vorsokratiker wissen – wie gesagt – um die Schwierigkeiten des Erkenntnisgewinns. Sie sind erstaunlich phantasievolle und dennoch bescheidene Leute. Zweieinhalb Jahrtausende vor unserer Zeit stellt Xenophanes (577-485 v.Chr.) z.B. folgendes fest: „Nimmer noch gab es den Mann, und nimmer wird es ihn geben, der die Wahrheit erkannt von den Göttern und allem auf Erden. Denn auch wenn er einmal das Rechte vollkommen getroffen, wüsste er selbst es doch nicht. Denn nur Vermuten (hypothetisches Wissen) ist uns beschieden“ (H. Diels, 1957). Tatsächlich liegt die Bedeutung der vorsokratischen Philosophie weniger in der Richtigkeit der dort entwickelten Hypothesen als in der Erstmaligkeit der erkannten Probleme und dem Mut, mit dem eine Lösung gesucht wird.
Aus dem Staunen über die Welt heraus fragen die Vorsokratiker nach dem Ursprung und geben verschiedene Antworten darüber, welches wohl der Urstoff allen Seins sei. Aus Staunen und Fragen folgt also das Erkennen, doch dann auch – und nun kommt die eigentliche Weisheit! – der Zweifel an dem Erkannten und die kritische Prüfung. Hier, auf dem Nachfragen, auf dem Zweifel, liegt der philosophische (und auch wissenschaftliche) Schwerpunkt des Denkens, da längst nicht alles, was den Anschein von Wahrheit erweckt, auch wahr ist. Letzten Endes entsteht philosophische Erkenntnis somit erst in der gedanklichen Reflexion über das Erkannte. Doch mit dem Versuch die Welt zu begreifen sind auch erste Ansätze verbunden, diese zu verändern und die Natur zu beherrschen. So versteht sich der Mensch selbst, indem er die eigene Umgebung aus Distanz betrachtet, auch nicht mehr unbedingt als Teil einer unveränderlichen Ordnung.
Nach den „Vorsokratikern“ betritt Sokrates aus Athen (469-399 v.Chr.) die philosophische Bühne. Er hinterlässt wie Epiktet, Konfuzius, Buddha oder Jesus keine Schriften. Sokrates’ Denken ist uns dennoch ausführlich aus der Aufzeichnung seiner Dialoge durch seinen Schüler Platon geläufig. Einem Mann wie Sokrates ist keineswegs eine kritische Vorurteilslosigkeit gegenüber der Welt der Wahrnehmung zueigen, wie dies beispielsweise noch bei Protagoras der Fall ist. Er ist aber der Überzeugung, dass Wahrheit und damit auch Wirklichkeit dem die Wahrnehmung prüfenden Denken zugänglich sei. Für ihn hat der Sinn der gesprochenen Worte, die Rede (gr. = logos) Wahrheit, ohne selbst Wahrheit zu sein. Er bemüht sich auf dem Athener Markt, im Gespräch mit Menschen verschiedener Meinung das Gemeinsame aufzuzeigen. Durch diese von Zenon aus Elea (ca. 490-430 v. Chr.) begründete „Hebammenkunst“ der Dialektik (gr. dialegestei = sich unterhalten, Rede und Gegenrede führen) versucht Sokrates, das „Wahre“ in der Wahrnehmungswelt zu bestimmen und zu allgemeiner Anerkennung zu bringen. Als erster Philosoph stellt er die Begründungsfrage. Dabei geht es ihm nicht um die faktische, sondern um die begründete Geltung von Tugenden oder Werten. Seine eigene hervorstechende Tugend ist die Tapferkeit, welche sich in der beharrlichen Suche nach der Wahrheit und das bis in den Tod konsequente Eintreten für deren Verwirklichung zeigt. Die Jagd nach dem „Wesen der Dinge“, nach dem „Allgemeinen“, das wir heute gewöhnlich „Begriff“ nennen (vgl. Kap. 3.1.2.), und die Entdeckung, dass eben dieses Allgemeine in der Welt dasjenige ist, wodurch Erkenntnis erst möglich wird, wodurch Wahrgenommenes erst „begriffen“ wird, ist die herausragende Leistung dieses großen Mannes.
Sokrates’ Schüler Platon (427-347 v.Chr.), der eigentlich Aristokles heißt und als Begründer von Logik und Metaphysik gilt, vermutet hinter der Welt der Erscheinungen nicht die objektive Wirklichkeit sondern eine Schein- und Trugwelt. Für ihn sind alle konkreten, sinnlich erfahrbaren Dinge nur das schattenhafte Abbild (gr. eidolon) einer höheren Realität, nämlich der Ideen. Nach Platons Auffassung ist allein die Erkenntnis der Ideen wahre Erkenntnis, während die Erkenntnis der Sinnesdinge trügerisch bleiben muss. Platon, der uns die Dialoge des Sokrates schriftlich übermittelt hat, stellt in einem seiner berühmten Gleichnisse unsere menschliche Weltsicht derjenigen von Kreaturen gleich, die – tief im Dunkel einer Höhle seit Kindheit angekettet – nur in eine Richtung zu blicken vermögen. In ihrer Blickrichtung an der Höhlenwand erscheinen ihnen Schatten von bewegten Figuren, welche durch ein Feuer weit hinter ihnen dorthin projiziert werden. Jene Schatten der am Feuer vorbeigetragenen Gegenstände halten sie für die Dinge selbst. „Auf keine Weise also könnten derartige Menschen etwas anderes für wahr halten als die Schatten der angefertigten Gegenstände“ (Platon, dt. EA 1572; 1925). Einer von ihnen, der die Möglichkeit hätte, von den Fesseln befreit, aus dem Dunkel der Höhle zu gelangen, würde nicht nur durch den Blick ins Licht erst einmal schmerzhaft geblendet werden, meint Platon, er würde auch den Schatten an der Wand zunächst höheren Wahrheitsgehalt einräumen als der Wirklichkeit der Dinge (nämlich den Ideen) selbst. Und sollte dieser Mensch, der das Licht der wahren Welt erblickt hat, zurückkehren zu seinen Leuten in der Höhle und ihnen berichten, was er gesehen habe, würden sie ihm wohl nicht glauben, sondern ihn auslachen. Sollte er aber gar versuchen, die anderen Kreaturen loszubinden und ebenfalls ans Licht der Wirklichkeit zu führen, würde man ihn aus Angst vermutlich töten.
Platons Allegorie spiegelt das Erkenntnisdilemma des Menschen wider. Der springende Punkt, auf welchen im Höhlengleichnis hingewiesen wird, ist die Äquivalenz der Beziehung von Gegenständen zu ihren Schatten mit der Beziehung von der Wirklichkeit zu unserer Vorstellung von derselben. Mit Hilfe der sokratischen „Hebammenkunst“ lassen sich die Bildungsschritte der Höhlengefangenen folgendermaßen strukturieren: das eingebildete Wissen im starren Blick auf die Höhlenwand, das erstrebte Wissen beim Aufstieg aus der Höhle und das erreichte Wissen im Ausblick auf das Ganze, sowie der Wiederabstieg in die mit neuen Augen betrachtete Höhlenwelt als Metapher für die Welt der menschlichen Praxis.
Wie das in der Staatsschrift „ Politeia “ (dt. EA 1572; 1925) enthaltene Gleichnis deutlich macht, wird Platons Lehre bestimmt durch das Verhältnis von Idee und Erscheinung, wie es übertragen dem Verhältnis von Wissen und Meinung entspricht. Wissen selbst wird aufgeteilt in Verstehen (gr . noesis) und Begreifen (gr. dianoia), was heutzutage nach P. Janich am ehesten mit einem zwingenden logischen Begründen sowie einem dialektisch abwägenden Bedenken der Ideen übersetzt werden kann (2000). Nicht nur im „ Staat “, ebenso in Dialogen wie Menon und Theaitetos (1973) behandelt Platon typisch epistemologische Fragen. Für Erkenntnis fordert Platon die gelingende Begründung im Unterschied zur bloßen Meinung oder Behauptung, welche auf die Angabe von Gründen verzichtet. Für die Geistesgeschichte Europas ist das Werk Platons von überragender Bedeutung. Nach einem Ausspruch von Alfred North Whitehead (1861-1947) besteht die Denktradition Europas gar „aus einer Reihe von Fußnoten zu Platon“ (1929). Platon setzt eine unkörperliche Welt (Ideenwelt) als Wirklichkeit, wogegen die wahrnehmbare Welt für ihn lediglich ein Abbild (gr. eidolon) dieses Urbildes (gr. paradigma) ist.
Nicht geringeren Einfluss auf die westliche Denktradition bis zum heutigen Tage hat auch Platons Schüler Aristoteles (384-322 v.Chr.), der die Rolle der Sinne allerdings wesentlich positiver beurteilt als sein Lehrer. Aristoteles wendet sich von der idealistischen Position Platons ab und verlangt dagegen für die beweisende Wissenschaft eine Begründung als Rückführung auf erste zweifelsfreie „Ursachen“ (Grundsätze, Erklärungsprinzipien). Die Spannung im Gegensatz von platonischer Ideenlehre und aristotelischer Erkenntnislehre findet noch in der späten europäischen Philosophie ihren unterschiedlichen Niederschlag (vgl. auch Kap. 3.1.1). Die geistigen Strömungen der Aufklärung und des Rationalismus orientieren sich später in Deutschland mehr am platonischen Idealismus (I. Kant, 1724-1804; G.W. v. Leibniz, 1646-1716; C. Wolff, 1679-1754), in England dagegen eher am aristotelischen Empirismus (T. Hobbes, 1588-1679; D. Hume, 1711-1776; J. Locke, 1632-1704).
Eng verknüpft mit der Suche nach Erkenntnis ist von jeher die Frage „Was ist wahr?“ Hierzu trifft Aristoteles, der auch als Begründer der Logik gilt, bereits im 4. Jh. v. Chr. im IV. Buch seiner „Metaphysik“ (lat. EA 1483, dt. EA 1847; 1989) eine ebenso banale wie grundlegende Feststellung: „Von etwas, das ist, zu sagen, dass es nicht ist, oder von etwas, das nicht ist, zu sagen dass es ist, ist falsch; während von etwas, das ist, zu sagen, dass es ist, oder von etwas, das nicht ist, zu sagen, dass es nicht ist, ist wahr.“ Bei dieser „Definition“ von Wahrheit ist unschwer einzusehen, dass sie uns bei der praktischen Anwendung, bei der Entscheidung, ob eine Behauptung zutrifft oder nicht, wenig nützt. Hierzu sind, wie wir im Kap. 3.1.2 ausführlich besprechen werden, bestimmte Wahrheitskriterien, das heißt Maßstäbe nötig, die uns im Einzelfall bei dieser Entscheidung helfen können.
Bevor wir uns nun aus der Antike verabschieden, um ins Mittelalter und die Neuzeit weiterzugehen, sei noch kurz die Ansicht der „Skeptiker“ erwähnt, deren Schule auf Phyrron von Elis (ca. 360-270 v. Chr.) zurückgeht und deren bedeutendster Vertreter Sextus Empiricus (Ende des 2. Jh.) ist. Der „absolute Skeptizismus“ verneint kategorisch die Erkenntnismöglichkeit von Wahrheit, Wirklichkeit und allgemein gültigen Normen. Dagegen leugnet die als „partieller Skeptizismus“ bezeichnete Haltung lediglich die dogmatische Erkenntnis bestimmter Bereiche (z.B. religiös-übersinnliche Wahrheiten). Insgesamt prüft die skeptische Erkenntnismethode Wahrheitsansprüche kritisch durch Infragestellung derselben und nicht unter dem Gesichtspunkt der Meinung einer Autorität (T. Grundmann und K. Stüber, 1996). Dieser methodische Skeptizismus findet sich beispielsweise wieder in den Überlegungen von Michel de Montaigne (1533-1592), René Descartes (1596-1650), Immanuel Kant (1724-1804) sowie David Hume (1711-1776) - (vgl. Kap. 3.1.3).
Im Laufe der weiteren historischen Entwicklung wird der von Sokrates, Platon und Aristoteles geöffnete Zugang zu Rationalismus und Aufklärung zunächst für mehr als tausend Jahre durch den alleinigen Wahrheitsanspruch der christlichen Religion und der sie verkörpernden, das europäische Mittelalter beherrschenden römischen Kirche versperrt. Die in der griechischen Antike begonnene Auseinandersetzung mit kosmologischen (= die Welt erklärenden) und kosmogonischen (= die Welterzeugung, -schöpfung betreffenden) Mythen (gr. mythos = Erzählung) geht zugunsten einer Lehre verloren, in der die Wahrheit des christlichen Kanons und die Existenz einer gottgegebenen vom Menschen unabhängigen Schöpfung außerhalb jeglicher Diskussion steht. Erkenntnisziel und Erkenntnisgegenstand sind festgelegt. Kritisches Denken oder gar lautes Fragen ist offiziell unerwünscht und im Zeitalter der Inquisition (ab 1231 bis zuletzt 1859) zum Teil gar lebensgefährlich. Unter solchen Umständen verliert die Philosophie für Jahrhunderte lang ihren geistig-innovativen Anspruch und lässt sich stattdessen zu einer „Magd der Theologie“ degradieren.
Der „Kirchenvater“ Aurelius Augustinus (354-430), welcher in der Naturbeobachtung allein den Auftrag sieht, „Gottes Herrlichkeit zu schauen“, deutet die Philosophie Platons zum Beweis christlicher Glaubenssätze um (EA o.J., vor 1470, 1959). Thomas von Aquin (1225-1274) interpretiert etwa neunhundert Jahre nach Augustinus die Erkenntnis- und Wahrheitslehre Aristoteles’ im christlichen Sinne, indem er in seiner „Korrespondenztheorie der Wahrheit“ u.a. die Natur in eine schaffende (lat . natura naturans) und eine geschaffene Natur (lat. natura naturata) theoretisierend zerlegt (EA o.J, 1485). Der Wandel vom scholastischen Denken hin zum Geist des Humanismus und der Renaissance wird erst weitere zweihundert Jahre später durch Nikolaus von Kues (1401-1464) vollzogen, welcher eine Gleichzeitigkeit der Gegensätze (lat. coincidentia oppositorum), d.h. neben einer mystischen eine rationale Betrachtungsweise der Welt gelten lässt (EA 1488). Auch für den ebenso genialen wie frommen Isaac Newton (1643-1727) ist es weitere vierhundert Jahre später kein Widerspruch, in seiner Mechanik das Werk göttlichen Schöpfungswillens zu sehen und gleichzeitig einen naturwissenschaftlichen Materialismus zu entwickeln (EA 1687, 1872). Selbst bis zum heutigen Tage finden sich in allen Disziplinen moderner Naturforschung Wissenschaftler, die – so paradox es anmuten mag – einerseits die kausale Geschlossenheit eines Systems von Wechselwirkungen materieller Dinge vertreten und andererseits weltanschaulich auf dem Boden christlich religiöser Glaubensüberzeugungen stehen.
Im 19. Jahrhundert erst wird die Auffassung von der Gleichzeitigkeit oder Parallelität eines religiösen und eines naturwissenschaftlichen Weltbildes weitgehend verworfen. Die historische Wende von jeder religiösen Auffassung weg und hin zu einer rein menschenbezogenen Sicht der Natur ist in ihren Anfängen bereits um das Jahr 1670 festzustellen (W. Schröder, 1998), vollzieht sich endgültig 1846 (EA) in den Thesen Ludwig Feuerbachs (1804-1872). Mit Feuerbach beginnt eine ausschließlich philosophisch begründete Negation der Existenz Gottes, eine Haltung, welche als Atheismus bezeichnet wird (gr. athetos = ohne Gott).
Die Neuzeit in den Wissenschaften und die Überwindung der aristotelisch-scholastischen Naturphilosophie beginnt mit der „kopernikanischen Wende“, das heißt der Ablösung des geozentrischen Weltbildes des Ptolemäus (ca. 100-160) durch das heliozentrische Weltbild des Nikolaus Kopernikus (1473-1543). – Unerwähnt soll allerdings nicht bleiben, dass schon etwa 1800 Jahre zuvor Aristarch von Samos (ca. 310-230 v.Chr.) ein heliozentrisches Planetenmodell entwickelt hat. – Von ebenso großer Bedeutung ist die kurze Zeit nach Kopernikus von Galileo Galilei (1564-1642), einer Schlüsselfigur der modernen Wissenschaft, eingeleitete Entwicklung der Experimentalphysik. Als Meilensteine für die Naturforschung gelten daneben die Leistungen von Tycho Brahe (1546-1601), Johannes Kepler (1571-1630) und Isaac Newton (1643-1727).
Galilei, nach dessen Bekundung das Buch der Natur in der Sprache der Mathematik geschrieben ist, führt mit seinen Arbeiten die Bemühungen der Naturwissenschaften zweifellos auf einen neuen erfolgreichen Weg. Die Bemühungen der Erkenntnistheorie führt er jedoch nach Meinung mancher Autoren (wie z.B. P. Baumann, 2002) gewissermaßen in eine Sackgasse. Während Aristoteles noch strikt zwischen Natur und Technik unterscheidet und das, was durch Menschenhand erzeugt wird, als künstlich und naturwidrig einstuft, ignoriert Galilei diese Unterscheidung. Für ihn sind künstlich hervorgerufene Bewegungen, wie beispielsweise das Rollen einer Messingkugel auf einer im Neigungswinkel veränderlichen Rinne, natürliche Abläufe. So wertet Galilei auch das Technische als natürlich, gar naturgesetzlich, der Natur Gehorchendes. Seine Experimente haben die Form eines Wenn-dann-Satzes. Was Galilei in Wenn-Sätzen formuliert, betrifft das, was er technisch erfolgreich herstellen muss, bevor er Erkenntnis im Dann-Satz „aus Erfahrung“ gewinnt. Jede Erfahrung des Natürlichen steht somit in Abhängigkeit vom Gelingen des Künstlich-Technischen. Die erkenntnistheoretische Konsequenz in dieser mit Galilei einsetzenden Tradition liegt in der oft kritisierten Annahme, mittels technischer Apparaturen zeigten sich „Naturgesetze“ „von selbst“, also natürlich.
Die „Initialzündung“ für ein neuzeitlich aufgeklärtes Verständnis des Erkennens gibt René Descartes (1596-1650) sowohl für die Naturwissenschaften als auch für die „Philosophie des Geistes“ durch seine Interpretation des seit der Antike das europäische Denken beschäftigende Leib-Seele-Problems (oder besser Körper-Geist-Problem; s. Kap. 4.4). Er nennt sich latinisiert Cartesius und zählt zu den Begründern des mechanistischen Weltbildes. Primär befasst sich Descartes mit Geometrie, dann aber mehr und mehr mit der Täuschung menschlicher Sinne (EA 1637, 1972 und EA 1641, 1980). Er ist es, welcher den Erdkartenentwurf des Anaximander um ein die Erde überziehendes Koordinatennetz erweitert, um Ideogramme also im Sinne von gedachten Linien wie dem Äquator und gedachten Punkten wie dem Nord- und Südpol. Seine Wahrnehmungen und inneren Bilder demonstrieren ihm allerdings die Fragwürdigkeit des Seins einer Außenwelt (s. auch Kap. 3.1.3). Parallel dazu kommen ihm Zweifel an seiner eigenen physischen Existenz. Am Ende tröstet Descartes sich mit der frommen Hoffnung, Gott könne doch nicht so böswillig sein und den Menschen trügerische Sinne einbauen. Er konstruiert das, was man später als „Cartesischen Dualismus“ bezeichnet, nämlich die Teilung der Wirklichkeit in transzendente Wesen oder Substanzen des Geistes (lat. res cogitans) und objektive Dinge oder räumlich ausgedehnte Körper (res extensa). Verglichen mit dem mittelalterlichen Denken ist gerade „revolutionär“, dass Descartes der Vernunft Eigenständigkeit gegenüber der Welt zubilligt. Mit seinem Zugeständnis an die Autonomie der Vernunft, die ihm als Erlebendem immerhin die Sicherheit gibt, dass er selbst ist (lat. „ Cogito, ergo sum “ = „Ich denke, also bin ich“), wird Descartes einerseits zum Begründer des Rationalismus, liefert andererseits mit seiner dualistischen Sichtweise der christlich-römischen Kirche später den Anstoß für ein vom Verfasser an anderer Stelle (2001) ausführlich kritisiertes „Weltbild der zwei Wahrheiten“.
Baruch de Spinoza (1632-1677) schließlich, der als Erkenntnistheoretiker nicht weniger der Tradition der euklidischen Geometrie verpflichtet ist wie Descartes, geht noch einen Schritt weiter als jener. Spinoza hält schon die Aussage, dass ein Ding existiert, für unangemessen. Für ihn ist jede Erscheinung eines Gegenstandes, auch jeder eigene Gedanke, eine Weise, in der Gott sich zeigt. Ohne die Existenz Gottes in Abrede zu stellen oder ernsthaft anzuzweifeln, macht die Auffassung, materielle und geistige Dinge seien lediglich Erscheinungsformen ein und desselben Gottes (lat. deus sive natura), diesen Protagonisten eines neuzeitlichen Pantheismus in den Augen der katholischen Kirche zu einem gottverdammten Ketzer (EA 1760, 1787 und EA 1677, 1785).
Das Zusammenspiel von Sinneserfahrung einerseits und Denken andererseits beschäftigt nach Descartes und Spinoza eine Reihe weiterer prominenter Denker, wie John Locke (1632-1704), Gottfried W. Leibniz (1646-1716), George Berkeley (1685-1753), David Hume (1711-1776) und schließlich den großen Immanuel Kant (1724-1804). Aristoteles, F. Bacon, Locke, Berkeley, Hume und Mill gelten als klassische Vertreter des Empirismus. Die „Empiristen“ vertreten die Meinung, unser Wissen stamme ganz wesentlich oder ausschließlich aus der Erfahrung. Man spricht dann von „empirischem Wissen“ oder einem „Wissen a posteriori“. Die als „Rationalisten“ bezeichneten Denker dagegen, zu denen wir u.a. Platon, Descartes, Spinoza, Wolff und vor allem Leibniz zählen, vertreten die Ansicht, manches könne man auch ohne Erfahrung wissen („apriorisches Wissen“). Eine einzigartige Zwischenstellung in dieser Diskussion nimmt Immanuel Kant mit seiner „Kritik der reinen Vernunft“ ein (EA 1781; 1998).
Kant, der zunächst einerseits der Tradition des Leibniz-Wolff’schen Rationalismus verpflichtet ist, sich andererseits aber durch die Überlegungen Humes aus einem „dogmatischen Schlummer geweckt“ fühlt, macht den Versuch, den Prozess des Erkenntnisgewinns schrittweise zu schematisieren. Nach Darstellung Kants wirkt („affiziert“) ein Gegenstand (Voraussetzung) auf das menschliche Gemüt. Das Gemüt ruft dadurch eine Empfindung („Wirkung des Gegenstandes“, „Materie der Sinnlichkeit“) hervor. Aus dieser Wirkung des Gegenstandes auf das Gemüt, aus der Empfindung also, entsteht die Anschauung (gr. aisthesis). Die Fähigkeit (Möglichkeit, Bedingung) des Gemütes affiziert zu werden, bezeichnet Kant als „rezeptive Sinnlichkeit“. Durch das Zusammenwirken (gr. synthesis) der Anschauung (Vorstellung) mit dem Denken, welches sich zusammensetzt aus 1. dem Verstand (der die „Begriffe“ bildet), 2. der Urteilskraft (welche die fallgerechte Anwendung der Begriffe ermöglicht) und 3. der Vernunft (welche „Schlüsse“ zieht) entsteht nach Auffassung Kants die Erkenntnis. Die besondere Leistung Kants ist herauszustellen, „dass die Vernunft nur das einsieht, was sie selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt“ (EA 1781; 1998). Demzufolge wird das Erkennen nicht von den Gegenständen bestimmt, sondern die Gegenstände richten sich nach der Erkenntnisart. In der von Kant postulierten Annahme einer Trennung der erkennenden Person von den zu erkennenden Gegenständen sehen viele Philosophen überhaupt erst den eigentlichen Beginn der Erkenntnistheorie.
Die beherrschenden erkenntnistheoretischen Fragen der Zeit nach Kant betreffen einerseits das schon erwähnte Problem des Dualismus (auch „Leib-Seele-Problem“ oder „Körper-Geist-Problem“, vgl. Kap. 4.3), andererseits das Realismus-Problem, das heißt die Frage, ob es überhaupt eine menschen-unabhängig strukturierte Wirklichkeit als zu erkennendes Objekt gibt (s. Kap. 3.1.3). Hinzu kommt die Entdeckung, dass Probleme der Wissenschaften und der Philosophie auch als Probleme in ihrer sprachlichen Formulierung zu sehen sind. Mit der Zeit entwickelt sich die Beschäftigung mit der Bedeutung sprachlicher Ausdrücke zu einem eigenen Wissenschaftszweig. Der französische Sprachwissenschaftler Michel Bréal (1832-1915) hat hierfür als Erster den Terminus „Semantik“ gebraucht (gr. semantikos = bezeichnend). Insbesondere unter dem Einfluss Ludwig Wittgensteins (1889-1951) wird die Einschränkung philosophischen Denkens auf die logische Analyse (EA 1953) zum Glaubensbekenntnis vieler modernen Philosophen. Neben Wittgenstein geben besonders Gottlob Frege (1848-1925), Bertrand Russell (1872-1970) und Edward Moore (1873-1958) diesbezüglich entscheidende Anstöße.
Als zentrales Problem erweißt sich in der Zeit nach Kant die Frage über das Wesen geometrischer beziehungsweise mathematischer Gegenstände und ihres Verhältnisses zur Erfahrungswirklichkeit. Die klassische Frage nach der Natur, sowie nach Existenz und Beschaffenheit des Menschen (des Erkenntnisobjekts) und nach dem Verhältnis zwischen beiden im Prozess des Erkennens werden im Kontext mit den Ergebnissen der modernen Naturwissenschaften gestellt. Zwar anerkennt Kant die Wissenschaft als zentralen Ort der Erkenntnis, bestimmt aber gleichzeitig deren Grenzen, indem er die Naturwissenschaften auf den Bereich „möglicher Erfahrung“ einschränkt. Eine rein naturwissenschaftliche Weltanschauung kann es nach Kant nicht geben. In der „Kritik der reinen Vernunft“ (EA 1781; 1998) teilt Kant menschliche Erkenntnis ein einerseits in Erkenntnisse a priori, das heißt Erkenntnisse, deren Begründung frei von jeder Erfahrung ist und für die Allgemeinheit und strenge Notwendigkeit besteht (er nennt diese Erkenntnis auch „rein“ oder „metaphysisch“), andererseits in Erkenntnisse a posteriori (oder auch „empirische“ Erkenntnisse), also Erkenntnisse, die ihren Ursprung in der durch Sinneseindrücke begründeten Erfahrung haben.
In Anlehnung an die Definition Kants entsteht Ende der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts im „Wiener Kreis“ die Auffassung, Erkenntnis könne im streng wissenschaftlichen Sinne entweder nur logisch-mathematisch oder empirisch sein. „Erfahrung“, welche Kant noch als Einsicht in natürliche Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge formuliert hat, wird jetzt – wie schon bei Galilei – mit der Gewinnung von Messergebnissen gleichgesetzt. Das „A priori“ Kants entspricht nun den von Menschenhand künstlich herbeigeführten und aufrechterhaltenen, unverzichtbaren Messgeräteeigenschaften. Wenn Kant noch von den a priorischen Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung spricht, wird hier die Erfahrung als Bedingung der Möglichkeit einer gültigen Geometrie an den Anfang gestellt.
Die zuerst von Auguste Comté (1798-1857) vertretene geschichtsphilosophische Haltung, welche später insbesondere durch Emile Durckheim (1858-1917) in den Bereich der Sozialwissenschaften übernommen wird, nennt man „Positivismus“. Daran anknüpfende oder darauf aufbauende Gedankengebilde erhalten in Folge die Bezeichnungen „Naturalismus“, „Szientismus“ (lat. scientia = Wissenschaft), „(logischer) Empirismus“, „Materialismus“, „Physikalismus“, „Reduktionismus“ und „Neopositivismus“. Da die meisten „-Ismen“ einen negativ-abwertenden Beigeschmack haben, soll hier die Verwendung des neutralen Begriffes „Naturalismus“ vorgezogen werden. Allen diesen Termini ist die Überzeugung gemeinsam, dass es sowohl in der Natur als auch in unserer Vernunft ausschließlich mit natürlichen Dingen zugeht. Das heißt, dass alle realen Systeme – falls sie überhaupt verstehbar sind – natürlichen (nicht metaphysischen) Gesetzmäßigkeiten unterworfen und prinzipiell einer wissenschaftlichen Analyse zugänglich sind. Weitere prominente Vertreter dieser alles Metaphysische ausschließenden erkenntnistheoretischen Auffassung sind u.a. Persönlichkeiten wie Bertrand Russell (1872-1970), Albert Einstein (1879-1955), Moritz Schlick (1882-1936), Otto Neurath (1882-1945), Hans Reichenbach (1891-1953), Rudolf Carnap (1891-1970) und Carl Gustav Hempel (1905-1997).
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck dieses Textes?
Dieser Text soll interessierte Leser auf verständliche Weise mit der Problematik der subjektiven Wahrnehmungsfähigkeit und des menschlichen Erkenntnisvermögens konfrontieren. Er möchte zeigen, wie subjektiv und individuell die Weltsicht jedes Menschen ist und dass die Umwelt "in Wirklichkeit" anders ist, als wir sie wahrnehmen.
Welche Fragen werden in diesem Text behandelt?
Der Text behandelt Fragen wie: Ist objektive Erkenntnis möglich? Ist das, was wir zu wissen glauben, tatsächlich wahr? Haben Moral und Ethik etwas mit Natürlichkeit zu tun? Orientieren sich Glaubenssysteme an der Wirklichkeit? Bestimmen Tatsachen oder Wunschdenken unser Weltbild? Und schließlich: Wie beantworte ich mit den gewonnenen Erkenntnissen die Sinnfrage meines eigenen Lebens?
An wen richtet sich dieser Text?
Der Text richtet sich an kritische Leser und Hobby-Philosophen, die an den Sinnfragen des Lebens interessiert sind und eine verständliche Einführung in die Erkenntnistheorie suchen.
Was sind die zentralen Begriffe, die in diesem Text erläutert werden?
Der Text erläutert Begriffe wie "Wirklichkeit," "Erkenntnis," "Wissen," "Wahrheit," "Realität," "Illusion," "Erkenntnistheorie," "Epistemologie," "Gnoseologie," und "Kognitionswissenschaft." Ein Glossar (Kapitel 5) erklärt weitere Fremdwörter und Fachbegriffe.
Welche Persönlichkeiten werden in Bezug auf die Erkenntnistheorie erwähnt?
Der Text erwähnt eine Vielzahl von Persönlichkeiten, von den Vorsokratikern wie Thales und Demokrit über Sokrates, Platon, Aristoteles bis hin zu modernen Denkern wie Descartes, Spinoza, Kant, Wittgenstein und Einstein. Kapitel 8 enthält ein Personenregister mit Seitenangaben.
Welche historischen Epochen werden im Zusammenhang mit der Entwicklung der Erkenntnistheorie betrachtet?
Der Text betrachtet die Entwicklung der Erkenntnistheorie von der griechischen Antike über das Mittelalter und die Renaissance bis zur Neuzeit und Moderne.
Was ist die Bedeutung des Höhlengleichnisses von Platon?
Das Höhlengleichnis veranschaulicht die Äquivalenz der Beziehung von Gegenständen zu ihren Schatten mit der Beziehung von der Wirklichkeit zu unserer Vorstellung von derselben. Es spiegelt das Erkenntnisdilemma des Menschen wider.
Was ist der Cartesische Dualismus?
Der Cartesische Dualismus, begründet von René Descartes, teilt die Wirklichkeit in transzendente Wesen oder Substanzen des Geistes (res cogitans) und objektive Dinge oder räumlich ausgedehnte Körper (res extensa).
Was ist der Unterschied zwischen Rationalismus und Empirismus?
Empiristen (wie Locke und Hume) glauben, dass unser Wissen hauptsächlich oder ausschließlich aus Erfahrung stammt. Rationalisten (wie Descartes und Leibniz) glauben, dass manches auch ohne Erfahrung gewusst werden kann (apriorisches Wissen).
Was ist Agnostizismus?
Agnostizismus bezeichnet eine Auffassung, die es kategorisch ablehnt, rationell unbegründeten Annahmen zuzustimmen. Agnostiker vertreten den Standpunkt der Unerkennbarkeit der Wirklichkeit und der Wahrheit.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text enthält ein Inhaltsverzeichnis, Hinweise zum Gebrauch des Textes, Kapitel zu verschiedenen Themen (z.B. "Einige Worte zuvor," "Schon die alten Griechen ...," "Grundfragen," "Perspektiven"), ein Glossar, ein Verzeichnis der Abbildungen, Literatur- und Quellenangaben, ein Personenregister und ein Sach- und Stichwortverzeichnis.
Wo finde ich Erklärungen zu Fremdwörtern und Fachbegriffen?
Fremdwörter und Fachbegriffe werden im Textzusammenhang erklärt und noch einmal gesondert im Glossar (Kapitel 5) erläutert.
Wo finde ich Informationen zu den zitierten Personen?
Die im Text genannten Personen finden sich im Personenregister (Kapitel 8) mit der entsprechenden Seitenangabe.
- Quote paper
- Dr. Jochen Freede (Author), 2008, Wirklichkeit und Illusion - Menschliche Weltsicht zwischen kritischer Rationalität und subjektiver Konstruktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111424