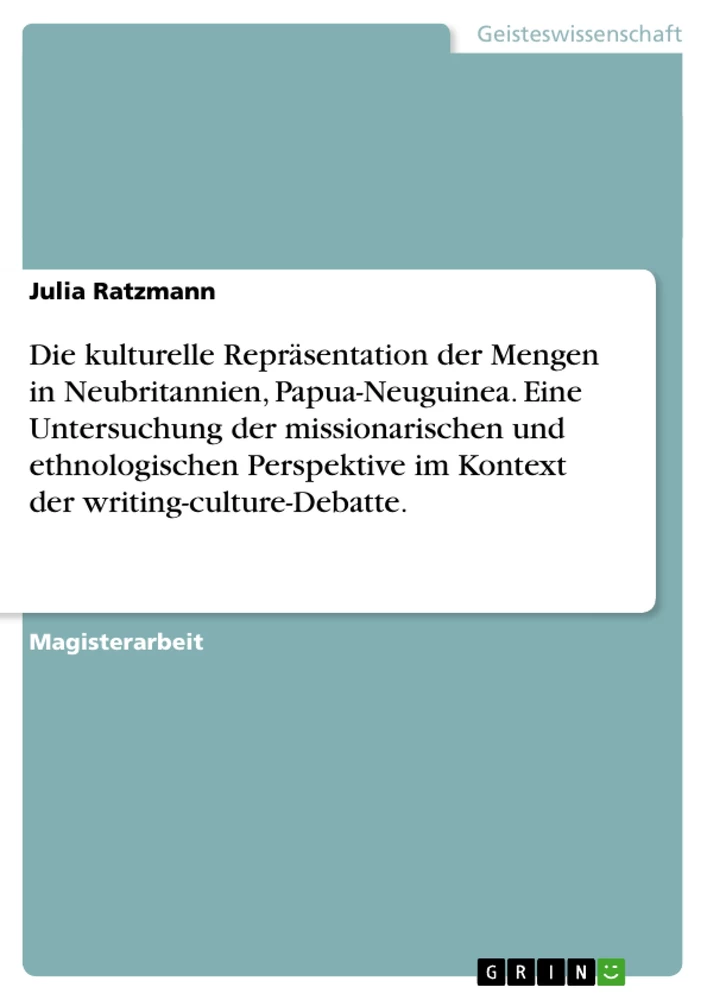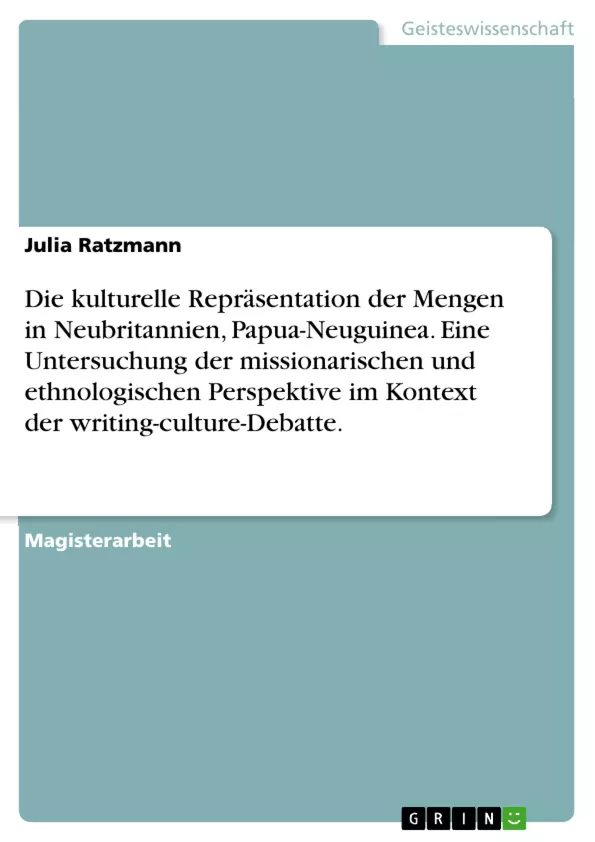Das Thema meiner Arbeit ergab sich aus dem Kontakt zu den katholischen „Missionaren vom Heiligsten Herzen Jesu“ (M.S.C.). Im Archiv des Ordens in Münster-Hiltrup stieß ich auf das 1961 veröffentlichte Buch „And we the people“ des irischen Paters Tim O’Neill über seinen missionarischen Dienst bei den Mengen an der Südküste von Neubritannien, Papua-Neuguinea. Im März 1996 konnte ich den heute in Cork/Irland lebenden Tim O’Neill aufsuchen, um Interviews über sein Leben und Werk zu führen. Im Zuge meiner Recherche stieß ich dann auf ethnographische Literatur des französischen Ethnologen Michel Panoff über seine Feldforschungsaufenthalte bei den Mengen. Da Panoff sich als einziger mir bekannter Ethnologe unmittelbar nach O’Neill bei den Mengen aufhielt, wählte ich seine Artikel als Grundlage für meine vergleichende Analyse.
In meiner Arbeit soll es um die unterschiedlichen Darstellungen - sprich Repräsentationen - der Kultur der Mengen gehen. Dabei soll der Frage nachge- gangen wer-den, inwieweit sich die Darstellung eines Missionars (hier vertreten durch Tim O’Neill) von der eines Ethnologen (hier vertreten durch Michel Panoff) unterscheidet, und wo sich Gemeinsamkeiten in der Interpretation kultureller Gegebenheiten finden. Diese Untersuchung der missionarischen und ethnologischen Perspektive soll dabei im Kontext der seit Ende der 70er Jahre geführten post-modernen Diskussion um die ‘writing culture’ geschehen (s. Kap. 1.3).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Zielsetzung und Vorgehensweise
- 1.2 Begriffsklärungen
- 1.3 Theoretische Aspekte
- 1.4 Problemfelder
- 2. Die Mengen
- 2.1 Quellenlage und Quellenkritik
- 2.2 Die Ethnographie der Mengen
- 2.3 Die Missionierung der Mengen durch die Missionare vom Heiligsten Herzen Jesu (M.S.C.)
- 3. Missionare und Ethnologen: Eine ‘Hassliebe’ ?
- 4. Der Missionar Tim(OTHY) O'Neill
- 4.1 Biographie
- 4.2 Das Buch „And we the people“
- 4.3 Zum Kanon des Ordens: Das Orientierungssystem des Missionars
- 5. Der Ethnologe Michel Panoff
- 5.1 Biographie
- 5.2 Die Artikel über die Mengen
- 5.3 Theoretische Aspekte: Das Orientierungssystem des Ethnologen
- 6. Vergleich anhand ausgewählter Aspekte
- 6.1 Themenwahl und Themengewichtung: Unterschiede und Gemeinsamkeiten
- 6.2 Zur Standortbestimmung der beiden ‘Fremden’
- 6.2.1 “...to grasp the native's point of view...“: Intentionen der Autoren
- 6.2.2 Wertepositionen und Einstellungen
- 6.2.3 Rolle und Status
- 6.2.4 Kultur- und Fortschrittsbegriff
- 7. Die missionarische und ethnologische Perspektive im Kontext der ‘Writing Culture’
- 7.1 Das Verhältnis von Subjektivität und Objektivität: Die Autoren als Individuen und als Vertreter ihres Faches
- 7.2 Die Forderung nach Multivokalität: Monolog, Dialog oder Polyphonie ?
- 7.3 Etablierung und Legitimation der Autorität
- 7.4 ‘Teilnehmende Beobachtung’: Die Autoren als ‘Out’- oder ‘Insider’ der Kultur ?
- 8. Die sprachstilistische Analyse vor dem Hintergrund der ‘Writing Culture’
- 8.1 Die ‘literarischen Konventionen’
- 8.2 Zur Genrebestimmung der Primärquellen: Die Ethnographie als ‘story’ und/oder die ‘story’ als Ethnographie
- 8.3 Rolle und Funktion des Erzählers
- 8.4 Leserschaft und Text-Autor-Leser Verhältnis
- 8.5 Probleme der Übersetzung
- 9. Thematischer Vergleich anhand ausgewählter Textstellen
- 9.1 Zur wirtschaftlichen Organisation der Mengen
- 9.1.1 Gartenbau und Subsistenz
- 9.1.2 Reziprozität und Redistribution
- 9.2 Zur politischen Organisation
- 9.2.1 Dorfgründungen und Landrechte
- 9.2.2 ‘Big men’ und ‘Rubbish men’
- 9.3 Zur sozialen Organisation
- 9.3.1 Deszendenz und Residenz
- 9.3.2 Scham und Suizid
- 9.4 Zur Religion
- 9.4.1 ‘Traditionelle’ Glaubensvorstellungen
- 9.4.2 Synkretistische Vorstellungen
- 9.5 Der kulturelle Wandel seit 1931
- 9.5.1 Ausgewählte Beispiele
- 9.5.2 Die Katechisten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die kulturelle Repräsentation der Mengen in Neubritannien, Papua-Neuguinea, indem sie missionarische und ethnologische Perspektiven im Kontext der „Writing Culture“-Debatte vergleicht. Das Hauptziel ist es, die unterschiedlichen Darstellungen der Mengenkultur aufzuzeigen und die Einflüsse der jeweiligen methodischen und ideologischen Hintergründe zu analysieren.
- Der Vergleich missionarischer und ethnologischer Beschreibungen der Mengen.
- Die Analyse der „Writing Culture“-Debatte und ihrer Relevanz für die Darstellung der Mengenkultur.
- Die Untersuchung der Rolle von Subjektivität und Objektivität in ethnographischen und missionarischen Schriften.
- Die Erforschung der unterschiedlichen methodischen Ansätze und deren Auswirkungen auf die Darstellung der Mengenkultur.
- Die sprachstilistische Analyse der untersuchten Texte.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses einführende Kapitel skizziert die Zielsetzung und Vorgehensweise der Arbeit. Es definiert zentrale Begriffe und legt die theoretischen Grundlagen dar, wobei die „Writing Culture“-Debatte als wichtiger Bezugsrahmen eingeführt wird. Schließlich werden die Problemfelder der Arbeit umrissen, die sich aus den unterschiedlichen Perspektiven und Darstellungen der Mengenkultur ergeben.
2. Die Mengen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Quellenlage und der Quellenkritik bezüglich der Mengen. Es präsentiert die ethnographische Literatur über die Mengen und analysiert die missionarische Einflussnahme der Missionare vom Heiligsten Herzen Jesu (M.S.C.) auf die Gruppe, unterstreichend die unterschiedlichen Perspektiven und die damit verbundenen Herausforderungen für die wissenschaftliche Untersuchung.
3. Missionare und Ethnologen: Eine ‘Hassliebe’?: Dieses Kapitel beleuchtet das komplexe Verhältnis zwischen missionarischen und ethnologischen Ansätzen bei der Erforschung der Mengen. Es zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Herangehensweise auf und vorbereitet den detaillierten Vergleich der folgenden Kapitel.
4. Der Missionar Tim(OTHY) O'Neill: Hier wird die Biographie des Missionars Tim O'Neill präsentiert und sein Buch „And we the people“ analysiert. Der Fokus liegt auf dem Orientierungssystem des Missionars und wie dies seine Darstellung der Mengen prägt. Die Analyse verdeutlicht den Einfluss religiöser Überzeugungen auf die Interpretation kultureller Phänomene.
5. Der Ethnologe Michel Panoff: Ähnlich wie im vorherigen Kapitel, wird hier die Biographie von Michel Panoff vorgestellt und seine Artikel über die Mengen analysiert. Besonderes Augenmerk liegt auf den theoretischen Aspekten seines Ansatzes und wie diese seine Interpretation der Mengen beeinflussen. Der Vergleich mit O'Neills Ansatz wird vorbereitet.
6. Vergleich anhand ausgewählter Aspekte: Dieses Kapitel vergleicht die Themenwahl, die Themengewichtung, die Intentionen der Autoren, die Wertepositionen und Einstellungen, die Rolle und den Status der Autoren sowie den Kultur- und Fortschrittsbegriff von O'Neill und Panoff. Es beleuchtet die unterschiedlichen Standpunkte und deren Auswirkungen auf die Darstellung der Mengenkultur.
7. Die missionarische und ethnologische Perspektive im Kontext der ‘Writing Culture’: Dieses Kapitel setzt sich intensiv mit der „Writing Culture“-Debatte auseinander und analysiert die Subjektivität und Objektivität in den Schriften von O'Neill und Panoff. Es beleuchtet den Aspekt der Multivokalität und untersucht die Etablierung und Legitimation von Autorität in ethnographischen und missionarischen Texten. Die Rolle der „teilnehmenden Beobachtung“ und die Position der Autoren als „Insider“ oder „Outsider“ werden ebenfalls diskutiert.
8. Die sprachstilistische Analyse vor dem Hintergrund der ‘Writing Culture’: Dieses Kapitel untersucht die sprachlichen Mittel und literarischen Konventionen, die von O'Neill und Panoff verwendet wurden. Es analysiert die Genrebestimmung der Primärquellen und die Rolle des Erzählers, die Leserschaft sowie das Text-Autor-Leser-Verhältnis. Schließlich werden die Probleme der Übersetzung und deren Auswirkungen auf die Interpretation der Texte beleuchtet.
9. Thematischer Vergleich anhand ausgewählter Textstellen: Dieses Kapitel vergleicht die Darstellungen der wirtschaftlichen, politischen, sozialen und religiösen Organisation der Mengen bei O'Neill und Panoff anhand ausgewählter Textstellen. Es analysiert den kulturellen Wandel seit 1931 und die Rolle der Katechisten.
Schlüsselwörter
Mengen, Neubritannien, Papua-Neuguinea, Missionare, Ethnologen, Writing Culture, kulturelle Repräsentation, Subjektivität, Objektivität, Multivokalität, Tim O’Neill, Michel Panoff, sprachstilistische Analyse, Gartenbau, Reziprozität, politische Organisation, soziale Organisation, Religion, kultureller Wandel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Missionarische und ethnologische Perspektiven auf die Mengen in Neubritannien
Was ist das zentrale Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die kulturelle Repräsentation der Mengen in Neubritannien, Papua-Neuguinea, durch einen Vergleich missionarischer und ethnologischer Perspektiven im Kontext der "Writing Culture"-Debatte. Das Hauptziel ist die Aufdeckung unterschiedlicher Darstellungen der Mengenkultur und die Analyse der Einflüsse methodischer und ideologischer Hintergründe.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit basiert auf missionarischen Schriften, insbesondere dem Werk von Tim O'Neill ("And we the people"), und ethnologischen Texten von Michel Panoff. Die Quellenlage und -kritik werden im zweiten Kapitel detailliert behandelt.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet einen vergleichenden Ansatz, der missionarische und ethnologische Beschreibungen der Mengen gegenüberstellt. Es werden textanalytische Methoden (sprachstilistische Analyse), die Auseinandersetzung mit der "Writing Culture"-Debatte und die Analyse der jeweiligen methodischen und ideologischen Hintergründe der Autoren angewendet.
Welche Aspekte der Mengenkultur werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte der Mengenkultur, darunter die wirtschaftliche Organisation (Gartenbau, Reziprozität, Redistribution), die politische Organisation (Dorfgründungen, Landrechte, "Big men"), die soziale Organisation (Deszendenz, Residenz, Scham, Suizid) und die Religion ("traditionelle" und synkretistische Glaubensvorstellungen). Der kulturelle Wandel seit 1931 wird ebenfalls berücksichtigt.
Welche Rolle spielt die "Writing Culture"-Debatte?
Die "Writing Culture"-Debatte dient als wichtiger Bezugsrahmen. Sie ermöglicht die Analyse der Subjektivität und Objektivität in den untersuchten Texten, beleuchtet Fragen der Multivokalität, der Autoritätslegitimation und der Rolle der "teilnehmenden Beobachtung" sowie die Position der Autoren als "Insider" oder "Outsider".
Wie werden die Perspektiven von O'Neill und Panoff verglichen?
Der Vergleich umfasst die Themenwahl und -gewichtung, die Intentionen der Autoren, deren Wertepositionen und Einstellungen, ihre Rolle und ihren Status sowie deren Kultur- und Fortschrittsbegriff. Ein thematischer Vergleich anhand ausgewählter Textstellen beleuchtet Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Darstellung der Mengenkultur.
Welche sprachlichen Aspekte werden analysiert?
Die sprachstilistische Analyse untersucht die literarischen Konventionen, die Genrebestimmung der Primärquellen, die Rolle des Erzählers, das Text-Autor-Leser-Verhältnis und die Probleme der Übersetzung. Der Fokus liegt auf dem Einfluss der Sprache auf die Interpretation der kulturellen Phänomene.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in neun Kapitel: Einleitung, Die Mengen, Missionare und Ethnologen, Der Missionar Tim O'Neill, Der Ethnologe Michel Panoff, Vergleich anhand ausgewählter Aspekte, Missionarische und ethnologische Perspektive im Kontext der ‘Writing Culture’, Sprachstilistische Analyse und Thematischer Vergleich anhand ausgewählter Textstellen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Mengen, Neubritannien, Papua-Neuguinea, Missionare, Ethnologen, Writing Culture, kulturelle Repräsentation, Subjektivität, Objektivität, Multivokalität, Tim O’Neill, Michel Panoff, sprachstilistische Analyse, Gartenbau, Reziprozität, politische Organisation, soziale Organisation, Religion und kultureller Wandel.
- Quote paper
- Julia Ratzmann (Author), 1997, Die kulturelle Repräsentation der Mengen in Neubritannien, Papua-Neuguinea. Eine Untersuchung der missionarischen und ethnologischen Perspektive im Kontext der writing-culture-Debatte., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11154