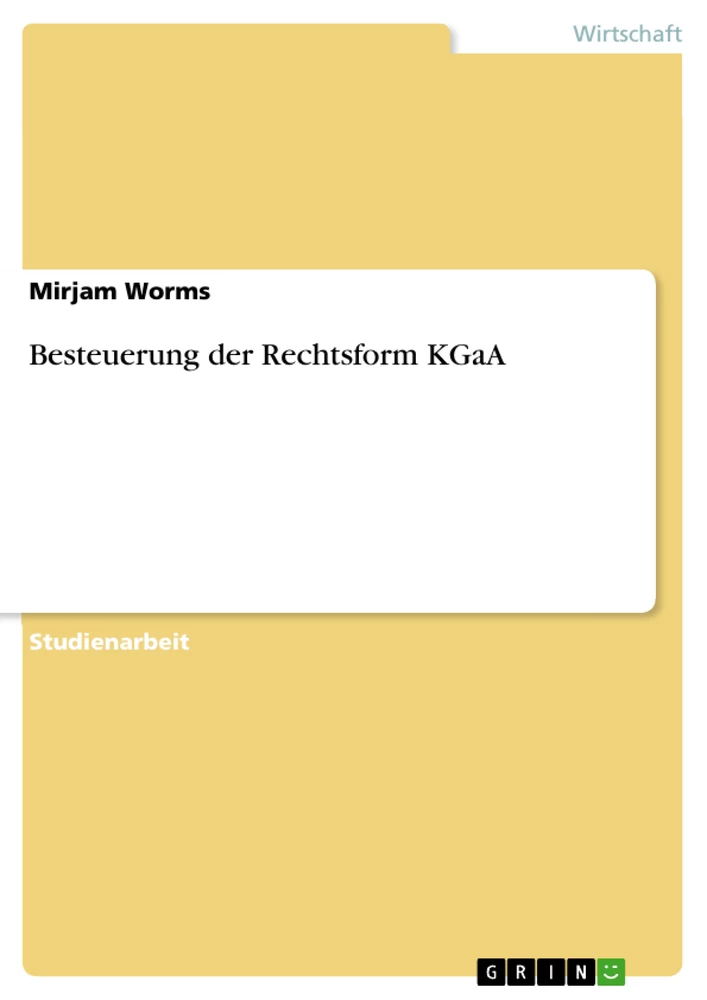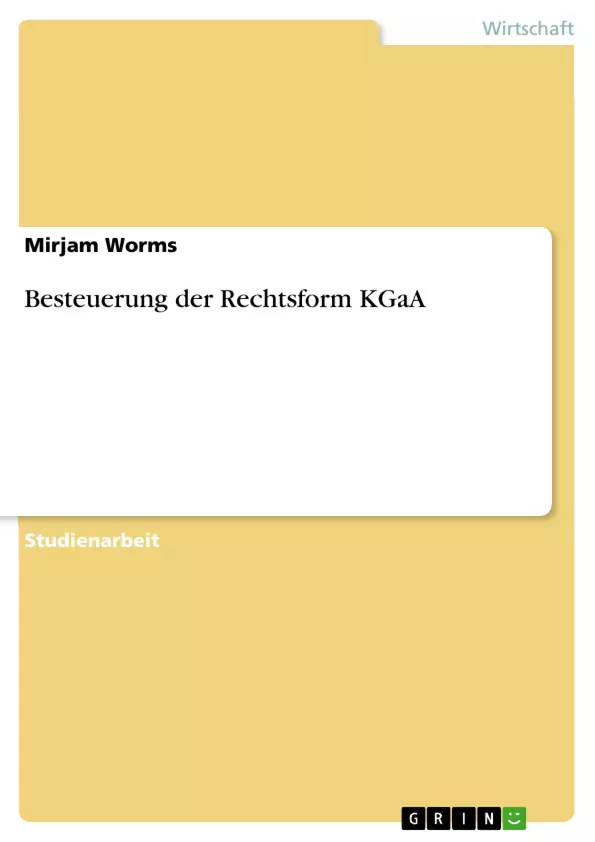Die Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) ist seit ihrer Kodifizierung im Jahre 1861 im ADHGB einheitlich gesetzlich normiert. Ausgangs des letzten Jahrhunderts war diese Gesellschaftsform verhältnismäßig weit verbreitet.
Obwohl sie seit 1937 als juristische Person anerkannt wird, und immerhin die Deutsche Bank AG aus dieser Gesellschaftsform hervorging, hat sie in letztem Jahrhundert ständig an Bedeutung verloren.
Die mangelnde Verbreitung im 20. Jahrhundert ist darauf zurückzuführen, dass die Notwenigkeit der unbeschränkten persönlichen Haftung eines Gesellschafters die Unternehmer abschreckte. Ob eine juristische Person oder eine GmbH/GmbH & Co. KG als Komplementärin einer KGaA zulässig oder ob die Position des Komplementärs allein natürlichen Personen vorbehalten ist, war lange Zeit umstritten. Eine Klärung schien die sogenannte EUROKAI-Entscheidung des Hanseatischen Oberlandesgerichts aus dem Jahre 1968 zu signalisieren. Der Aussagegehalt dieser Entscheidung blieb jedoch umstritten. Dies liegt daran, dass keine Aussage getroffen wurde, ob eine juristische Person nur im Zusammenhang mit einer natürlichen Person oder auch als alleiniger Komplementär einer KGaA zulässig ist.
In den darauffolgenden Jahren gab es immer mehr Befürworter für die Zulassung einer kapitalistischen KGaA. Dieses neuerwachte Interesse an der kapitalistischen KGaA führte schließlich zur Akzeptanz durch die Entscheidung des BGH vom 24.02.1997. Dieses Urteil bietet vor allem dem Mittelstand, börsenwilligen Familienunternehmen, bis hin zu Profiabteilungen der Vereine der Fußball Bundesliga die Vorteile der KGaA zu nutzen. „Es steht daher zu erwarten, dass es zu einer Welle von Neugründungen von bzw. Umwandlungen in KGaAs kommen wird, die alsbald Gegenstand der notariellen Beurkundungspraxis sein wird.“ Waren 1992 nur noch 30 Gesellschaften im Handelsregister eingetragen, so ist diese Zahl durch diese Rechtsentwicklung und –klärung auf mehr als 50 gestiegen. Bekannte börsennotierte KGaAs sind: Henkel, Kirch, Lindner Holding, Merck, Rewe und Borussia Dortmund.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Rechtliche Struktur der KGaA
- II.1. Grundlagen
- II.2. Organe
- II.2.1. Komplementär
- II.2.2. Hauptversammlung
- II.2.3. Aufsichtsrat
- II.3. Finanzierung der KGaA
- II.4. Haftung
- III. Die kapitalistische KGaA
- III.1. Going Public
- IV. Die kapitalistische KGaA als optimale Rechtsform für Familienunternehmen und Sportvereine
- V. Besteuerung
- V.1. Besteuerung der KGaA
- V.1.1. Körperschaftsteuer
- V.1.2. Gewerbesteuer
- V.2. Besteuerung der Kommanditaktionäre
- V.2.1. Anteile im Privatvermögen
- V.2.2. Anteile im Betriebsvermögen
- V.2.3. Erbschaftsteuer
- V.3. Besteuerung der Komplementäre
- V.3.1. Natürliche Personen
- V.3.1.1. Einkommensteuer
- V.3.1.2. Gewerbesteuer
- V.3.1.3. Erbschaftsteuer
- V.3.2. GmbH
- V.3.2.1. Körperschaftsteuer
- V.3.2.2. Gewerbesteuer
- V.3.3. GmbH & Co. KG
- V.3.3.1. Einkommensteuer
- V.3.3.2. Gewerbesteuer
- V.3.3.3. Erbschaftsteuer
- V.3.1. Natürliche Personen
- V.1. Besteuerung der KGaA
- VI. Wege in die KGaA
- VI.1. Gründung
- VI.2. Wechsel der Rechtsform
- VI.2.1. Verschmelzung
- VI.2.2. Spaltung
- VI.2.2.1. Auf- und Abspaltung
- VI.2.2.2. Ausgliederung
- VI.2.3. Formwechsel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die Besteuerung der Rechtsform Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) umfassend darzustellen. Der Fokus liegt dabei auf den verschiedenen steuerlichen Aspekten für die beteiligten Parteien, insbesondere die Kommanditaktionäre und die Komplementäre.
- Rechtliche Struktur der KGaA
- Besteuerung der KGaA selbst
- Besteuerung der Kommanditaktionäre
- Besteuerung der Komplementäre (natürliche Personen, GmbH, GmbH & Co. KG)
- Wege in die KGaA (Gründung und Rechtsformwechsel)
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Besteuerung von KGaAs ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Es liefert einen Überblick über die Bedeutung der KGaA als Rechtsform und die Komplexität der damit verbundenen steuerlichen Aspekte.
II. Rechtliche Struktur der KGaA: Dieses Kapitel beleuchtet die rechtlichen Grundlagen der KGaA, beschreibt die verschiedenen Organe (Komplementär, Hauptversammlung, Aufsichtsrat) und deren Funktionen, erläutert die Finanzierungsmechanismen und geht auf die Haftungsverhältnisse ein. Es bildet die Grundlage für das Verständnis der späteren steuerlichen Ausführungen, da die rechtliche Struktur die steuerlichen Konsequenzen maßgeblich beeinflusst. Die detaillierte Beschreibung der Organe und ihrer Aufgaben dient dazu, die unterschiedlichen steuerlichen Behandlungen der beteiligten Parteien zu kontextualisieren.
III. Die kapitalistische KGaA: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Besonderheiten der kapitalistischen KGaA, insbesondere im Hinblick auf den "Going Public"-Prozess. Es werden die damit verbundenen rechtlichen und wirtschaftlichen Implikationen diskutiert, die wiederum erhebliche Auswirkungen auf die steuerliche Behandlung haben. Die Analyse des Going Public Prozesses liefert wichtige Kontextinformationen für das Verständnis der steuerlichen Herausforderungen bei der Kapitalbeschaffung und der Beteiligung von Aktionären.
IV. Die kapitalistische KGaA als optimale Rechtsform für Familienunternehmen und Sportvereine: In diesem Kapitel werden die Vor- und Nachteile der KGaA als Rechtsform für Familienunternehmen und Sportvereine bewertet. Die Analyse betont die Relevanz der KGaA als eine flexible und an unterschiedliche Bedürfnisse anpassbare Rechtsform, die sowohl unternehmerische als auch steuerliche Vorteile bieten kann. Der Fokus liegt auf der Betrachtung der KGaA im Kontext von spezifischen Unternehmenstypen, um die Anwendung der vorher beschriebenen Aspekte zu verdeutlichen.
V. Besteuerung: Das Herzstück der Arbeit, in dem die verschiedenen Aspekte der Besteuerung der KGaA, ihrer Aktionäre und Komplementäre detailliert behandelt werden. Die Kapitel V.1 bis V.3 stellen eine systematische Untersuchung der steuerlichen Konsequenzen für jede beteiligte Partei dar, mit Schwerpunkt auf Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Erbschaftsteuer. Der systematische Vergleich der verschiedenen Besteuerungsmodelle innerhalb der KGaA dient dazu, die Unterschiede und Konsequenzen der verschiedenen Beteiligungsmöglichkeiten hervorzuheben.
VI. Wege in die KGaA: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Wege, um eine KGaA zu gründen oder in eine KGaA umzuwandeln. Es analysiert Gründungsmodalitäten, Verschmelzungen, Spaltungen und Formwechsel und verdeutlicht die damit verbundenen steuerlichen und rechtlichen Implikationen. Die Ausführungen zu Gründungs- und Umwandlungsprozessen sind relevant, um die langfristigen steuerlichen Konsequenzen der Wahl der Rechtsform KGaA zu verstehen.
Schlüsselwörter
KGaA, Besteuerung, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Erbschaftsteuer, Kommanditaktionäre, Komplementäre, Rechtliche Struktur, Going Public, Familienunternehmen, Sportvereine, Rechtsformwechsel, Gründung.
Häufig gestellte Fragen zur Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA)
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA), mit besonderem Fokus auf deren steuerliche Aspekte. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Text beleuchtet die rechtliche Struktur der KGaA, die Besteuerung der KGaA selbst sowie ihrer Kommanditaktionäre und Komplementäre, und beschreibt verschiedene Wege, um eine KGaA zu gründen oder in eine KGaA umzuwandeln.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Kernbereiche: die rechtliche Struktur der KGaA (inkl. Organe, Finanzierung und Haftung), die kapitalistische KGaA und den "Going Public"-Prozess, die Eignung der KGaA als Rechtsform für Familienunternehmen und Sportvereine, die umfassende Besteuerung der KGaA (Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Erbschaftsteuer für Kommanditaktionäre und Komplementäre – natürliche Personen, GmbH, GmbH & Co. KG), sowie die verschiedenen Wege in die KGaA (Gründung und Rechtsformwechsel – Verschmelzung, Spaltung, Formwechsel).
Welche Arten von Besteuerung werden für die KGaA behandelt?
Das Dokument beschreibt detailliert die verschiedenen steuerlichen Aspekte für alle beteiligten Parteien. Dies umfasst die Besteuerung der KGaA selbst (Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer), die Besteuerung der Kommanditaktionäre (inkl. der Behandlung von Anteilen im Privat- und Betriebsvermögen sowie Erbschaftsteuer), und die Besteuerung der Komplementäre (unterscheidet zwischen natürlichen Personen, GmbH und GmbH & Co. KG mit jeweiligen Steuerarten wie Einkommensteuer, Gewerbesteuer und Erbschaftsteuer).
Wer sind die relevanten Akteure in einer KGaA im Kontext der Besteuerung?
Die relevanten Akteure im Kontext der Besteuerung sind die KGaA selbst, die Kommanditaktionäre (die Kapitalgeber) und die Komplementäre (die persönlich haftenden Gesellschafter). Die Besteuerung unterscheidet sich je nach Rechtsform des Komplementärs (natürliche Person, GmbH, GmbH & Co. KG).
Welche Rechtsformen des Komplementärs werden betrachtet?
Das Dokument analysiert die steuerlichen Konsequenzen für Komplementäre in drei verschiedenen Rechtsformen: natürliche Personen, GmbH und GmbH & Co. KG. Für jede Rechtsform werden die spezifischen Steuerarten (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Erbschaftsteuer) und deren Auswirkungen auf die Besteuerung der KGaA erläutert.
Wie kann man eine KGaA gründen oder in eine KGaA umwandeln?
Das Dokument beschreibt verschiedene Wege, um eine KGaA zu gründen oder die Rechtsform in eine KGaA zu wechseln. Dazu gehören die Gründung einer neuen KGaA, sowie Rechtsformwechsel durch Verschmelzung, Spaltung (Auf- und Abspaltung, Ausgliederung) und Formwechsel. Die steuerlichen und rechtlichen Implikationen dieser Prozesse werden ebenfalls erläutert.
Für wen ist die KGaA als Rechtsform besonders geeignet?
Das Dokument untersucht die Eignung der KGaA als Rechtsform für Familienunternehmen und Sportvereine. Es werden die Vor- und Nachteile dieser Rechtsform für diese spezifischen Unternehmenstypen im Hinblick auf die rechtlichen und steuerlichen Aspekte bewertet.
Was ist der "Going Public"-Prozess im Kontext der KGaA?
Das Dokument behandelt den "Going Public"-Prozess, der beschreibt, wie eine KGaA an die Börse geht. Es analysiert die rechtlichen und wirtschaftlichen Implikationen dieses Prozesses und deren Auswirkungen auf die steuerliche Behandlung der KGaA.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Schlüsselwörter, die den Inhalt des Dokuments beschreiben, sind: KGaA, Besteuerung, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Erbschaftsteuer, Kommanditaktionäre, Komplementäre, Rechtliche Struktur, Going Public, Familienunternehmen, Sportvereine, Rechtsformwechsel, Gründung.
- Quote paper
- Mirjam Worms (Author), 2002, Besteuerung der Rechtsform KGaA, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11157