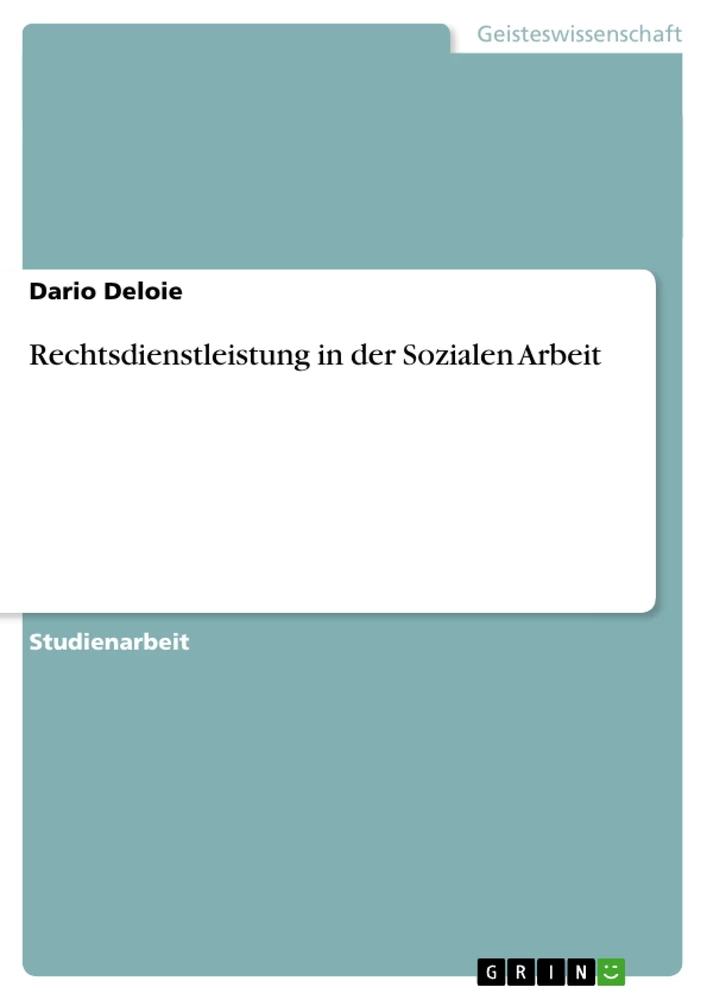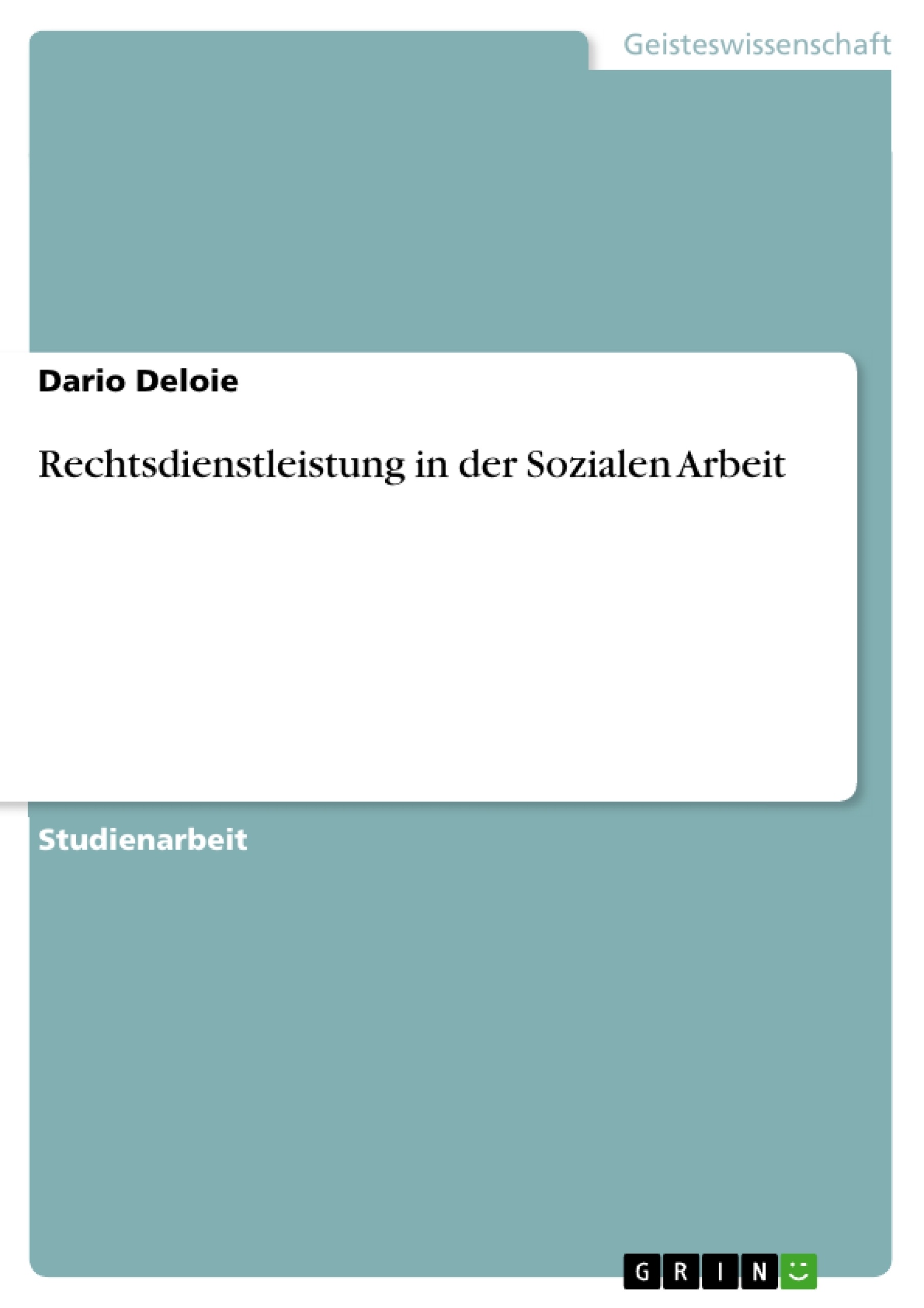In der komplexen Welt des Sozialrechts, wo sich der Einzelne oft verloren und überfordert fühlt, stellt sich die entscheidende Frage: Inwieweit dürfen SozialarbeiterInnen rechtliche Beratung leisten, ohne die Grenzen des Erlaubten zu überschreiten? Diese brisante Frage, die seit Jahren Fachleute und Gerichte beschäftigt, wird im Lichte des Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG) neu beleuchtet. Das Buch analysiert eingehend die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Rechtsberatung durch SozialarbeiterInnen, beginnend mit dem historischen Kontext des Rechtsberatungsgesetzes (RBerG) aus der Zeit des Nationalsozialismus bis hin zu den modernen Herausforderungen und Chancen des RDG. Es werden die Intentionen des Gesetzgebers zur Verabschiedung des RDG detailliert untersucht und anhand von konkreten Beispielen zulässige von unzulässigen Rechtsdienstleistungen abgegrenzt. Dabei wird besonders auf die Grauzonen eingegangen, die sich aus der unklaren Definition der „umfangreichen Rechtsberatung“ ergeben. Ein Schwerpunkt liegt auf der Rolle von SozialarbeiterInnen in verschiedenen institutionellen Kontexten, von Behörden und öffentlich-rechtlichen Körperschaften bis hin zu freien Trägern und Wohlfahrtsverbänden. Die Analyse berücksichtigt sowohl die aktuelle Rechtslage als auch die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Praxis der Sozialen Arbeit. Es werden die Eckpunkte des RDG, wie die Erlaubnis der unentgeltlichen Rechtsdienstleistung und die Beratung von Mitgliedern durch Vereine, beleuchtet. Das Buch bietet somit eine unverzichtbare Orientierungshilfe für alle SozialarbeiterInnen, die im Spannungsfeld zwischen rechtlicher Beratung und sozialer Unterstützung tätig sind, und leistet einen wertvollen Beitrag zur Klärung der Rechtsberatungsbefugnisse im Sozialbereich. Es werden Fragen zur Sozialrechtsberatung, Schuldnerberatung und Verbraucherberatung aufgeworfen und die Befugnisse der Sozialarbeiter im Kontext von Jugendämtern, Sozialämtern und kirchlichen Einrichtungen analysiert. Abschließend werden die Implikationen für die Zukunft der Rechtsberatung im Sozialbereich erörtert, wobei auch die Bedeutung des Schutzes der Ratsuchenden und die Stärkung des bürgerlichen Engagements hervorgehoben werden. Tauchen Sie ein in die juristischen Feinheiten und ethischen Dilemmata, die diese wichtige Frage aufwirft, und entdecken Sie, wie SozialarbeiterInnen im Rahmen des Gesetzes einen entscheidenden Beitrag zur Rechtsstaatlichkeit leisten können.
Inhalt
Einführung
Rechtsberatung durch SozialarbeiterInnen nach dem Rechtsberatungsgesetz (RBerG)
Rechtsdienstleistung durch SozialarbeiterInnen nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG)
Intentionen des Gesetzgebers zur Verabschiedung eines Rechtsdienstleistungsgesetzes
Beispiele zulässiger Rechtsdienstleistungen
Beispiele unzulässiger Rechtsdienstleistungen
Literaturverzeichnis
Zu 1)
Einführung
Das Gesetz zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts [Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG)] vom 12. Dezember 2007 wurde am 17. Dezember 2007 im Bundesgesetzblatt verkündet und tritt am 1. August 2008 in Kraft. Es ersetzt das bisherige Rechtsberatungsgesetz (RBerG) vom 13. Dezember 1935 (vgl. http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s2840.pdf, zugegriffen am 20.02.2008 und vgl. Eversloh 2008, S. 5).
Das Rechtsberatungsgesetz (RBerG) war in der Zeit des Nationalsozialismus verabschiedet worden, „um Richter und Staatsanwälte jüdischen Glaubens, die aufgrund des ‚Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums’ aus dem Justizdienst vertrieben wurden, daran zu hindern, als Rechtsanwälte oder Rechtsberater tätig zu werden. Deswegen wurde für die Rechtsberatung eine Genehmigungspflicht eingeführt. Zudem hieß es in § 5 der Ersten Ausführungsverordnung: ‚Juden wird die Erlaubnis nicht erteilt’“ (Hoffmann 2008, S. 1). Bis auf die letztgenannte Ausführungsverordnung, die nach dem Krieg gestrichen wurde, blieb das Rechtsberatungsgesetz in seiner Substanz erhalten, mit dem „Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“ für die Rechtsberatung von Nicht-Juristen (vgl. ebd., S. 1).
Nach Auffassung von Eversloh läutet das neue Gesetzeswerk das Ende des Monopols der Advokaten im Bereich der Rechtsberatung ein und wird zu einem erhöhten Konkurrenzdruck innerhalb dieser Branche führen (vgl. Eversloh 2008, S. 5). Wobei das Bundesjustizministerium deutlich formuliert, dass das RDG keine umfassende Rechtsdienstleistung unterhalb der Rechtsanwaltschaft einführt
(vgl. http://www.bmj.bund.de/enid/82bd11bfle70c04469c58d9bab9c8764,0/Rechtsdienstleistung/Eckpunkte RDG oq.html, zugegriffen am 20.02.2008).
Wo können nun SozialarbeiterInnen1 Rechtsberatung nach den neuen gesetzlichen Regelungen anbieten, wo ist sie hingegen so umfangreich, dass sie eine anwaltliche Aufgabe stellt? Der Begriff der „umfangreichen Rechtsberatung“ lässt viele Interpretationsspielräume zu und wird vermutlich in Zukunft die Gerichte beschäftigen.
Folgende Ziele des RDG können markiert werden:
- ein mehr an Schutz für den Rat-/Rechtssuchenden
- Stärkung des bürgerlichen Einsatzes (vgl. Eversloh 2008, S. 5)
Als Eckpunkte können genannt werden:
- Rechtsdienstleistungen werden allen Berufsgruppen erlaubt, insofern sie als Nebenleistungen erbracht werden;
- Erlaubnis der unentgeltlichen, altruistischen Rechtsdienstleistung;
- Vereine können die Mitglieder beraten;
- das RDG regelt den außergerichtlichen Bereich;
- eine umfassende Rechtsberatung erfolgt weiterhin über Juristen mit dem zweiten Staatsexamen (vgl. ebd., S. 5).
Rechtsberatung durch SozialarbeiterInnen nach dem Rechtsberatungsgesetz (RBerG)
Das derzeit gültige Rechtsberatungsgesetz (RBerG) macht „die geschäftsmäßige Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten einschließlich der Rechtsberatung und Rechtsbetreuung grundsätzlich zu einer erlaubnispflichtigen Tätigkeit“ (Brühl u. a. 2005, S. 651). Diese behördliche Erlaubnis wird nur für bestimmte Sachgebiete erteilt. Der § 1 Abs. 1 RBerG nennt hier konkret sechs Bereiche. Als Beispiel sei hier die Rentenberatung genannt. Nach § 2–7 RBerG sind von dieser Erlaubnispflicht Rechtsanwälte, Notare, Prozessagenten und Behörden und berufständige Vereinigungen und Genossenschaften ausgenommen (vgl. ebd., S. 651).
Die durch SozialarbeiterInnen häufig ausgeübte Sozialrechtsberatung wird nicht durch § 1 Abs. 1 RBerG als Sachgebiet erfasst und kann somit keine behördliche Erlaubnis erhalten. Die Rechtmäßigkeit ihrer Rechtsberatung kann nur erfolgen, wenn sie von der grundsätzlichen Erlaubnispflicht befreit wird. Gesetzlich sind aber nur die Schuldnerberatungsstellen (vgl. § 3 Nr. 9 RBerG) und die Verbraucherberatungsstellen (vgl. § 3 Nr. 8 RBerG) von der generellen Erlaubnispflicht befreit (vgl. ebd., S. 651). Die nach der Insolvenzordnung (InsO) anerkannten Schuldnerberatungsstellen sind in der Regel ein genuin sozialarbeiterisches Tätigkeitsfeld. Wie ist es beim derzeitigen Recht mit den anderen Sozialrechtberatungsfeldern bestellt? Wie oben bereits erwähnt, können Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts Rechtsberatung und Rechtsbetreuung ausüben. Der Gesetzestext lautet wie folgt:
㤠3
Durch dieses Gesetz werden nicht berührt:
1. die Rechtsberatung und Rechtsbetreuung, die von Behörden, (...), von Körperschaften des öffentlichen Rechts (...) im Rahmen ihrer Zuständigkeit ausgeübt wird (...)“ (§ 3 Nr. 1 RBerG).
Zu den öffentlich-rechtlichen Körperschaften zählen:
- Kommunen
- Sozialversicherungsträger
- Ersatzkassen
- Religionsgemeinschaften (katholische Bistümer und die der evangelischen Landeskirchen i. S. v. Art. 140 GG i. V. Art 137 Abs. 5 WRV) (vgl. Brühl u. a. 2005, S. 652)
SozialarbeiterInnen als Bedienstete von Behörden wie Jugend- und Sozialämter dürfen somit Sozialrechtsberatung anbieten (vgl. Huchting 1997). Von dieser Regelung sind auch SozialarbeiterInnen erfasst, die z. B. in katholischen Jugendämtern tätig sind, die direkt den Bistümern angegliedert sind. Komplizierter wird der Sachverhalt bei SozialarbeiterInnen, die bei privatrechtlich karitativen Stellen, die den Kirchen zugeordnet werden, angestellt sind. Ob die letztgenannten Einrichtungen „allerdings in den öffentlich-rechtlichen Körperschaftsstatus der Amtskirchen hineinwachsen (...) oder ob hierfür ein staatlicher Anerkennungsakt notwendig wäre (...), ist streitig“ (Brühl u. a. 2005, S. 652). Nach Auffassung von Hoffmann werden die kirchlichen Wohlfahrtsverbände klar von § 3 Nr. 1 RBerG erfasst und deren Vertreter dürfen Rechtsberatung und Rechtsbetreuung anbieten, somit auch die dort tätigen SozialarbeiterInnen (vgl. Hoffmann 2008, S. 2). 1969 hat das Bundesjustizministerium Folgendes fixiert:
„Spitzen- und Fachverbände dürfen ihre angeschlossenen Organisationen ohne besondere Erlaubnis nach dem Rechtsberatungsgesetz rechtlich beraten, wenn es sich um fremde Rechtsangelegenheiten handelt. Ob dies der Fall sei, hänge davon ab, ob die einzelne Organisation wirtschaftlich und verwaltungsmäßig vom übergeordneten Verband abhängig sei. Ferner dürfe gemäß § 8 Abs. 2 BSHG Rechtsberatung für Hilfsbedürftige geleistet werden, soweit Ansprüche aus diesem Gesetz betroffen seien“ (Hoffmann 2008, S. 2). Beratung in weiteren sozialen Angelegenheiten, inklusive der Klärung von Rechtsfragen, die zur persönlichen Hilfe zählen, dürfen Wohlfahrtsverbände durchführen. Adressaten sind hier hilfsbedürftige Personen. Die Rechtsberatung schließt stellenweise auch Gebiete aus anderen Rechtsfeldern ein, z. B. das Ausländerrecht (vgl. Hoffmann 2008, S. 2).
Die o. g. Regelungen im BSHG sind heute in den §§ 8, 10 Abs. 2 SGB XII verankert. Beratung und Betreuung in den letztgenannten Punkten wird wie folgt verstanden1:
- „Aufklärung über Ansprüche aufgrund eines anderen Sozialgesetzes und über Rechtsfragen aus sonstigen Rechtsgebieten (Ehe-, Unterhalt-, Miet-, Erb-, Arbeits- oder Ausländerrecht)
- Hilfen beim Abfassen oder beim Stellen von Anträgen
- Unterstützung bei Rückfragen und -sprachen im behördlichen Verfahren
- Hilfe bei der Besorgung und Zusammenstellung von Unterlagen einschließlich Verhandlungen mit Dritten“ (Brühl u. a. 2005, S. 653).
Jahrelang unklar war die Position der SozialarbeiterInnen bei freien Trägern, d. h. Initiativen und Vereinen, die keinem Wohlfahrtsverband angeschlossen sind. Stellenweise wurde deren Rechtsberatung aufgrund der fehlenden oder unklaren rechtlichen Position im RBerG von Rechtsanwälten und Amtsleiter attackiert. Um für die freien Träger Rechtssicherheit zu schaffen, hat sich der Bundestagspetitionsausschuss 1992 mit Zustimmung des Bundesjustizministeriums für eine großzügige Auslegung des § 5 RBerG ausgesprochen (vgl. Huchting 1997). „Danach wird ‚eine Rechtsberatung, die untrennbar verbunden ist mit einer im Vordergrund stehenden Erledigung einer sozialen Angelegenheit, welche ohne diese Rechtsberatung nicht vollständig oder nicht wirksam durchgeführt werden könnte’, durch das Rechtsberatungsgesetz nicht verboten. Der unmittelbare Zusammenhang zwischen psychologisch-pädagogischer Hilfeleistung und der Erörterung und Beratung von Rechtsfragen ist in aller Regel vorhanden“ (ebd.).
Die o. g. institutionellen Rahmenbedingungen zeigen deutlich, dass die Rechtsberatungsbefugnis von SozialarbeiterInnen nach derzeitigem Recht eine Entwicklung von Auslegungen war und ist und zumindest für KollegInnen aus den Wohlfahrtsverbänden und den freien Trägern eine rechtliche Grauzone bedeutet. Bekannt wurde in diesem Zusammenhang das Verfahren gegen den Sozialrechtler M. Hammel vom Caritas Verband Stuttgart. Im Jahr 2000 stellte ein Richter des Verwaltungsgerichts Stuttgart Anzeige gegen o. g. Person wegen des Verstoßes gegen das Rechtsberatungsgesetz in ca. 20 Fällen, da er Rechtsberatung von Sozialhilfeempfängern, Asylbewerbern und anderen sozial „Schwachen“ durchgeführt habe. Das Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Caritas Stuttgart und Herrn Hammel wurde von der zuständigen Staatanwaltschaft eingestellt. Als Begründung gab sie an, „das Dr. Hammel vorgeworfene Verhalten (...), sofern überhaupt eine Ordnungswidrigkeit festgestellt werden könne, nicht als schwerwiegend anzusehen, da Dr. Hammel aus altruistischen Motiven und in Erfüllung sozialer Zwecke gehandelt habe“ (Thome/Niewöhner). Die Anwaltskammer legte daraufhin Klage gegen Herrn Hammel und die Caritas Stuttgart wegen Verstoß gegen das Wettbewerbsgesetz in Verbindung mit Verstoß gegen das Rechtsberatungsgesetz ein. Das erstinstanzliche Urteil durch die Wirtschaftskammer des Landgerichtes Stuttgart fiel für die Angeklagten positiv aus: es sei vereinbar mit dem RBerG, dass die Caritas Stuttgart rechtsberatend tätig sei (vgl. http://www.tacheles-sozialhilfe.de/aktuelles/hammel/rechtsberatungsgesetz2.asp, zugegriffen am 21.02.2008). Das Oberlandesgericht in Stuttgart kam dann noch zu einer günstigeren Auffassung für die Caritas, in dem es ihr auch z. B. erlaubt wurde, die Klagen zu formulieren. Daraufhin zog die Anwaltskammer die Berufung zurück, so dass kein Urteil erging, da die Caritas Stuttgart keine Berufung ihrerseits nach dem Urteil des Landgerichtes Stuttgart eingelegt hatte (vgl. Blazevic). Das für die Soziale Arbeit insgesamt positive Urteil im Bereich der Rechtsberatung zeigt aber immer wieder Risiken, dass SozialarbeiterInnen erneut vor Gericht verklagt werden können. Der Auffassung von Heinhold1 folgend, behindert die sachrechte Auslegung der vorhandenen Gesetze nicht die Rechtsberatungsbefugnis der Sozialen Arbeit, aber eine klarere gesetzliche Regelung wäre notwendig (vgl. http://www.dbsh.de/redsys/soztop/userpages/Rechtsberatung1.html, zugegriffen am 22.02.2008).
[...]
1 Im Text wird immer die Berufsbezeichnung SozialarbeiterInnen gewählt, wobei SozialpädagogInnen und Soziale ArbeiterInnen subsumiert werden.
1 Ergebnisse aus Spitzengesprächen zwischen dem Bundesjustizministerium, der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, dem Deutschen Städte- und Gemeindebund, dem Deutschen Städtetag, dem Deutschen Landkreistag und dem Deutschen Anwaltsverein.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG)?
Das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) vom 12. Dezember 2007 ist ein Gesetz zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts, das am 1. August 2008 in Kraft trat. Es ersetzt das bisherige Rechtsberatungsgesetz (RBerG) vom 13. Dezember 1935.
Warum wurde das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) verabschiedet?
Das Rechtsberatungsgesetz (RBerG) stammte aus der Zeit des Nationalsozialismus und diente unter anderem dazu, jüdische Richter und Staatsanwälte an der Tätigkeit als Rechtsanwälte oder Rechtsberater zu hindern. Das RDG soll ein Mehr an Schutz für Ratsuchende bieten und den bürgerlichen Einsatz stärken.
Was sind die Eckpunkte des Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG)?
Die Eckpunkte des RDG umfassen die Erlaubnis von Rechtsdienstleistungen für alle Berufsgruppen, sofern sie als Nebenleistungen erbracht werden, die Erlaubnis der unentgeltlichen, altruistischen Rechtsdienstleistung, die Möglichkeit für Vereine, Mitglieder zu beraten, die Regelung des außergerichtlichen Bereichs und die Festlegung, dass eine umfassende Rechtsberatung weiterhin über Juristen mit dem zweiten Staatsexamen erfolgt.
Dürfen SozialarbeiterInnen Rechtsberatung anbieten?
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter der Arbeitgeber (Behörde, Wohlfahrtsverband, freier Träger) und der Umfang der Rechtsberatung. Nach dem alten Rechtsberatungsgesetz (RBerG) war die Rechtsberatung durch SozialarbeiterInnen oft eine rechtliche Grauzone. Das RDG sollte hier Klarheit schaffen.
Wie war die Rechtsberatung durch SozialarbeiterInnen nach dem Rechtsberatungsgesetz (RBerG) geregelt?
Nach dem RBerG war die geschäftsmäßige Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten grundsätzlich erlaubnispflichtig. SozialarbeiterInnen konnten Rechtsberatung anbieten, wenn sie bei Behörden oder Körperschaften des öffentlichen Rechts angestellt waren oder wenn die Rechtsberatung untrennbar mit einer im Vordergrund stehenden Erledigung einer sozialen Angelegenheit verbunden war.
Was ist mit SozialarbeiterInnen bei kirchlichen Wohlfahrtsverbänden?
Nach Auffassung von Hoffmann werden die kirchlichen Wohlfahrtsverbände von § 3 Nr. 1 RBerG erfasst, sodass deren Vertreter und somit auch die dort tätigen SozialarbeiterInnen Rechtsberatung und Rechtsbetreuung anbieten dürfen.
Was ist mit SozialarbeiterInnen bei freien Trägern?
Der Bundestagspetitionsausschuss hat sich 1992 für eine großzügige Auslegung des § 5 RBerG ausgesprochen, wonach eine Rechtsberatung, die untrennbar mit einer sozialen Angelegenheit verbunden ist, nicht verboten ist.
Was war der Fall Hammel (Caritas Stuttgart)?
Ein Richter zeigte den Sozialrechtler M. Hammel wegen Verstoßes gegen das Rechtsberatungsgesetz an. Das Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingestellt, und das Landgericht Stuttgart urteilte, dass die rechtsberatende Tätigkeit der Caritas Stuttgart vereinbar mit dem RBerG sei. Das Oberlandesgericht kam zu einer noch günstigeren Auffassung. Der Fall zeigt die Risiken für SozialarbeiterInnen im Bereich der Rechtsberatung.
Was bedeuten die §§ 8, 10 Abs. 2 SGB XII für die Rechtsberatung?
Diese Paragraphen verankern die Beratung und Betreuung von Hilfsbedürftigen, einschließlich der Aufklärung über Ansprüche aus Sozialgesetzen und Rechtsfragen aus anderen Rechtsgebieten, Hilfe beim Abfassen von Anträgen und Unterstützung im behördlichen Verfahren.
- Citation du texte
- Diplom-Sozialarbeiter Dario Deloie (Auteur), 2008, Rechtsdienstleistung in der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111671