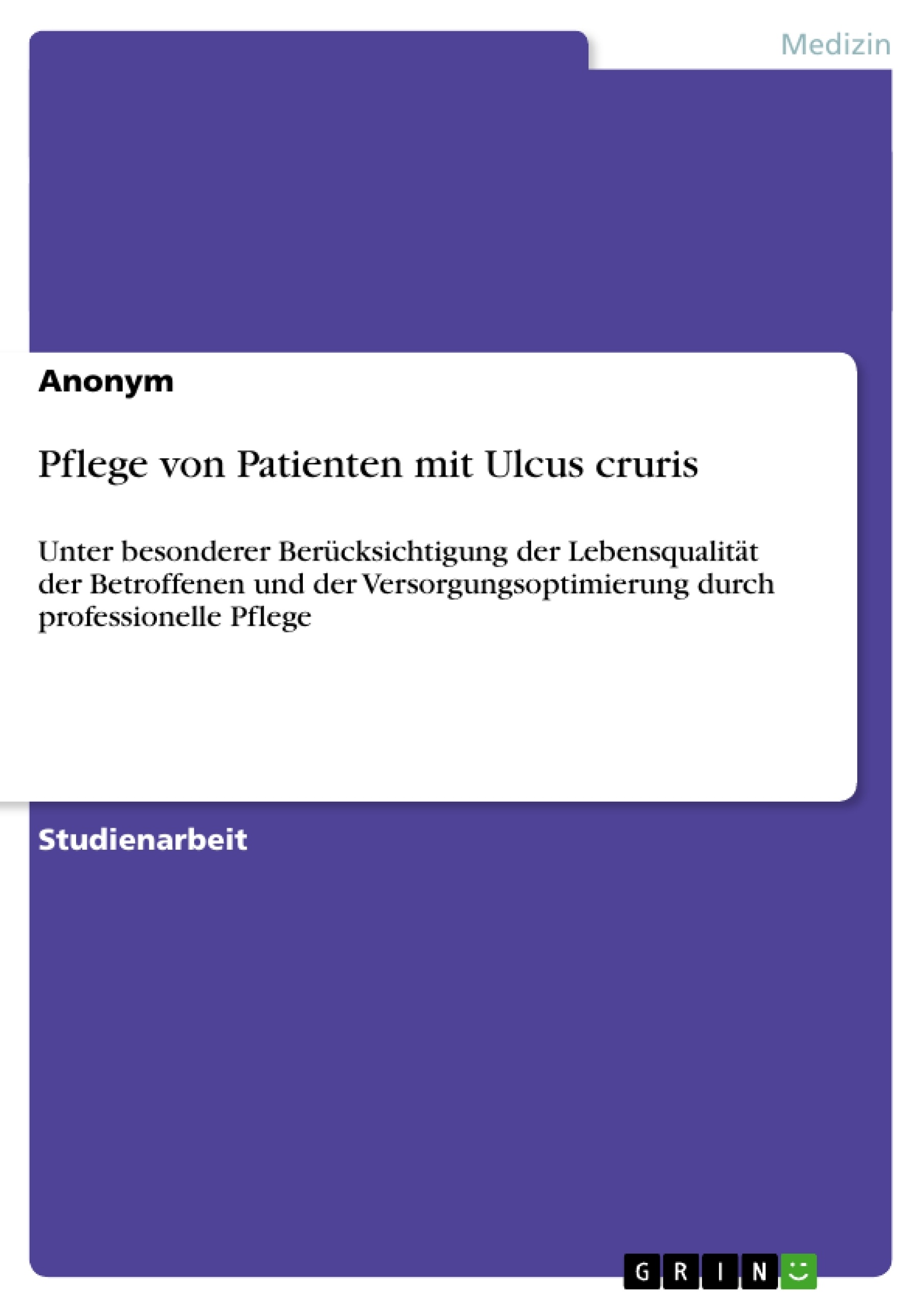Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Allgemeine Grundlagen
1.1 Epidemiologische Aspekte des Ulcus cruris
1.2 Ökonomische Aspekte des Ulcus cruris
1.3 Versorgungssituation von Patienten mit Ulcus cruris
2 Lebensqualität bei Ulcus cruris
2.1 Was ist Lebensqualität?
2.2 Einschränkungen der Lebensqualität bei Ulcus cruris
2.2.1 Schmerzen
2.2.2 Mobilität
2.2.3 Emotionale Reaktionen und Sozialleben
2.3 Beziehung zwischen Lebensqualität und Pflege
3 Pflegerische Aspekte bei der Betreuung von Patienten mit Ulcus cruris
3.1 Planung pflegebezogener Maßnahmen
3.2 Beratung, Schulung, Anleitung zum Selbstmanagement
3.3 Koordination, Umsetzung, Evaluation
3.4 Die Bedeutung von Caring bei Patienten mit Ulcus cruris
Resümee
Literaturverzeichnis
Einleitung
Chronische Wunden, wie das Ulcus cruris, gehören zu den häufigsten chronischen Erkrankungen in Deutschland. Geschätzte 2-3 Millionen Bundesbürger sind damit behaftet. Unterschenkelgeschwüre führen nicht nur zu immensen finanziellen Belastungen oder stellen unter den aktuellen gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen eine beachtliche sozio-ökonomische Herausforderung dar, wie diese Zahl verdeutlicht, sondern bedeuten sie ferner für die Betroffenen vielmehr erhebliche Einbußen der Lebensqualität. Diese Minderung geht jedoch nicht aus diesen Zahlen hervor. Viele Ulcus-Patienten haben einen langen Leidensweg aufgrund inadäquater und frustranter Therapieversuche hinter sich und fügen sich oftmals mit großer Schicksalsergebenheit in das anscheinend Unvermeidliche. Obwohl durch moderne und entsprechende Behandlungskonzepte das Ulcus cruris heute durchaus beherrschbar geworden ist, werden diese leider noch sehr unzureichend umgesetzt. Dies ist oftmals auch auf mangelnde Kenntnisse seitens der Ärzte, der Pflegenden und der Betroffenen selbst zurückzuführen. Denn gerade die Tatsache, dass es in den wenigsten Fällen zu einer schnellen Abheilung kommt, verursacht Probleme: Arzt und Patient verlieren die Geduld, unwissenschaftliche Polypragmasie ersetzt nicht selten ein konsequentes, adäquates Behandlungsmanagement, der Ulcus-Patient wird ein „teurer“ Patient. Aus Arztsicht werden beispielsweise Schwierigkeiten im Therapieprozess häufig durch „Non-Compliance“ der Patienten verursacht, Schmerzen und andere Probleme der Betroffenen werden hingegen oft unterschätzt.
Die folgende Arbeit soll sich an dieser Stelle jedoch auf den Pflegebereich der Versorgung von Menschen mit Ulcus cruris, speziell des am meisten verbreiteten Ulcus cruris venosum, beziehen. Die Einschränkungen in der Lebensqualität werden hier im Mittelpunkt stehen, beziehungsweise erklären diese zudem den Beweggrund dieser Arbeit. Denn für die Patienten stellt das Ulcus cruris zum Teil starke Reduktionen in den Bereichen körperliche Beschwerden, Alltags- und Sozialleben sowie Psyche dar.
Auch der sechste Expertenstandard des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) widmet sich diesem Thema. Ziel ist die gesundheitsbezogene Lebensqualität von Menschen mit chronischen Wunden, in diesem Fall mit Ulcus cruris venosum, zu fördern. Die vorliegende Arbeit soll aufzeigen, wie durch professionelle Pflege, verbunden mit fachgerechter Planung pflegebezogener Maßnahmen, Koordination und Umsetzung, Beratung, Schulung und Anleitung sowie Evaluation der Pflege, die Versorgung und damit auch die Lebensqualität der Betroffenen, optimiert sowie die Wundheilung unterstützt und die Rezidivbildung vermieden werden kann.
1 Allgemeine Grundlagen
In Deutschland leiden geschätzte 2-3 Millionen Menschen an chronischen Wunden.
Aber ab wann wird eine Wunde eigentlich als chronisch bezeichnet? Der Begriff „Wunde“ wird als „Verlust der Integrität eines Organs durch exogene und endogene Faktoren“ (Dissemond, 2007, S.14) verstanden. Am häufigsten ist hier die Haut, die mit ca. 2m2 zudem das größte Organ des Menschen darstellt, betroffen (ebd.). Das komplexe Geschehen der Wundheilung, wobei es zu einem kontrollierten Auf- und Abbau der verschiedenen Bestandteile einer Wunde kommt, umfasst physiologisch meist nicht länger als einen Zeitraum von 3 Wochen. Bislang fehlt jedoch eine weltweit einheitliche Definition der chronischen Wunde und es wird daher vorgeschlagen, den Terminus „chronische Wunde“ ab einem Zeitraum von 3 Monaten zu verwenden (Dissemond, 2006).
1.1 Epidemiologische Aspekte des Ulcus cruris
Von diesen 2-3 Millionen Betroffenen weisen 60-80% (ca. 1,5-2 Millionen) einen Ulcus cruris unterschiedlicher Genese auf (Dissemond, 2007, S.14). Zudem wird eine jährliche Inzidenz von etwa 200.000 beschrieben (Dissemond, 2007, S.17).
Der Terminus „Ulcus cruris“ ist ein Sammelbegriff für Wunden, die am Unterschenkel lokalisiert sind und beschreibt somit nur das Symptom, nicht aber die Diagnose. Dies wird erst durch den Zusatz der Genese beschrieben. Venöse und arterielle Erkrankungen sowie Neuropathien sind für 90% der Ulcera verantwortlich. Rund 70% aller Patienten leiden an einem Ulcus cruris venosum (Substanzdefekt der Haut; meist über den Innenknöcheln lokalisiert), 10% an einem Ulcus cruris arteriosum (Substanzdefekt infolge einer chronischen arteriellen Verschlusskrankheit im Bereich des Unterschenkels), weitere 10% an einem Ulcus cruris mixtum (arterio-venöse Genese) und letztlich 10% an einem Ulcus cruris anderer Genese (z.B. Hauterkrankungen oder -tumore, Traumen) (Dissemond, 2007, S.18).
Die Ursachen des Ulcus cruris können also sehr vielfältig sein, die chronische Veneninsuffizienz gilt jedoch mit 70-80% als die häufigste (Stücker et al., 2003, S.750), woraus auch die hohe Prävalenz des Ulcus cruris venosum resultiert. Zudem ist eine Reihe von Differenzialdiagnosen zu berücksichtigen, da bei den meisten Patienten mehrere Ursachen bestehen, die vor allem eine Abheilung des Ulcus cruris behindern. Die Klärung der Genese und Einleitung einer möglichst kausalen Therapie sollte also zwingend Basis einer erfolgreichen Behandlung darstellen (Dissemond, 2007).
Im Hinblick auf den demographischen Wandel, verbunden mit der steigenden Lebenserwartung und der Tatsache der stärkeren Betroffenheit von Frauen, ist davon auszugehen, dass die Zahl der Erkrankungen in den kommenden Jahren weiter ansteigen wird, da die Inzidenz im höheren Lebensalter zunimmt (Panfil et al., 2004).
Ein Ulcus cruris besteht bei ca. 50% der Patienten mindestens 1 Jahr, bei 20% mindestens
2 Jahre und bei 8% der Betroffenen mindestens 5 Jahre (Dissemond, 2007, S.17). Nach Abheilung des Ulcus cruris kann jedoch mit einer Rezidivrate von 60-90% gerechnet werden, was die Chronizität des Ulcus cruris, neben der Dauer, gleichermaßen begründet. Ein Drittel der Betroffenen erleiden einmalig ein Rezidiv, ebenfalls ein Drittel 2-3 Rezidive und ein weiteres Drittel der Patienten erleiden sogar mindestens 4-5 Rezidive (ebd.). Diese hohen Rezidivraten stellen somit häufig das eigentliche Problem der Behandlung dar, so dass am Ende jeder Behandlung die Prävention eines Ulcusrezidivs im Vordergrund stehen sollte.
1.2 Ökonomische Aspekte des Ulcus cruris
Letztlich stellt das Ulcus cruris auch einen erheblichen Kostenfaktor dar. Folgeerkrankungen eines Venenleidens verursachen jährlich allein einen Verlust von 2,8 Millionen Arbeitstagen. Durch diese Arbeitsunfähigkeit und der durchschnittlich 8,5 Jahre früheren Berentung, verglichen mit der Normalbevölkerung, resultieren somit jährlich horrende finanzielle Belastungen. Die durchschnittliche Liegedauer im Krankenhaus bei Ulcus cruris beträgt 15,8 Tage, was für die gesetzliche Krankenkasse eine jährliche Kostenbelastung von mindestens 1.02 Milliarden Euro ausmacht. Durch die ambulante Versorgung resultieren nochmals weitere 0,61 Milliarden Euro Kosten. Die Behandlungskosten eines Patienten mit Ulcus cruris können daher auf durchschnittlich 1.500 Euro pro Jahr geschätzt werden (Dissemond, 2007, S.17).
Indessen lassen sich in der Versorgung des Ulcus cruris sehr wohl erhebliche wirtschaftliche Spielräume finden. So ist beispielsweise die ambulante Versorgung in Zusammenarbeit mit qualifizierten Wundzentren oder unter Hinzuziehung pflegerischer Fachexperten der stationären Behandlung bei unkomplizierten Ulcera wirtschaftlich überlegen und die Initial höheren Kosten des modernen Wundmanagements können bei verkürztem Behandlungsverlauf ökonomischer sein, als die Produkte der leider immer noch verbreiteten trockenen Wundversorgung. Doch insbesondere in der ambulanten Pflege wird von zusätzlichen Einschränkungen der Versorgung aufgrund von Kostenüberlegungen berichtet.
Ein ebenfalls wichtiger Faktor für ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis stellt auch die Patienten-Compliance dar (Debus et al., 2003).
1.3 Versorgungssituation von Patienten mit Ulcus cruris
Zur Versorgungssituation der chronischen Wunden liegen bislang nur wenige verlässliche Daten vor. Eindeutig ist jedenfalls, dass eine adäquate Versorgung des Ulcus cruris eine gute Zusammenarbeit zwischen betreuenden Ärzten, ambulanten Pflegediensten und Patienten erfordert. Jedoch kann Untersuchungen zufolge postuliert werden, dass hier sowohl bei den Pflegenden als auch bei den Ärzten Defizite, was die Kenntnis einer adäquaten Wundversorgung angeht, bestehen. So wird ein Grossteil der chronischen Wunden in Deutschland nicht nach modernen Standards behandelt und aktuelle Leitlinien der Fachgesellschaften finden bislang keine ausreichende Umsetzung (Meyer & Schlömer, 2004). Der aktueller Expertenstandard zur Pflege von Menschen mit chronischen Wunden (DNQP) wird im weiteren Verlauf noch vorstellt.
Etwa 80% der Betroffenen mit Ulcus cruris werden ambulant behandelt (Meyer & Schlömer, 2004). In der ambulanten Pflege wird die Wundversorgung bei 58 % der Betroffenen einmal täglich durchgeführt, bei 21 % der Fälle zweimal täglich und 8 % der Betroffenen erfahren die Versorgung sogar mehr als zweimal täglich. Hier beziehen sich die Angaben jedoch nicht ausschließlich auf das Ulcus cruris, sondern auf die Versorgung aller chronischen Wunden in der häuslichen Pflege (Laible, 2000, S.9).
So kann dennoch angenommen werden, dass ein auf eine wissenschaftliche Leitlinie gestütztes Behandlungsmanagement die ambulante Versorgung von Patienten mit Ulcus cruris entscheidend optimieren könnte (Meyer & Schlömer, 2004).
Ebenso wichtig wie die Behandlung der Wunde ist jedoch auch die eigentliche Pflege der Patienten mit Wunde, die oftmals noch zu wenig Berücksichtigung findet (Laible, 2000), denn für die Betroffenen bedeutet ein Leben mit Ulcus cruris erhebliche Einschränkungen ihres Alltags und ihrer Lebensqualität, was nun im Folgenden näher beschrieben werden soll.
2 Lebensqualität bei Ulcus cruris
Im biomedizinischen Verständnis sind Krankheiten lokalisierbare Störungen, wobei unterstellt wird, dass diese von den betroffenen Personen auch in gleicher Weise wahrgenommen werden. Übersehen wird bei dieser Annahme der Parallelität von objektiven, organmedizinischen Befunden und subjektiven, psychischen Befinden jedoch, dass sich die Auseinandersetzung mit einer Krankheit in der Vorstellungswelt der Betroffenen abspielt, was bedeutet, dass der Krankheitsbefund sich nicht immer auch gleichzeitig mit dem Krankheitsgefühl deckt (Voges, 2006).
Krankheiten haben zudem im Lebensverlauf eine unterschiedliche objektive uns subjektive Bedeutung. Die Inzidenz des Ulcus cruris, wie oben beschrieben, nimmt im höheren Lebensalter zu. Es ergibt sich hier mit zunehmendem Alter oftmals eine Diskrepanz zwischen objektiven Befund und subjektiven Beschwerden. So gehen im höheren Alter in die Beurteilung andere Kriterien ein als in jüngeren Jahren, in denen sie im Wesentlichen am objektiven Gesundheitszustand ausgerichtet sind. Im Alter zeigt sich beispielsweise ein schwächerer Zusammenhang zwischen sozioökonomischen Status und Krankheitsgefühl, hier sind es vielmehr individuelle Ressourcen wie Alltagskompetenz und Bewältigungsstil, die die Wahrnehmung von gesundheitlichen Beeinträchtigungen als Beschwerden beeinflussen. So kann etwa die Fähigkeit Betroffener, ihre Lebensweise an die Krankheit anzupassen, dazu beitragen, dass sie mit oder trotz der Erkrankung ein positives Lebensgefühl entwickeln. Gesundheit bedeutet also im Alter weniger das Freisein von Krankheit, sondern vielmehr von funktionellen Einschränkungen und quälenden Beschwerden (Voges, 2006).
2.1 Was ist Lebensqualität?
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Ulcus cruris?
Der Ulcus cruris ist ein Sammelbegriff für Wunden am Unterschenkel. Es ist ein Symptom, keine Diagnose. Die häufigste Ursache ist die chronische Veneninsuffizienz (Ulcus cruris venosum).
Wie häufig ist der Ulcus cruris in Deutschland?
Geschätzte 2-3 Millionen Menschen in Deutschland leiden an chronischen Wunden, davon haben 60-80% einen Ulcus cruris. Die jährliche Inzidenz beträgt etwa 200.000 Fälle.
Welche Ursachen hat der Ulcus cruris?
Die häufigste Ursache ist die chronische Veneninsuffizienz (70-80%). Weitere Ursachen sind arterielle Erkrankungen (Ulcus cruris arteriosum), Neuropathien und Mischformen (Ulcus cruris mixtum). Seltenere Ursachen sind Hauterkrankungen, Tumore oder Traumen.
Welche wirtschaftlichen Auswirkungen hat der Ulcus cruris?
Der Ulcus cruris verursacht erhebliche Kosten durch Arbeitsunfähigkeit, frühe Berentung und Behandlungskosten. Die durchschnittlichen Behandlungskosten pro Patient und Jahr werden auf 1.500 Euro geschätzt.
Wie sieht die Versorgungssituation von Patienten mit Ulcus cruris aus?
Eine adäquate Versorgung erfordert eine gute Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Pflegediensten und Patienten. Es gibt jedoch Defizite bei den Kenntnissen über eine adäquate Wundversorgung. Etwa 80% der Betroffenen werden ambulant behandelt.
Was bedeutet Lebensqualität bei Ulcus cruris?
Das Ulcus cruris kann die Lebensqualität der Betroffenen erheblich beeinträchtigen, insbesondere in den Bereichen körperliche Beschwerden, Alltags- und Sozialleben sowie Psyche. Die gesundheitsbezogene Lebensqualität ist ein wichtiges Kriterium bei der Behandlung.
Welche Bedeutung hat die Pflege bei der Behandlung von Ulcus cruris?
Die Pflege spielt eine wichtige Rolle bei der Behandlung von Ulcus cruris, insbesondere durch Planung pflegebezogener Maßnahmen, Beratung, Schulung, Anleitung zum Selbstmanagement, Koordination, Umsetzung und Evaluation der Pflege. Ziel ist die Optimierung der Versorgung, Unterstützung der Wundheilung und Vermeidung von Rezidiven.
Was sind die Hauptprobleme bei der Behandlung des Ulcus cruris?
Häufige Probleme sind mangelnde Kenntnisse über moderne Behandlungsstandards, inadäquate Therapieversuche, lange Behandlungsdauer, hohe Rezidivraten und mangelnde Patienten-Compliance. Die Prävention von Rezidiven ist von großer Bedeutung.
Was ist bei der Behandlung des Ulcus cruris zu beachten?
Wichtig ist die Klärung der Genese, Einleitung einer kausalen Therapie, moderne Wundversorgung, adäquate Schmerztherapie, Kompressionstherapie und Schulung der Patienten. Die Prävention von Rezidiven ist ein zentrales Ziel.
Wie hoch sind die Rezidivraten beim Ulcus cruris?
Nach Abheilung des Ulcus cruris kann mit einer Rezidivrate von 60-90% gerechnet werden. Ein Drittel der Betroffenen erleiden einmalig ein Rezidiv, ein weiteres Drittel 2-3 Rezidive und das letzte Drittel mindestens 4-5 Rezidive.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2008, Pflege von Patienten mit Ulcus cruris, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111887