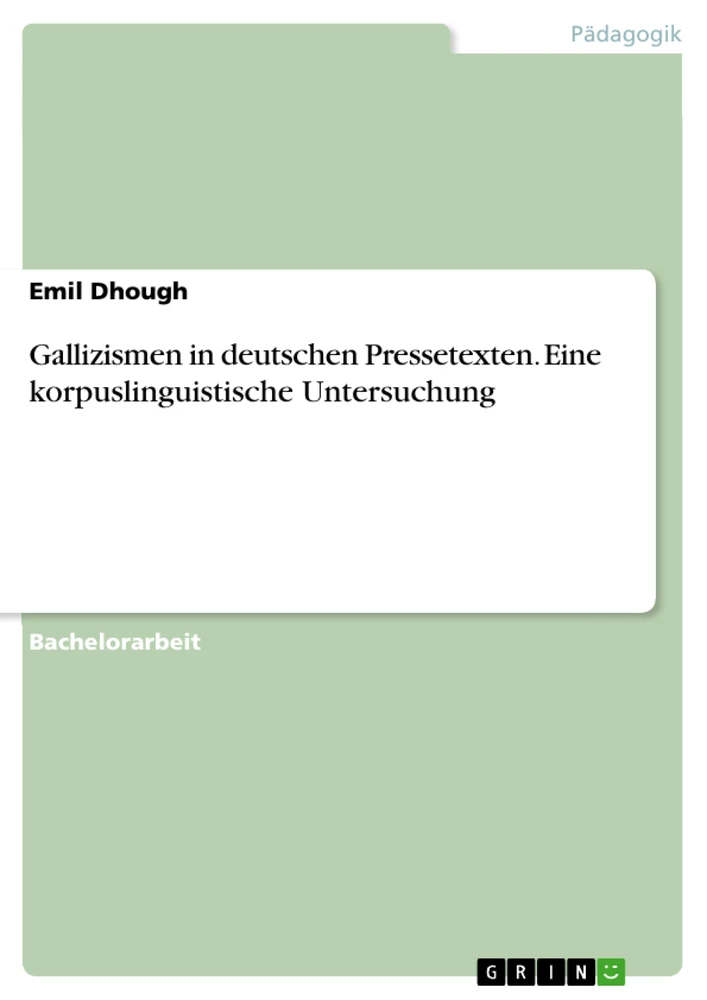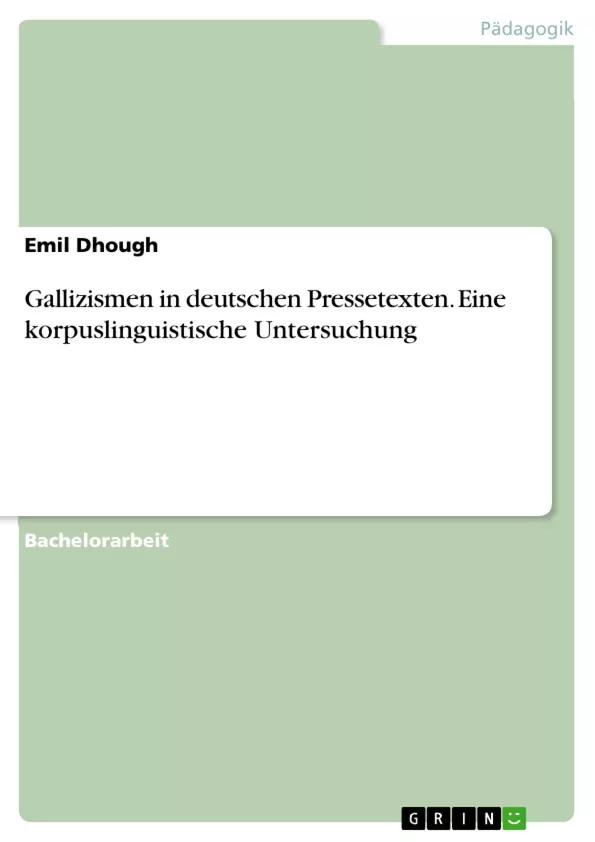Das Französische wird seit jeher als Prestigesprache angesehen und fand demnach auch Eingang ins Deutsche. So beginnt der Einfluss des Französischen auf die deutsche Sprache bereits im frühen Mittelalter und hat ihren Höhepunkt im 17. Jahrhundert.
Nun stellt sich aber die Frage, ob dieser stete Einfluss des Französischen in der Vergangenheit auch gegenwärtig bzw. auch in Zukunft Auswirkungen auf die deutsche Sprache hat. Nachdem die konkreten Gründe für den enormen Einfluss des Französischen auf das Deutsche erst im Laufe dieser Arbeit erörtert werden, liegt vorab noch die Vermutung nahe, dass die geografische Lage Deutschlands und die somit einhergehende Nähe zu Frankreich für die hohe Frequenz von Gallizismen in westdeutschen Tageszeitungen ausschlaggebend sind.
Um diese These bewerten zu können, wird im zweiten Teil dieser Arbeit anhand einer korpuslinguistischen Untersuchung für eine bundesweite Repräsentation vier regionale Tageszeitungen analysiert, inwieweit sich die Frequenzen ausgewählter Gallizismen jeweils unterscheiden. Pressetexte als Material für empirische Untersuchungen heranzuziehen, bietet eine große Bandbreite an Optionen der Interpretation hinsichtlich des Auftretens von Fremdwörtern.
Zunächst werden im theoretischen Teil Grundlagen geschaffen, wobei ein Abriss der deutsch-französischen Geschichte skizziert wird und anschließend die Termini Fremdwort und Lehnwort in Abgrenzung zu Gallizismus definiert werden. An dieser Stelle wird der Eingang des Französischen ins Deutsche diachron näher betrachtet, um im Anschluss die Gründe für den Einfluss hervorzubringen. Im weiteren Verlauf werden kommunikative Umgebungen bzw. Wissenschaftsräume, in denen Gallizismen integriert wurden, durchleuchtet. Eine Übersicht über den aktuellen Forschungsstand soll ab-schließend den zu untersuchenden Gegenstand umreißen.
Im Empirie-Teil werden darauffolgend Gallizismen der untersuchten Zeitungen anhand selbst erstellter Themen-Cluster übersichtlich unter Zuhilfenahme von Kreuztabellen gegenübergestellt. Hierbei erweist es sich als besonders beachtenswert, die Themenbereiche zu analysieren, in denen vermehrt Gallizismen auftreten. Dabei werden zunächst das verwendete Korpus sowie das genaue Vorgehen in der Untersuchung vorgestellt.
Ob und inwieweit sich die eingangs formulierte These bestätigen bzw. widerlegen lässt, wird in einer Ergebnispräsentation mit anschließender Diskussion dargelegt.
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- I Theoretische Grundlagen
- 1 Historischer Abriss
- 1.1 Kultur- und Sprachgeschichtlicher Einfluss des Französischen auf das Deutsche
- 1.1.1 Entlehnungen im Mittelalter
- 1.1.2 Entlehnungen im 17. und 18. Jahrhundert
- 1.1.3 Sprachpurismus und Sprachkritik
- 1.1.4 Entlehnungen ab dem 19. Jahrhundert
- 1.2 Das Französische in deutschen Dialekten
- 1.2.1 Brandenburg
- 1.2.2 Saarland
- 2 Fremdwort - Lehnwort - Gallizismus
- 2.1 Begriffsbestimmungen
- 2.1.1 Fremdwort
- 2.1.2 Abgrenzung zum Lehnwort
- 2.1.3 Gallizismus und Scheingallizismus
- 2.2 Phonologische, graphematische, morphologische und lexikalisch-semantische Transferenzen und Integrationen
- 2.2.1 Phonologische Transferenz und Integration
- 2.2.2 Graphematische Transferenz und Integration
- 2.2.3 Morphologische Transferenz und Integration
- 3 Forschungsstand: Fremdwörter und Gallizismen in der Pressesprache und deren Funktion/Wirkung
- II Korpuslinguistische Untersuchung
- 4 Methodisches Vorgehen
- 4.1 Forschungsdesign
- 4.1.1 Forschungsmethode
- 4.1.2 Forschungsgegenstand und Charakterisierung der untersuchten Medien
- 4.1.3 Datensammlung
- 4.1.3 Analysemethode
- 5 Datenerhebung
- 5.1 Politik
- 5.2 Wirtschaft
- 5.3 Feuilleton
- 5.4 Sport
- 5.5 Weitere Gallizismen (die sich keinem Zeitungsressort zuordnen lassen)
- 6 Datenauswertung
- 7 Ergebnispräsentation und Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Vorkommen von Gallizismen in deutschen Pressetexten mittels korpuslinguistischer Methoden. Ziel ist es, die Verbreitung und Verwendung dieser französischen Lehnwörter in verschiedenen Ressorts zu analysieren und deren Funktion und Wirkung in der heutigen Medienlandschaft zu beleuchten.
- Historische Entwicklung der französischen Lehnwortbildung im Deutschen
- Begriffliche Abgrenzung von Fremdwörtern, Lehnwörtern und Gallizismen
- Korpuslinguistische Analyse der Gallizismen in ausgewählten deutschen Zeitungen
- Vergleich der Gallizismenhäufigkeit in verschiedenen Ressorts (Politik, Wirtschaft, Feuilleton, Sport)
- Funktion und Wirkung von Gallizismen in der deutschen Pressesprache
Zusammenfassung der Kapitel
0 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und skizziert die Forschungsfrage nach der Verbreitung und Funktion von Gallizismen in deutschen Pressetexten. Sie begründet die Relevanz des Themas und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit. Es wird die Methodik der korpuslinguistischen Untersuchung erläutert und der Rahmen der Arbeit abgesteckt.
I Theoretische Grundlagen: Dieser Teil legt die theoretischen Grundlagen der Untersuchung dar. Er umfasst einen historischen Abriss des Einflusses des Französischen auf die deutsche Sprache, beleuchtet die Entwicklung von Entlehnungen über verschiedene Jahrhunderte hinweg und analysiert den Einfluss von Sprachpurismus und Sprachkritik auf diesen Prozess. Es werden wichtige Begriffe wie Fremdwort, Lehnwort und Gallizismus definiert und abgegrenzt, wobei die Besonderheiten von Gallizismen im Fokus stehen. Die phonologischen, graphematischen, morphologischen und lexikalisch-semantischen Aspekte der Integration französischer Elemente in die deutsche Sprache werden detailliert erörtert. Der Abschnitt schließt mit einem Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema Fremdwörter und Gallizismen in der Pressesprache.
II Korpuslinguistische Untersuchung: Dieser Abschnitt beschreibt die methodische Vorgehensweise der korpuslinguistischen Untersuchung. Das Forschungsdesign wird detailliert erläutert, inklusive der gewählten Forschungsmethode, der Charakterisierung der untersuchten Medien (verschiedene Zeitungen) und der angewandten Analysemethoden. Es wird erklärt, wie die Daten erhoben und ausgewertet wurden.
4 Methodisches Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der Studie. Es erläutert das gewählte Forschungsdesign, die spezifische Forschungsmethode, die Auswahl der untersuchten Zeitungen und deren Charakteristika (z.B. regionale Unterschiede, politische Ausrichtung). Die Datensammlung und die Analysemethoden werden präzise dargelegt, um die wissenschaftliche Fundiertheit der Untersuchung zu gewährleisten.
5 Datenerhebung: In diesem Kapitel wird die Datenerhebung der Studie beschrieben. Die gesammelten Daten werden nach den Ressorts Politik, Wirtschaft, Feuilleton und Sport kategorisiert und analysiert. Die systematische Erhebung der Gallizismen in den unterschiedlichen Ressorts liefert die Grundlage für die quantitative und qualitative Auswertung im Folgeabschnitt.
6 Datenauswertung: Dieses Kapitel fokussiert sich auf die Auswertung der im vorherigen Kapitel erhobenen Daten. Hier werden die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Analysen präsentiert und interpretiert, um die Verbreitung und Verwendung von Gallizismen in den verschiedenen Zeitungsressorts zu beleuchten. Es wird auf statistische Auswertungen und deren Interpretation eingegangen.
7 Ergebnispräsentation und Diskussion: Dieses Kapitel präsentiert und diskutiert die Ergebnisse der Studie. Es werden die Ergebnisse der Datenauswertung präsentiert, Zusammenhänge aufgezeigt und die Ergebnisse im Kontext des aktuellen Forschungsstandes eingeordnet. Die Diskussion umfasst die Interpretation der Ergebnisse, die Berücksichtigung von Limitationen der Studie und der Ausblick auf mögliche zukünftige Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Gallizismen, Pressetexte, Korpuslinguistik, Fremdwörter, Lehnwörter, Sprachkontakt, Mediensprache, französische Sprache, deutsche Sprache, Sprachgeschichte, Quantitative Analyse, Qualitative Analyse, Zeitungsressorts.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Gallizismen in deutschen Pressetexten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Vorkommen und die Verwendung von Gallizismen (französischen Lehnwörtern) in deutschen Pressetexten. Sie analysiert deren Verbreitung in verschiedenen Ressorts und beleuchtet deren Funktion und Wirkung in der heutigen Medienlandschaft mittels korpuslinguistischer Methoden.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung französischer Lehnwortbildung im Deutschen, die begriffliche Abgrenzung von Fremdwörtern, Lehnwörtern und Gallizismen, eine korpuslinguistische Analyse von Gallizismen in ausgewählten deutschen Zeitungen, einen Vergleich der Gallizismenhäufigkeit in verschiedenen Ressorts (Politik, Wirtschaft, Feuilleton, Sport) und schließlich die Funktion und Wirkung von Gallizismen in der deutschen Pressesprache.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine korpuslinguistische Methode. Das bedeutet, dass ein Korpus (eine Sammlung von Texten) aus verschiedenen deutschen Zeitungen analysiert wird, um die Häufigkeit und den Gebrauch von Gallizismen zu untersuchen. Die Daten werden quantitativ und qualitativ ausgewertet.
Welche Daten werden verwendet?
Die Daten bestehen aus Pressetexten verschiedener deutscher Zeitungen, die nach den Ressorts Politik, Wirtschaft, Feuilleton und Sport kategorisiert wurden. Zusätzlich werden Gallizismen berücksichtigt, die keinem spezifischen Ressort zugeordnet werden können.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist in zwei Hauptteile gegliedert: Ein theoretischer Teil (Kapitel 0-3) legt die Grundlagen, einschließlich historischer Entwicklung, begrifflicher Klärung und Forschungsstand. Der zweite Teil (Kapitel 4-7) beschreibt die methodische Vorgehensweise, die Datenerhebung und -auswertung sowie die Ergebnispräsentation und -diskussion.
Welche Ergebnisse werden erwartet?
Die Arbeit erwartet Ergebnisse zur Verbreitung und Verwendung von Gallizismen in verschiedenen Presse-Ressorts. Es sollen quantitative und qualitative Aussagen zur Häufigkeit, den Funktionen und der Wirkung dieser Lehnwörter getroffen werden. Die Ergebnisse werden im Kontext des aktuellen Forschungsstandes diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gallizismen, Pressetexte, Korpuslinguistik, Fremdwörter, Lehnwörter, Sprachkontakt, Mediensprache, französische Sprache, deutsche Sprache, Sprachgeschichte, Quantitative Analyse, Qualitative Analyse, Zeitungsressorts.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Linguisten, Sprachwissenschaftler, Medienwissenschaftler und alle, die sich für Sprachkontakt, Lehnwortbildung und die Entwicklung der deutschen Sprache interessieren. Sie bietet Einblicke in die aktuelle Mediensprache und die Verwendung von Fremdwörtern im Journalismus.
- Arbeit zitieren
- Emil Dhough (Autor:in), 2020, Gallizismen in deutschen Pressetexten. Eine korpuslinguistische Untersuchung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1119007