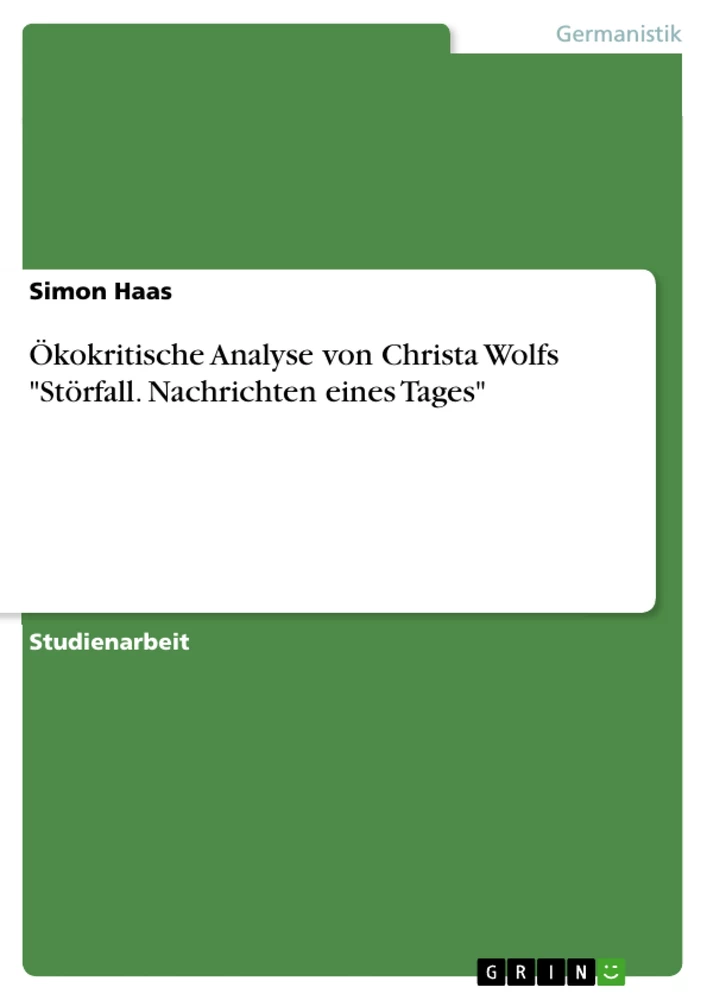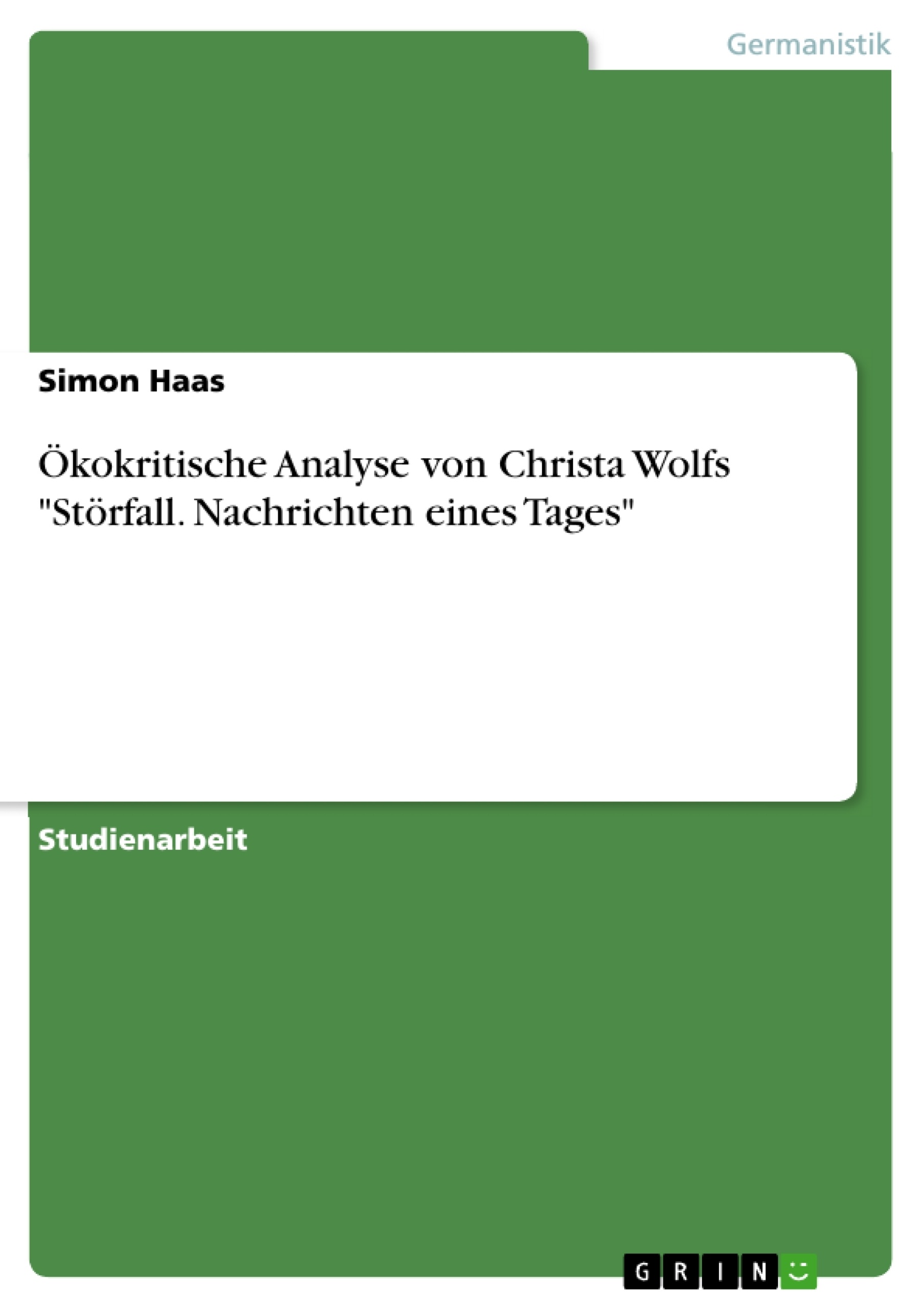In dieser Proseminararbeit soll eine ökokritische Analyse basierend auf Close-Reading durchgeführt werden. Primär wird hierzu Christa Wolfs Erzählung selbst als Quelle verwendet, wobei auch einschlägige Sekundärliteratur mit einbezogen wird. Das Hauptaugenmerk liegt bei dieser Analyse auf dem, in der Erzählung beschriebenen, technischen Fortschritt und der Frage, welche Opfer man bereit ist, für diesen Fortschritt zu erbringen. Anhand ausgewählter Textstellen soll die Ambivalenz deutlich werden, die diese technologische Weiterentwicklung mit sich bringt und eine Tendenz erkennbar gemacht werden, ob in diesem Werk die Vor- oder die Nachteile von ebendieser Entwicklung im Vordergrund stehen.
Mit der Erzählung "Störfall. Nachrichten eines Tages" schuf die Autorin Christa Wolf 1987 ein Werk, das sich thematisch sehr gut mit dem Proseminarthema des Ecocriticism verbinden lässt. Die deutsche Literaturwissenschaftlerin Ursula Heise beschreibt Ecocriticism als interdisziplinäre Forschungsrichtung, die sich beispielsweise mit dem Zusammenhang von Mensch und Natur, etwa in Bezug auf das Verhältnis von konkreten Naturräumen zu abstrakten Räumen, wie zum Beispiel Staatsgebieten, beschäftigt, oder den Konflikt zwischen realistischem und konstruktivistischem Naturverständnis diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Pro und Contra des technischen Fortschritts
- Fortschritt als Bedrohung
- Fortschritt als Chance
- Heiligt der Zweck die Mittel?
- Conclusio
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Proseminararbeit beschäftigt sich mit Christa Wolfs Erzählung "Störfall. Nachrichten eines Tages" und analysiert diese aus ökokritischer Perspektive. Die Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen des technischen Fortschritts auf die Gesellschaft und die Natur, insbesondere im Kontext des Reaktorunglücks von Tschernobyl.
- Ambivalenz des technischen Fortschritts
- Die Bedrohung durch die Entmenschlichung
- Die Frage der Opferbereitschaft für den Fortschritt
- Kritik an der unreflektierten Nutzung von Technologie
- Das Verhältnis von Mensch und Natur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Erzählung "Störfall. Nachrichten eines Tages" von Christa Wolf vor und skizziert den ökokritischen Ansatz der Analyse.
Pro und Contra des technologischen Fortschritts
Dieses Kapitel analysiert die ambivalente Darstellung des technischen Fortschritts in "Störfall", sowohl in Bezug auf seine potenziellen Gefahren (z.B. Reaktorunfall) als auch seine positiven Aspekte (z.B. medizinischer Fortschritt).
Fortschritt als Bedrohung
Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die negativen Folgen des technischen Fortschritts, insbesondere die Kritik an der Kernspaltung und der damit verbundenen Risiken.
Fortschritt als Chance
Dieser Abschnitt untersucht die positiven Seiten des technischen Fortschritts und zeigt, wie er zur Lösung von Problemen beitragen kann.
Heiligt der Zweck die Mittel?
Dieser Abschnitt thematisiert die ethische Frage, welche Opfer man für den technischen Fortschritt bereit ist zu bringen und welche Risiken man dafür eingehen möchte.
Schlüsselwörter
Ökokritik, Christa Wolf, Störfall, technischer Fortschritt, Reaktorunglück, Tschernobyl, Entmenschlichung, Natur, Mensch, Risiko, Opferbereitschaft, Ambivalenz, Umwelt
- Arbeit zitieren
- Simon Haas (Autor:in), 2018, Ökokritische Analyse von Christa Wolfs "Störfall. Nachrichten eines Tages", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1119219