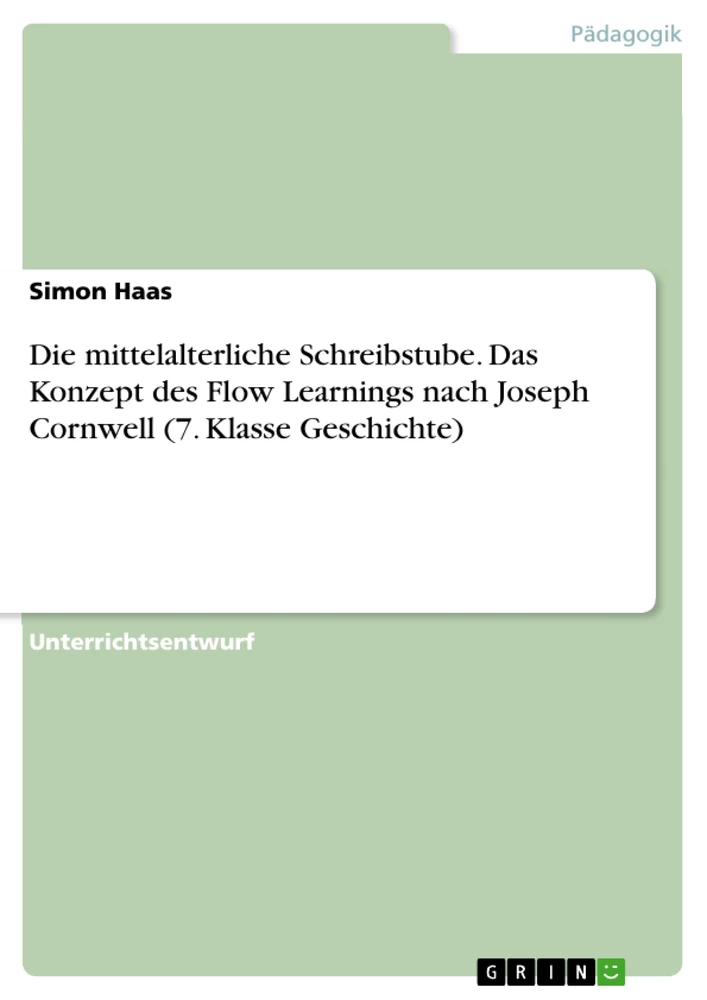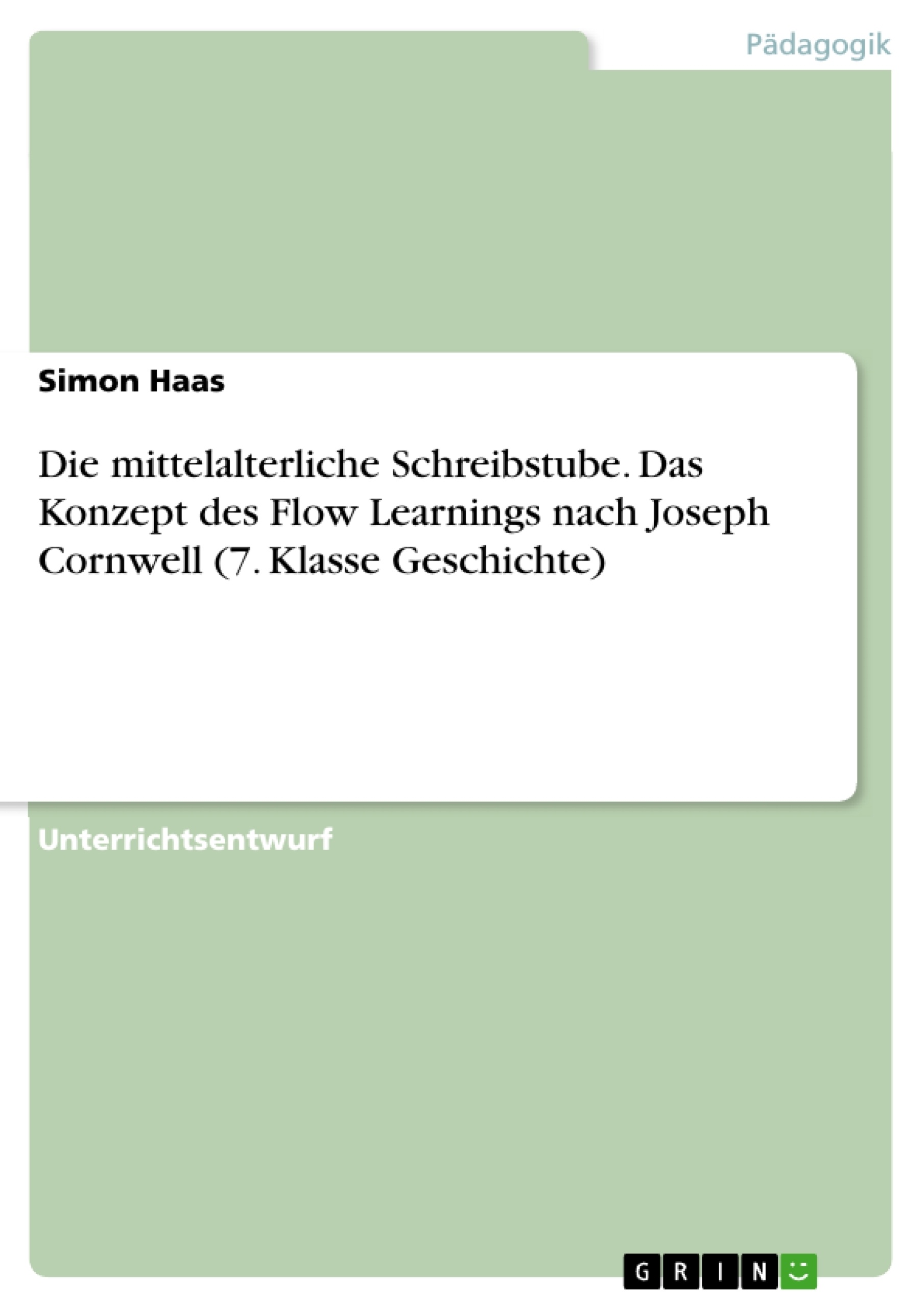Bei diesem Unterrichtsentwurf handelt es sich um ein Vermittlungskonzept der mittelalterlichen Schreibstube für den Unterricht mit Hilfe des Konzeptes des Flow Learnings von Joseph Cornell.
Die Planung ist in vier Phasen unterteilt, welche sich an dem zuvor beschriebenen Konzept des Flow-Learnings orientieren. Ziel der Sequenz ist das Erlangen einer gewissen historischen Sachkompetenz hinsichtlich den mittelalterlichen Schreibstuben, soziale, sowie Kommunikationskompetenz. Weiters werden niederschwellig die historische Orientierungs-, Methoden und Fragekompetenz verbessert.
Inhaltsverzeichnis
- Sachanalyse
- Konzept des Flow Learnings
- 1. Ebene: Begeisterung wecken
- 2. Ebene: Konzentrierte Wahrnehmung
- 3. Ebene: Unmittelbare Erfahrung
- 4. Ebene: Anregungen teilen
- Planung/Methodik
- Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Vermittlungskonzept zielt darauf ab, Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I (7. Schulstufe) ein tieferes Verständnis für die Funktionsweise mittelalterlicher Schreibstuben zu vermitteln und dabei gleichzeitig verschiedene Kompetenzen, wie historische Sachkompetenz, soziale und Kommunikationskompetenz, sowie historische Orientierungs-, Methoden- und Fragekompetenz zu fördern.
- Der Herstellungsprozess mittelalterlicher Bücher
- Die Bedeutung von Flow Learning für den Lernerfolg
- Die Anwendung von Flow Learning-Prinzipien im Unterricht
- Die Entwicklung von Selbstverantwortung und kritischem Denken bei Schülerinnen und Schülern
- Der Zusammenhang zwischen historischen Entwicklungen und aktuellen gesellschaftlichen Phänomenen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beschreibt den Herstellungsprozess mittelalterlicher Bücher, von der Materialbeschaffung bis zur Bindung. Die zweite Phase beleuchtet das Konzept des Flow Learnings, ein pädagogisches Konzept, das auf die Förderung von intrinsischer Motivation und nachhaltigem Lernen ausgerichtet ist. Der dritte Teil des Textes konzentriert sich auf die konkrete Planung und Methodik einer Unterrichtseinheit, die auf dem Flow Learning-Konzept basiert. Die vierte und letzte Phase reflektiert die Vor- und Nachteile des vorgestellten Konzepts und betont die Bedeutung von Selbstverantwortung und kritischem Denken im Bildungsprozess.
Schlüsselwörter
Mittelalterliche Schreibstube, Buchherstellung, Flow Learning, Vermittlungskonzept, Projektunterricht, historische Sachkompetenz, soziale Kompetenz, Kommunikationskompetenz, historische Orientierung, Methodenkompetenz, Fragekompetenz, Selbstverantwortung, kritisches Denken.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Konzept des Flow Learnings nach Joseph Cornell?
Flow Learning ist ein pädagogisches Modell, das in vier Phasen (Begeisterung wecken, konzentrierte Wahrnehmung, unmittelbare Erfahrung, Anregungen teilen) die intrinsische Motivation und tiefes Lernen fördert.
Wie wird die mittelalterliche Schreibstube im Unterricht vermittelt?
Schüler erleben den Prozess der Buchherstellung – von der Materialbeschaffung bis zum Schreiben – aktiv nach, anstatt nur theoretische Fakten zu lernen.
Welche Kompetenzen erwerben die Schüler in dieser Sequenz?
Neben historischer Sachkompetenz werden soziale Kompetenzen, Kommunikationsfähigkeit sowie Methoden- und Fragekompetenz gestärkt.
Warum ist Selbstverantwortung im Flow Learning wichtig?
Das Konzept zielt darauf ab, dass Schüler den Lernprozess als sinnvoll und selbstgesteuert wahrnehmen, was zu nachhaltigerem Wissenserwerb führt.
Für welche Altersgruppe ist dieser Entwurf konzipiert?
Der Unterrichtsentwurf ist speziell für die 7. Schulstufe (Sekundarstufe I) im Fach Geschichte ausgearbeitet.
- Arbeit zitieren
- Simon Haas (Autor:in), 2020, Die mittelalterliche Schreibstube. Das Konzept des Flow Learnings nach Joseph Cornwell (7. Klasse Geschichte), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1119231