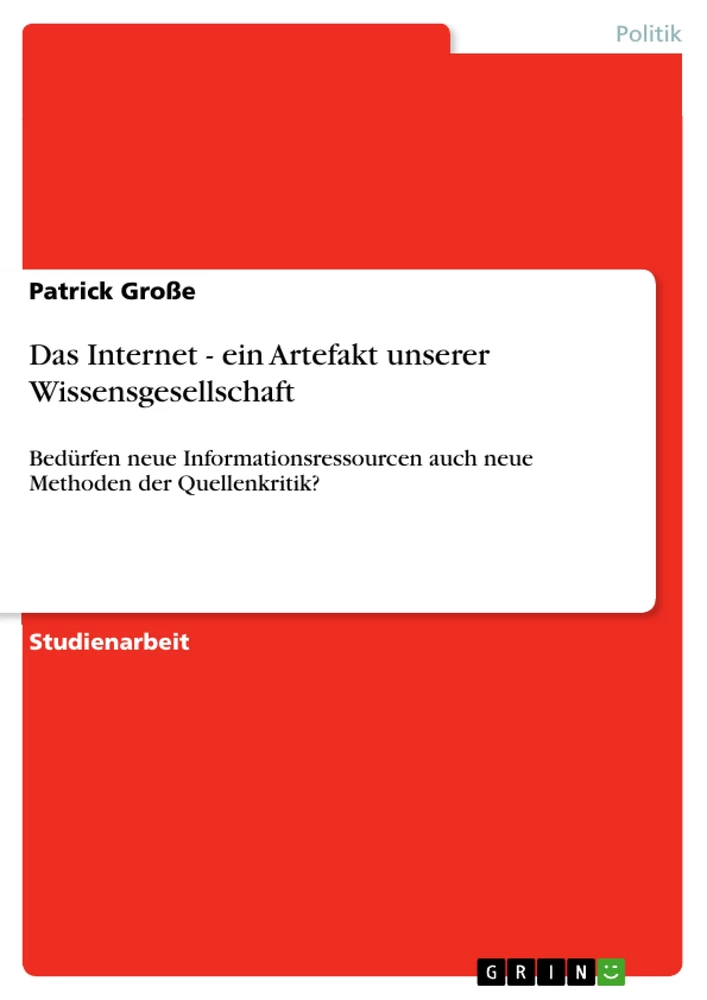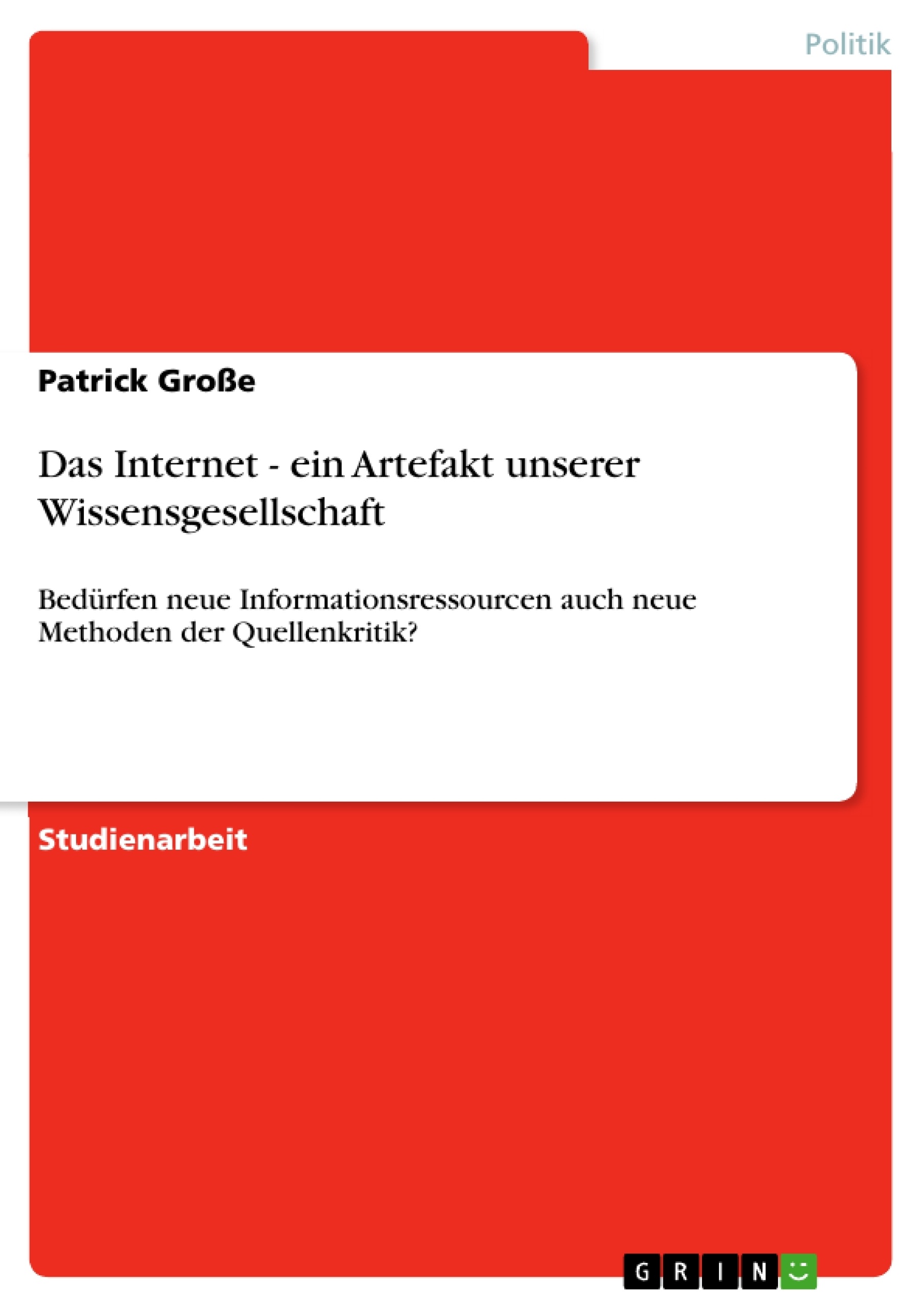Das Internet als wissenschaftliche Quelle
Jede Frage, wie kurios sie uns auch immer erscheinen mag, verdient eine Antwort. Um Antworten geben zu können, brauchen wir entsprechendes Wissen. Jedes Wissen basiert wiederum auf mindestens einer Quelle. Insbesondere i der Schule ist es von enormer Wichtigkeit, dass Schülerinnen und Schüler Strukturierungen lernen, wo, wer, wann, was und wie zu einem Thema niedergeschrieben hat. [...]
Die Macht ‚Wissen’ zu schaffen, liegt in der Bedeutung von Quellen. Dabei spielt die Autorität, z.B. eines Forschers, eine wesentliche Rolle. Denn Wertungen und Meinungen von Wissenschaftlern genießen einen höheren ‚Echtheits- und Vertrauensstatus’, als Äußerungen von ‚Nichtwissenschaftlern’. Für Schülerinnen und Schüler ist es somit von Belang, nicht nur die Fähigkeit zu erlernen, sich Quellen zu suchen und zu strukturieren, sondern sie auch kritisch zu hinterfragen. Dahinter steht nicht nur der Anspruch, Quellen einordnen zu können, sondern auch ein Verständnis des geistigen Eigentums. Gerade im Zeitalter einer vernetzten Weltgemeinschaft erscheinen viele Quellen unsicher in Bezug auf ihre Herkunft und Echtheit. Es ist notwendig die herkömmlichen Quellenkritikmethoden, die z.B. bei der Literaturkritik zum Einsatz kommen, im Hinblick auf neue Informationsmedien wie das Internet zu überdenken. Die Fähigkeit zur begründeten Kritik an Internetquellen muss diffiziler und vielleicht sogar strenger ausfallen, um so Anerkennung in Wissenschaft, Forschung und nicht zuletzt im Unterricht zu erfahren. [...]
Ich verstehe Kritik im Umgang und in der Anwendung von Quellen, seinen sie nun literarische, gegenständliche, oder elektronisch gespeicherte, als universell. Keine Quelle hat von sich aus den Anspruch, und diese Position werde ich im Verlauf dieser Arbeit immer wieder betonen, unhinterfragt für Wahrheit und damit für Unhinterfragtes, gar unfehlbares Wissen gehalten zu werden.
Das Wissensangebot im Internet wächst mit einer ungeheuren Geschwindigkeit. Ich halte es daher letztlich für wichtig, die Schülerfähigkeiten diesem Zukunftsmedium anzupassen, so dass ein selbständiger Umgang mit Daten und Informationen aus dem Internet ermöglicht werden kann.
Inhaltsverzeichnis
1. Das Internet als wissenschaftliche Quelle
2. Metadaten als Bausteine einer Quellen
3. Quellendefinition, Einordnungen und Bedeutung für die Wissenschaft
4. Quellenkritik – alte Methoden im neuen Zeitalter
5. Quellenqualität im Internet
6. Überprüfungsmöglichkeiten von Internetquellen
7. Fazit - das Internet als Zukunftsmedium
Literaturverzeichnis
1. Das Internet als wissenschaftliche Quelle
„ Man muss viel gelernt haben,
um über das, was man nicht weiß,
fragen zu können. ( St. Preux ) “[1]
Jede Frage, wie kurios sie uns auch immer erscheinen mag, verdient eine Antwort. Um Antworten geben zu können, brauchen wir entsprechendes Wissen. Jedes Wissen basiert wiederum auf mindestens einer Quelle. Insbesondere in der Schule ist es von enormer Wichtigkeit, dass Schülerinnen und Schüler Strukturierungen lernen, wo, wer, wann, was und wie zu einem Thema niedergeschrieben hat. Die Wissensquellen sind dabei oft so vielfältig wie unübersichtlich, so dass es den Lernenden schwer fällt, selbständig und ohne Übung, thematisch bezogene Informationen zu finden. Wenn dann Daten und Informationen gefunden sind, stellt sich nicht zuletzt die Frage nach ihrer Echtheit und Zuverlässigkeit.
Die Macht ‚Wissen’ zu schaffen, liegt in der Bedeutung von Quellen. Dabei spielt die Autorität, z.B. eines Forschers, eine wesentliche Rolle. Denn Wertungen und Meinungen von Wissenschaftlern genießen einen höheren ‚Echtheits- und Vertrauensstatus’, als Äußerungen von ‚Nichtwissenschaftlern’. Für Schülerinnen und Schüler ist es somit von Belang, nicht nur die Fähigkeit zu erlernen, sich Quellen zu suchen und zu strukturieren, sondern sie auch kritisch zu hinterfragen. Dahinter steht nicht nur der Anspruch, Quellen einordnen zu können, sondern auch ein Verständnis des geistigen Eigentums. Gerade im Zeitalter einer vernetzten Weltgemeinschaft erscheinen viele Quellen unsicher in Bezug auf ihre Herkunft und Echtheit. Es ist notwendig die herkömmlichen Quellenkritikmethoden, die z.B. bei der Literaturkritik zum Einsatz kommen, im Hinblick auf neue Informationsmedien wie das Internet zu überdenken. Die Fähigkeit zur begründeten Kritik an Internetquellen muss diffiziler und vielleicht sogar strenger ausfallen, um so Anerkennung in Wissenschaft, Forschung und nicht zuletzt im Unterricht zu erfahren.
In dieser Arbeit möchte ich mich zunächst mit der Frage nach ‚Metadaten’ befassen. Denn diese ‚Daten über Daten’ sind Voraussetzungen zur formalen Kritik der Quellenqualität im Internet. Internetquellen verlangen aber auch Grundmuster der Kritik, um eine einheitliche Erfassung und Bewertung dieser vornehmen zu können. Hierzu möchte ich folgend klären, was unter einer Quelle verstanden wird und wie eine generelle Quellenkritik aussehen kann. Insbesondere in der Schule müssen solche Maßstäbe erörtert und angewandt werden, um Schülerinnen und Schülern einen sicheren Umgang mit Internetquellen zu ermöglichen. Ich verstehe Kritik im Umgang und in der Anwendung von Quellen, seinen sie nun literarische, gegenständliche, oder elektronisch gespeicherte, als universell. Keine Quelle hat von sich aus den Anspruch, und diese Position werde ich im Verlauf dieser Arbeit immer wieder betonen, unhinterfragt für Wahrheit und damit für unhinterfragtes, gar unfehlbares Wissen gehalten zu werden.
Das Wissensangebot im Internet wächst mit einer ungeheuren Geschwindigkeit. Ich halte es daher letztlich für wichtig, die Schülerfähigkeiten diesem Zukunftsmedium anzupassen, so dass ein selbständiger Umgang mit Daten und Informationen aus dem Internet ermöglicht werden kann.
2. Metadaten als Bausteine einer Quellen
Um zu erfahren wie bestimmte Daten und Informationen zu Stande kommen gilt die Frage nach den Daten über Daten[2] als erster Zugangspunkt. Lernende sollen dazu angehalten werden, sich mit der Struktur und Organisation von Quellen auseinander zu setzten[3]. Metadaten stellen in erster Linie eine
„ […] Beschreibung von Dokumenten, Objekten oder (bestimmten) Diensten […] “[4]
dar und enthalten Daten, die zu Informationen ausgearbeitet werden können. So werden Inhalt, Struktur und Form einer z.B. elektronischen Datei oder eines Buches so aufgeschlüsselt, dass ein Überblick entsteht, der die Einordnung und folgende Anwendung stark vereinfacht. Wenn recherchiert wird, ist das Themengebiet oder zumindest eine Fragestellung bekannt, die sehr schnell eine erste Selektionsphase der Quellen einleitet[5].
Zunächst steht der mediale Überlieferungsrahmen mit dem Titel des jeweiligen Werks im Vordergrund, der diese Wissensressource eindeutig identifiziert. Die kreierenden Person(en), die für den Inhalt verantwortlich zeichnen sind auch diejenigen, die dem Werk seinen Namen geben und ebenfalls aufgeführt sind. Außerdem sollte darauf geachtet werden, ob nicht noch weitere Autorenkollektive oder externe Organisationen den Anspruch des geistigen Eigentums einer Arbeit antreten[6]. Nachdem dieser erster Schritt vollzogen wurde, wissen die Lernenden, mit wem sie es zu tun haben und mit welchem Thema sich das auserwählte Werk beschäftigt. Diese Erkenntnis ist sehr wichtig, wenn es um die Relevanz eines Werkes geht. Denn so kann z.B. ein Buch über die ‚biologische Vielfalt im Wattenmeer’ beruhigt zu Seite gepackt werden, wenn sich das zu bearbeitende Thema mit der ‚Entwicklung von Demokratie und Plebisziten in Europa’ beschäftigt.
Der zweite Schritt, sich auch über den konkreten Inhalt eines Buches oder eines elektronisch gespeicherten Dokuments im Klaren zu werden, kann als inhaltlicher Überlieferungsrahmen bezeichnet werden und z.B. durch sogenanntes Querlesen in den einzelnen Kapiteln erfolgen. Hier ist es oftmals sehr hilfreich, einzelne Absätze zusammenzufassen, um sich so einen inhaltlichen Überblick zu verschaffen.
Selbstverständlich sind auch das Erscheinungsjahr und die Sprache des Dokuments wichtige Bausteine einer Quelle[7]. So kann man z.B. vom Erscheinungsjahr auf die historischen und gesellschaftlichen Umstände schließen, in der ein Autor z.B. ein Buch geschrieben hat und somit weitere Ansatzpunkte für Interpretationen finden. Die Identifizierung des Autors bzw. des Herausgebers eines Werkes, ob nun in einer elektronischen Datei im Internet oder als literarischer Aufsatz bzw. Buch, erfordert die Möglichkeit der Kontaktaufnahme[8]. Insbesondere im Internet verbreitete Dateien können so ihre Echtheit bzw. Zuverlässigkeit steigern, wenn der Autor z.B. via E-Mail oder Telefon erreichbar ist und auf Fragen oder Kritik reagieren kann.
Ich sehe an dieser Stelle einen ersten großen Unterschied zwischen dem alten und traditionellen Buch und den neuen Internetdiensten. Die meisten im Internet abrufbaren Dateien sollten, wenn sie als echt und zuverlässig gelten wollen, mit einer Kontaktadresse versehen sein, während der Autor eines Buches vielleicht schon mehrere Jahre nicht mehr unter den Lebenden weilt. Fehlt eine Kontaktadresse, so verliert zwar die Internetquelle rapide an Glaubwürdigkeit, nicht jedoch das Buch. Dem Buch wird ein grundsätzlich höherer Echtheitsanspruch zu Teil, als der Internetdatei, zumeist unabhängig davon, ob der Kontakt mit dem Autor besteht. Dieses Problem tritt in der Anwendung von Internetquellen in z.B. wissenschaftlichen Arbeiten sehr häufig auf. Es gibt keine eindeutige, geschweige denn einheitliche Richtlinie, die dem Wissenschaftler vorschreibt wie genau und wie sicher die angeführte Internetquelle aufbereitet sein muss. Wie ist es da möglich, Schülerinnen und Schülern das Werkzeug in die Hand zu geben, mit dem sie sich über die Quelle an sich bewusst werden können? Wie kann die Wissensautorität des Buches gegenüber den Lernenden begründet werden?
Nachdem ich nun die Quellenarbeit selbst in Kürze umrissen habe, möchte ich im Folgenden auf die Definitionen von Quellen eingehen, um mit diesem substanziellen Begriff weiterarbeiten zu können.
3. Quellendefinition, Einordnungen und Bedeutung für die Wissenschaft
Zunächst möchte ich die Einteilung der Quellendefinition nach Volker Sellin[9] vornehmen. Hier wird der Begriff der Quelle einerseits als Überrest und andererseits als Tradition wahrgenommen. Der Überrest ist alles,
„ […] was unmittelbar aus den historischen Begebenheiten hervorgegangen (ist) […] “[10]
und bis in unsere Zeit erhalten werden konnte. Das bloße Dasein eines Überrestes zeugt vom Lebenszusammenhang, in dem z.B. ein Objekt wie ein privater Brief entstanden ist. Diese Überreste sind dementsprechend unwillkürliche Quellen, deren Funktion nicht in der beabsichtigten Überlieferung liegt, sondern in der zufälligen Erhaltung für folgende Generationen[11].
Die Traditionsquellen hingegen beschreiben das,
„ […] was von den (historischen) Begebenheiten übrig geblieben ist […] “[12]
und bis zur heutigen Zeit durch menschliche Auffassungen wiedergegeben wurde. So würden beispielsweise Autobiographien oder Grabinschriften als solch willkürliche Quellen gelten, die verfasst wurden, um für die Nachwelt Zeugnis über die Vergangenheit abzulegen[13].
Nach der eindeutigeren Definition von Paul Kim sind
„ […] alle Texte, Gegenstände oder Tatsachen, aus denen Kenntnis der Vergangenheit gewonnen werden (können) […] “[14]
Quellen. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei der Definitionsfindung des Begriffs der Quelle zumeist um historische Quellen handelt, die dementsprechend in der Sozialwissenschaft Verwendung finden. Dass Schülerinnen und Schüler sowohl im Geschichtsunterricht, wie auch im Sozialkundeunterricht über die Handhabung mit Quellen und ihrer Kritik aufgeklärt werden sollten, gehört zur Ausbildung von Medienkompetenz in unserer Informationsgesellschaft[15]. So wäre eine differenzierende Unterscheidung zwischen den Quellen der Geschichtswissenschaft und denen der Politikwissenschaft nicht von großer Bedeutung, da in beiden Fachrichtungen von einem grundsätzlichen Quellenbegriff ausgegangen wird. Dieser grundsätzliche Quellenbegriff beinhaltet gewiss die Bearbeitung der Vergangenheit, aber beschreibt auch den Wert des geistigen Eigentums eines schriftlichen oder anderweitig zugänglichen Ideenwerkes (ggf. auch aus der Gegenwart)[16].
Quellen sind also Informations- und Datenträger, die wir in den verschiedensten Forschungsbereichen heranziehen und so Sachverhalte und Ideenkonstrukte nachweisen bzw. belegen können[17]. Die Weiterentwicklung des menschlichen Wissens hängt maßgeblich davon ab, dass bereits vorhandenes Wissen genutzt, verbessert und ergänzt wird. So ist es, metaphorisch ausgedrückt, nicht notwendig, das Rad bei eigenen Ideenentwicklungen jedes Mal neu zu erfinden. Die Quellennutzung verschafft dem Rezipienten aber auch die Gelegenheit der Fehleinschätzung hinsichtlich ihrer Bedeutung. Bei allen Quellen ist darauf zu achten, dass diese keinen unmittelbaren Einblicke in das Geschehen an sich bieten, sondern lediglich die mögliche materielle Repräsentation des Geschehenen darstellen[18]. So dienen Quellen in erster Linie als Medien (Belege), nicht jedoch als Beweise, wie sich z.B. ein historischer Sachverhalt zugetragen haben könnte. Diese Medien bzw. Belege haben den Anspruch, Wissen und damit eng verbunden auch Deutungen von Zusammenhängen in unserer Welt zu vermitteln. Hierzu ist die subjektive Meinung des Autors, die auf Erfahrungen und selbstgestellten Lebensprämissen beruht, ausschlaggebend,
so dass eine Quelle nie eine exakte Kopie der Realität bzw. eines Realitätsausschnitts ist, sondern immer nur Ausdruck einer persönlichen Perspektive sein kann[19]. Werden Lernende in der Schule dazu veranlasst sich mit einer bestimmten Thematik auseinander zu setzten und dazu Quellen zu recherchieren, können nie alle Quellen berücksichtigt werden. Es findet eine Vorfilterung statt, die die bestehende Anzahl der Quellen reduziert und somit handhabbar macht[20].
Auch das Material oder die Art der Quellendarlegung und Speicherung ist von großer Relevanz für die Arbeit mit Quellen. So könnten z.B. schriftliche Quellen wie Bücher durch den Zahn der Zeit negativ beeinflusst worden sein. Einzelne Schriftstücke können verwischt, oder das Papier könnte gar zerfallen sein[21]. Hier möchte ich anmerken, dass die publizierten und gespeicherten Werke im Internet nicht dieser zeitlichen Korrosion unterliegen, obgleich auch hier Veränderungen und Ergänzungen stattfinden. Quellen vertreten den Anspruch der Objektivität über eine Sachverhalt und versuchen diesen zu Vergegenständlichen[22]. Das Wissen einer Gesellschaft wird so in den unterschiedlichsten Formen von Quellen dargelegt, zugänglich gemacht und immer wieder von Neuem bewertet. Dass keine Quelle Objektivität für sich allein beanspruchen kann wird spätestens bei der kritischen Analyse deutlich[23]. So sind Quellen aus der Vergangenheit nicht frei von Wertungen und Interpretationen ihrer Verfasser und Urheber[24], was immer auch eine zusätzliche Herausforderung, im Sinne des Verstehens der Intentionen des Autors, für den Rezipienten darstellt.
Die Fragestellung bzw. These mit deren Hilfe eine Quelle erst ihren Wert für das wissenschaftliche Arbeiten erhält leitet die quellenkritische Analyse ein und gibt erste Hinweise auf mögliche Quellenarten bzw. Kategorien[25].
Nach Gregor Weber (et. al.) von der Universität Augsburg[26], möchte ich eine Theorie zum systematischen Überblick von Quellenkategorisierungen tabellarisch angeben.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In dieser Tabelle sind z.B. Bilder absichtlich nicht mit aufgeführt, da sie eine eigene Quellengattung darstellen und nicht eindeutig der schriftlichen oder schriftlosen Quellen zuzuordnen sind[27]. Gelten z.B. Hieroglyphen als Keilschrift, können diese als schriftliche Quellen (Dokumente) bezeichnet werden. Andererseits sind Hieroglyphen aber auch Bilder, die eine Art Vorform der schriftlichen Übermittlung von Informationen in Symbolen darstellen und somit als schriftlose Quellen klassifiziert werden können. Diese Übersicht dient als ein Wegweiser zum Verständnis von Quellen und zur darauf aufbauenden Quellenkritik und Quelleninterpretation.
In der Schule kann eine solche Theorie der Kategorisierung hilfreich sein, über Quellen bzw. deren Strukturen, Einordnungsmöglichkeiten aufzufinden, die das Verständnis für eine Quelle hinsichtlich der Bedeutung in ihrer Zeit aufdecken.
So werden aus der Antike mehrheitlich Gegenstände, wie Münzen oder Gefäßstücke als Quelle identifiziert[28]. Im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert hingegen überwiegt die Bedeutung der schriftlichen Dokumente wie z.B. Bücher oder Aufsätze. Das Ende des zwanzigsten und der Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts, möchte ich als erneutes Umbruchzeitalter verstanden wissen. Denn hier setzt die Technologie der digitalen und elektronischen Datenerfassung und Datenspeicherung neue und bislang noch nicht abzuschätzende Maßstäbe hinsichtlich der Bedeutung dieses Mediums[29]. Da das Internet alle erdenklichen Daten, seien sie nun Beschreibungen und Bilder von archäologischen Funden oder literarische Schriftstücke und Dokumente zur Verfügung stellt, kommt diesem, meiner Meinung nach, der Status eines Metamediums zu. Für alle Wissenschaftsbereiche lassen sich Berichte, Dokumente und ähnliches Material im Internet recherchieren. Bei dieser Materialfülle ist es unabdingbar, diese zu bewerten und einzuschätzen. Besonders das Echtheitsprinzip[30] sollte hier Anwendung für eine Herkunftskontrolle finden. Jede Quelle muss, je nach Fragestellung, neu gelesen bzw. interpretiert werden. So können Kritikvarianten Aufschluss z.B. über Autorenintentionen geben, die ohne sie nur schwer zu erkennen und einzuschätzen sind. Das Prinzip der Kritik an einer Quelle hat den Anspruch alle verwendeten Quellen nach dem gleichen Muster zu befragen, um so eine Vergleichbarkeit z.B. hinsichtlich der Ideologie des Autors oder dessen verwendeten Ausdrucksformen in den Dokumenten zu erringen[31].
[...]
[1] Rousseau: Neue Heloise V, 3, in: Puntsch, Eberhard: Zitatenhandbuch, München 2003, S. 325.
[2] Vgl. Eschenbach, Robert/ Eich, Ulrike (Hg.): Was sind Metadaten?, in: http://www.bth.rwthaachen.de, abgerufen am 30.08.2006.
[3] Vgl. Frech, Siegfried: Das Internet – Recherchieren und Informieren, in: Methodentraining für den Politikunterricht, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2004, S. 69f..
[4] Eschenbach, Robert/ Eich, Ulrike (Hg.): Was sind Metadaten?, in: http://www.bth.rwthaachen.de, abgerufen am 30.08.2006.
[5] Vgl. Ovaert, Vincent: Die wissenschaftliche Arbeit mit historischen Quellen, in: Wissenschaftliche Arbeit im Fach der Afrikawissenschaften, in: http://amor.cms.hu-berlin.de, abgerufen am 30.08.2006.
[6] Vgl. Eschenbach, Robert/ Eich, Ulrike (Hg.): Was sind Metadaten?, in: http://www.bth.rwthaachen.de, abgerufen am 30.08.2006.
[7] Vgl. Eschenbach, Robert/ Eich, Ulrike (Hg.): Was sind Metadaten?, in: http://www.bth.rwthaachen.de, abgerufen am 30.08.2006.
[8] Vgl. Sachse, Martin: Quellenkritik im Internet - Selbstkontrolle und Filtersysteme, 2000 in: http://www.materialstelle.de, abgerufen am 22.08.2006.
[9] Vgl. Sellin, Volker: Einführung in die Geschichtswissenschaft, Göttingen 1995, S. 48f., in: Gassert, Philipp: Hinweise zur Quelleninterpretation im Proseminar, in: http:// www.schurman.uni-hd.de, abgerufen am 30.08.2006.
[10] Ebenda, S. 48f, in: http://www.schurman.uni-hd.de , abgerufen am 30.08.2006.
[11] Vgl. Crivellari, Fabio: Quellen entspringen dem Frageinteresse des Historikers, in:
http://www.uni-konstanz.de , abgerufen am 30.08.2006.
[12] Sellin, Volker: Einführung in die Geschichtswissenschaft [...], S. 48f., in: Gassert, Philipp: Hinweise zur Quelleninterpretation im Proseminar, in: http://www.schurman.uni-hd.de , abgerufen am 30.08.2006.
[13] Vgl. Crivellari, Fabio: Quellen entspringen dem Frageinteresse des Historikers, in:
http://www.uni-konstanz.de, abgerufen am 30.08.2006.
[14] Kim, Paul: Einführung in die Geschichtswissenschaft, 5. Auflage, Berlin 1968, S. 29, in: Gassert, Philipp: Hinweise zur Quelleninterpretation im Proseminar, in: http://www.schurman.uni-hd.de, abgerufen am 30.08.2006.
[15] Vgl. Massing, Peter: Bürgerleitbilder und Medienkompetenz, in: Kiefer, Franz/ Weißeno, Georg: Politikunterricht im Informationszeitalter, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2001, S. 39ff..
[16] Ovaert, Vincent: Tipps und Hinweise zur Zitierweise und Quellenkritik von Web-Dokumenten in wissenschaftlichen Arbeiten, in: Wissenschaftliche Arbeit im Fach der Afrikawissenschaften, in: http://amor.cms.hu-berlin.de, abgerufen am 22.08.2006.
[17] Vgl.: ebenda, abgerufen am 22.08.2006.
[18] Vgl.: ebenda, abgerufen am 22.08.2006.
[19] Vgl. Ovaert, Vincent: Tipps und Hinweise zur Zitierweise und Quellenkritik [...],in: http://amor.cms.hu-berlin.de, abgerufen am 22.08.2006.
[20] Vgl. Breit, Gotthard/ Lesske, Frank: Politikunterricht mit Zeitungstexten aus dem Internet – ein Experiment, in: Kiefer, Franz/ Weißeno, Georg: Politikunterricht im Informationszeitalter, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2001, S. 150ff..
[21] Vgl. Ovaert, Vincent: Tipps und Hinweise zur Zitierweise und Quellenkritik [...], in: http://amor.cms.hu-berlin.de, abgerufen am 22.08.2006.
[22] Vgl. ebenda, abgerufen am 22.08.2006.
[23] Vgl. ebenda, abgerufen am 22.08.2006.
[24] Vgl. ebenda, abgerufen am 22.08.2006.
[25] Vgl. Crivellari, Fabio: Quellen entspringen dem Frageinteresse des Historikers, in:
http://www.uni-konstanz.de, abgerufen am 30.08.2006.
[26] Vgl. Weber, Gregor: Kategorien von Quellen, in: http://www.gnomon.ku-eichstaett.de, abgerufen am 30.08.2006.
[27] Vgl. Giesecke, Michael: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien, Frankfurt/ Main 1991; und: ebenda: Von den Mythen der Buchkultur zu den Visionen der Informationsgesellschaft, Frankfurt am Main 2001, in: http://www.schurman.uni-hd.de, abgerufen am 30.08.2006.
[28] Vgl. Ovaert, Vincent: Tipps und Hinweise zur Zitierweise und Quellenkritik [...] , in: http://amor.cms.hu-berlin.de, abgerufen am 22.08.2006.
[29] Vgl. Harth, Thilo: Das Internet als Herausforderung politischer Bildung, Schwalbach/Ts. 2000, S. 63f..
[30] Vgl. Hedwig, A.: Authentizität- zentrales Kriterium des Quellenwertes von Archivgut?, in: http://www.vda.archiv.net, abgerufen am 30.08.2006.
[31] Vgl. Crivellari, Fabio: Quellen entspringen dem Frageinteresse des Historikers, in:
http://www.uni-konstanz.de, abgerufen am 30.08.2006.
- Quote paper
- Patrick Große (Author), 2006, Das Internet - ein Artefakt unserer Wissensgesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111949