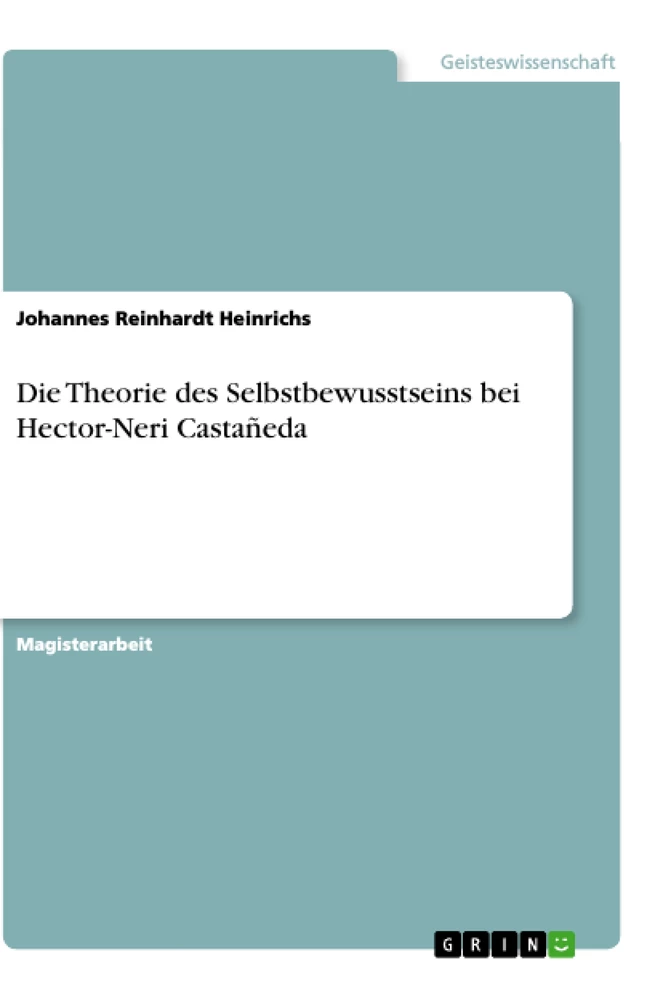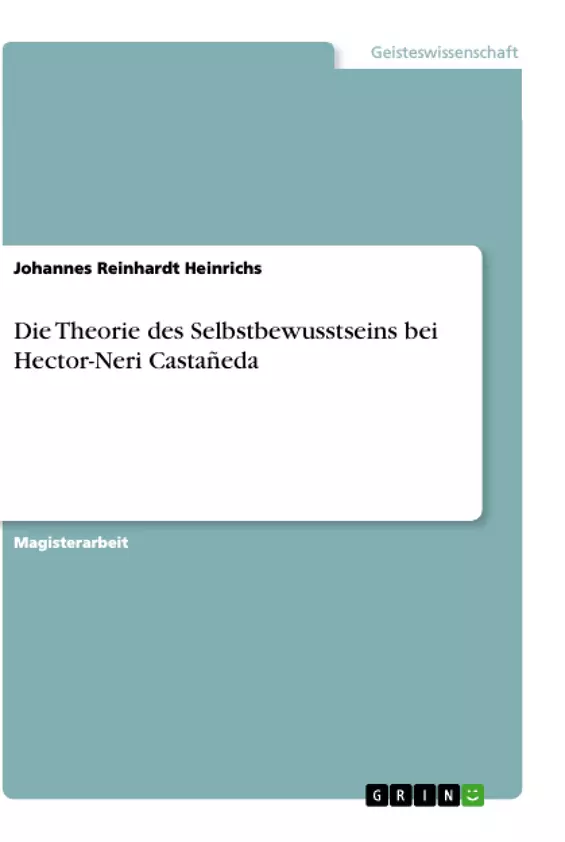Diese Arbeit präsentiert eine Biographie des Philosophen Hector-Neri Castañeda und beschäftigt sich mit den allgemeinen Grundlagen, die Castañedas Denken, seine methodologische Vorgehensweise und seine Ziele verdeutlichen sollen. Des weiteren wird die enorme Tragweite der Strukturen, die Sprache, Denken und Realität gemeinsam sind, innerhalb seiner Erkenntnistheorie dargestellt. Dann befasst sich diese Arbeit mit der erwähnten Theorie der Gestaltungen, innerhalb derer ein kurzer Einblick vermittelt werden soll, wie Castañeda sich den Aufbau der Welt und ihrer Objekte vorstellt. Im Anschluß daran wird der ontologische Aufbau des Ichs und dessen Stellung innerhalb der Welt der Erfahrungen mein Thema sein. Ferner werden in diesem Abschnitt die Erweiterung des Kantschen "Ich denke" durch ein "Hier und Jetzt "und das "cogito" Descartes dargestellt, wie dieses durch Castañeda von einer Position außerhalb der Welt der Erfahrungen wieder in diese Welt geholt wird, womit er den ontologischen Dualismus Descartes in einen Monismus ableitet.
Der nächste Teil, über die Bezugnahmen des Ich, betrachtet die sprachanalytische Komponente des Selbstbewusstseins, und wie selbiges innerhalb der Indikatoren und Quasi-Indikatoren, die in den 60ern für Furore sorgten, auf sprachlicher Ebene zum Ausdruck kommt. Ferner beschäftigt sich dieser Teil mit der Theorie der Attribut-Selbstzuschreibung, wie diese zu einem durch Ich-Stränge erweiterten Aufbau des Ichs beiträgt und zu einer Hierarchie des Bewusstseins geführt hat, auf der er ein anti-Fichtesches Argument stützt, daß nicht alles Bewusstsein Selbstbewusstsein einschließt. Ein weiteres Argument, das er gegen Fichte in die Diskussion bringt, beruht auf der strikten Trennung von Selbstbewusstsein und Selbstbezug, anhand deren er das erfahrend-sich-erfahrende Selbst Fichtes analysiert und ihm eine Vermischung beider Ebenen vorwirft. Im letzten Teil der Arbeit ist die Stellung von Castañeda innerhalb der Diskussion um die propositionale Wissbarkeit von Selbstbewusstsein kurz dargestellt, die er ebenfalls benötigt, um sein anti-Fichtesches Argument zu unterstützen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Biographie
- Allgemeine Grundlagen
- Die Theorie der Gestaltungen
- Der ontologische Aufbau des Ich
- Ich denke hier und jetzt
- Ich, Hier, Jetzt
- Das Ich und die Welt
- Das Selbst
- Das Subjekt und die multiplen Selbste
- Der Körper
- Schlussbemerkung
- Die Bezugnahmen des Ich
- Noch einmal individuelle Gestaltungen
- Propositionen
- Bewusstsein
- Indikatoren - cogito ergo sum
- Quasi-Indikatoren - cogito ergo est
- Die Hierarchie des Bewusstseins
- Selbstbewusstsein und Selbstbezug
- Castañedas Stellung innerhalb der Diskussion um Selbstzuschreibungen
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Theorie des Selbstbewusstseins bei Hector-Neri Castañeda. Sie strebt eine umfassende Darstellung seines Denkens an, inklusive seiner Biographie, methodologischen Vorgehensweise und den wichtigsten Themen seiner Philosophie. Der Fokus liegt dabei auf Castañedas Konzeption des Selbstbewusstseins und dessen Beziehung zur Welt und Sprache.
- Die Theorie der Gestaltungen als Grundlage für Castañedas Philosophie
- Der ontologische Aufbau des Ichs und dessen Verbindung zu Raum, Zeit und der Welt
- Das Selbstbewusstsein als sprachliches Phänomen: Indikatoren, Quasi-Indikatoren und die Theorie der Attribut-Selbstzuschreibung
- Castañedas Kritik an Fichte und seine Position in der Diskussion um die propositionale Wissbarkeit des Selbstbewusstseins
- Die Verbindung zwischen Castañedas Philosophie des Geistes und dem wissenschaftlichen Realismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Castañeda als Philosoph vor und erläutert die Motivation für die vorliegende Arbeit. Das zweite Kapitel widmet sich seiner Biographie, inklusive der Einflüsse, die seine philosophische Arbeit prägten. Das dritte Kapitel behandelt die allgemeinen Grundlagen seiner Philosophie und die Rolle von Sprache, Denken und Realität in seiner Erkenntnistheorie. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Theorie der Gestaltungen, die den Aufbau der Welt und ihrer Objekte beschreibt.
Kapitel fünf analysiert den ontologischen Aufbau des Ichs. Dabei wird die Erweiterung des Kantschen "Ich denke" durch ein "Hier und Jetzt" erläutert. Weiterhin wird gezeigt, wie Castañeda den ontologischen Dualismus Descartes in einen Monismus ableitet. Das sechste Kapitel beschäftigt sich mit den sprachlichen Dimensionen des Selbstbewusstseins und analysiert die Rolle von Indikatoren und Quasi-Indikatoren in der Entstehung des Selbstbewusstseins. Dieses Kapitel beleuchtet auch die Theorie der Attribut-Selbstzuschreibung und deren Beitrag zur Hierarchie des Bewusstseins.
Das siebte Kapitel behandelt Castañedas Kritik an Fichte und untersucht die Unterscheidung zwischen Selbstbewusstsein und Selbstbezug. Der letzte Teil der Arbeit, der in dieser Zusammenfassung nicht behandelt wird, befasst sich mit Castañedas Position innerhalb der Diskussion um die propositionale Wissbarkeit des Selbstbewusstseins.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit umfassen die Theorie des Selbstbewusstseins, Hector-Neri Castañeda, Gestaltungen, Ontologie, Sprache, Indikatoren, Quasi-Indikatoren, Attribut-Selbstzuschreibung, Selbstbezug, Fichte, propositionale Wissbarkeit, Erkenntnistheorie und Philosophie des Geistes.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Hector-Neri Castañeda?
Ein bedeutender Philosoph, der sich intensiv mit Erkenntnistheorie, Sprache und der Struktur des Selbstbewusstseins auseinandersetzte.
Was ist die „Theorie der Gestaltungen“?
Ein zentraler Teil von Castañedas Philosophie, der beschreibt, wie die Welt und ihre Objekte ontologisch aufgebaut sind.
Wie erweitert Castañeda das Kantsche „Ich denke“?
Er ergänzt es um die Dimensionen „Hier und Jetzt“, um das Ich fester in der Welt der Erfahrungen zu verankern.
Was sind Quasi-Indikatoren?
Sprachliche Werkzeuge, die Castañeda in den 60er Jahren einführte, um das Selbstbewusstsein auf sprachanalytischer Ebene präzise zu untersuchen.
Welche Kritik übt Castañeda an Fichte?
Er wirft Fichte eine Vermischung von Selbstbewusstsein und Selbstbezug vor und argumentiert, dass nicht jedes Bewusstsein zwingend Selbstbewusstsein einschließt.
- Citation du texte
- Johannes Reinhardt Heinrichs (Auteur), 1996, Die Theorie des Selbstbewusstseins bei Hector-Neri Castañeda, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1119513