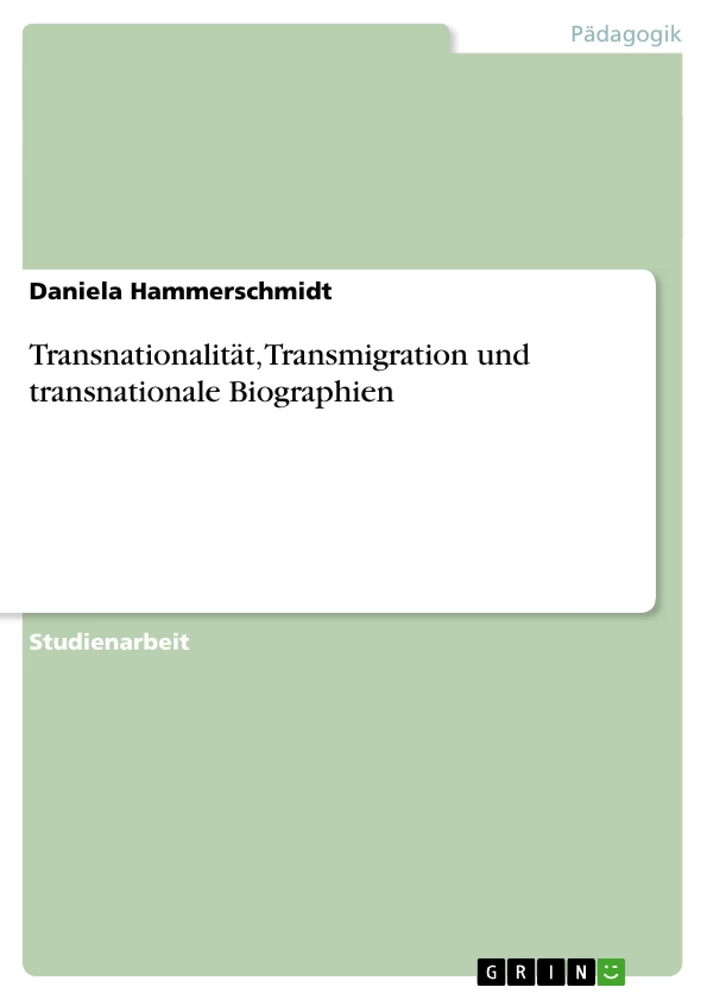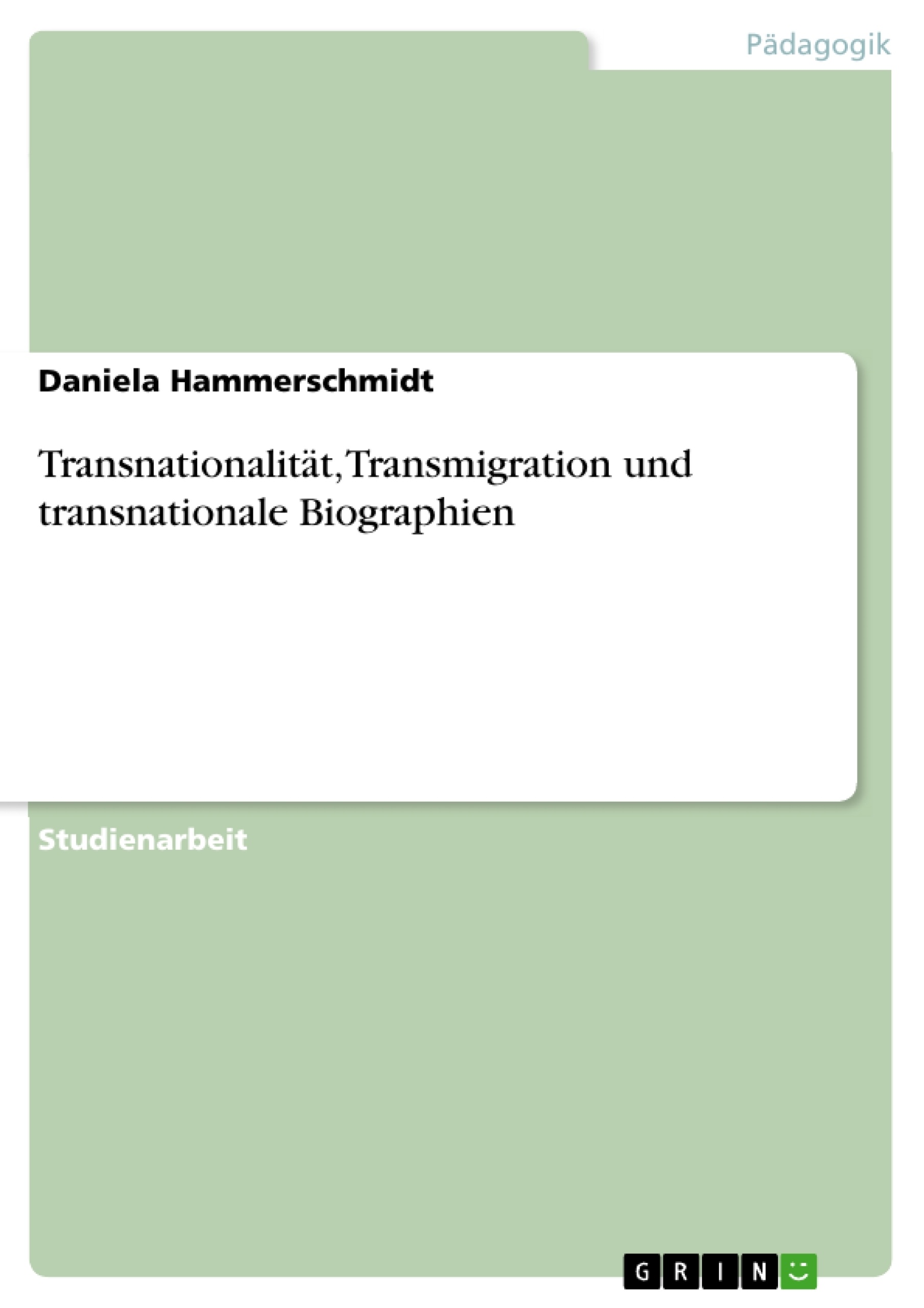Im Rahmen meiner Honorartätigkeit in einem Vorkindergarten las ich einer zweijährigen aus einem Buch vor. Bei jeder neuen Seite fragte sie mich Bezug nehmend auf die abgebildeten Bilder: „Ist das ein Mann oder eine Frau?“. Es schien ihr also wichtig zu sein die Welt innerhalb der Kategorie Geschlecht in eine der zwei möglichen Gruppen zu klassifizieren und zu differenzieren. Die Geschlechtereigenschaft erscheint hier also total inklusiv und exklusiv: jeder hat ein Geschlecht und jeder kann nur einer einzigen Kategorie angehören: entweder man ist männlich oder weiblich. In allen Gesellschaften werden Kinder nach der Geburt durch Ansehen des Körpers der einen oder anderen Geschlechtsklasse zugeordnet, wodurch sie gleichzeitig eine an das Geschlecht gebundene Identifikationskette verliehen bekommen. Die Klassifikation wird hier als erster Schritt zu einem Sortierungsvorgang angesehen, welcher die Angehörigen der Klassen unterschiedlicher Sozialisation unterwirft. An sie werden jeweils andere Erwartungen gestellt und sie machen jeweils andere Erfahrungen. Das System der Geschlechtsklasse beansprucht in der Regel lebenslange Geltung- kann man anhand von optischen Merkmalen nicht zwischen den Geschlechterklassen unterscheiden führt dies in der Regel zur Irritation. Doch auch für die eigene Identitätsbildung ist die Geschlechtsklasse von immenser Bedeutung, denn sowohl die Angehörigen der einen als auch der anderen Klasse beurteilen sich ständig hinsichtlich der Idealvorstellungen des eigenen Geschlechts.
Übertragen auf die Thematik der Migration lies sich auch in der Migrationsforschung lange eine solche Perspektive erkennen: ein Leben zwischen zwei oder mehr Heimaten erschien als kaum denkbar. Das Hauptinteresse der bundesdeutschen Migrationsforschung gilt also traditionell vor allem der Untersuchung der Arbeitsmigranten sowie deren Nachkommen sowohl bezogen auf die Ursachen der Wanderungen als auch auf den Grad der ökonomischen, sozialen und kulturellen Integration : die nachhaltige Eingliederung von Arbeitsmigranten, das als wünschenswert postulierte Ziel der völligen Assimilation in die Aufnahmegesellschaft sowie die mit der Migration scheinbar verbundenen Folgeprobleme standen lange im Fokus der Migrationsforschung.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung zum Thema
- Einleitung
- Von der Arbeitsmigration zur transnationalen Migration
- Transnationalität
- Begriffliche Erklärungen
- Transmigration
- Transnationale Räume
- Transnationale Biographien
- Transnationale europäisch geprägte Elitenbiographie- das Beispiel Herr A.
- Transnationale europäische Unterschichtswanderung- Herr W.
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung von der Arbeitsmigration zur transnationalen Migration und analysiert transnationale Biographien im europäischen Kontext. Sie hinterfragt die traditionellen Sichtweisen auf Migration und beleuchtet das Hin- und Herbewegen zwischen verschiedenen nationalen Kontexten als Ressource und nicht nur als Defizit. Die Arbeit konzentriert sich auf die Konzepte der Transnationalität, Transmigration und transnationaler Räume.
- Entwicklung von der Arbeitsmigration zur transnationalen Migration
- Begriffliche Klärung von Transnationalität, Transmigration und transnationalen Räumen
- Analyse transnationaler Biographien europäischer Migranten
- Untersuchung der Strukturierung biographischer Verläufe, insbesondere Berufsbiographien
- Transnationale Migration als Ressource und nicht nur als Defizit
Zusammenfassung der Kapitel
Hinführung zum Thema: Diese Einführung illustriert anhand eines Beispiels aus dem Alltag die Tendenz zur exklusiven Klassifizierung von Individuen (hier: nach Geschlecht) und überträgt diese Perspektive auf die Migrationsforschung. Traditionell konzentrierte sich die Migrationsforschung auf Arbeitsmigration und Integration, während die Existenz von transnationalen Identitäten und Räumen oft übersehen wurde. Die Arbeit argumentiert für eine neue Perspektive, die das Pendeln zwischen verschiedenen nationalen Kontexten als Ressource anerkennt.
Von der Arbeitsmigration zur transnationalen Migration: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der Arbeitsmigration in Deutschland, beginnend mit den ersten Anwerbungen italienischer Gastarbeiter in den 1950er Jahren bis zum Anwerbestopp 1973. Es beleuchtet die rechtlich privilegierte Stellung von Arbeitskräften aus EU-Ländern im Vergleich zu Nicht-EU-Einwanderern und ihre soziale Lage. Der Übergang von Arbeitsmigration zu transnationaler Migration wird als tiefgreifender Prozess im Kontext der Globalisierung dargestellt. Die Kapitel verdeutlicht, wie sich die traditionellen Ansätze der Migrationsforschung als unzureichend erweisen angesichts der komplexen Realität transnationaler Lebensführung.
Schlüsselwörter
Transnationalität, Transmigration, Transnationale Biographien, Arbeitsmigration, Migrationsforschung, Europa, Globalisierung, Integration, Identitätsbildung, soziale Räume, Berufsbiographien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Entwicklung von der Arbeitsmigration zur transnationalen Migration
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung von der Arbeitsmigration zur transnationalen Migration und analysiert transnationale Biographien im europäischen Kontext. Sie hinterfragt traditionelle Sichtweisen auf Migration und betrachtet das Pendeln zwischen verschiedenen nationalen Kontexten als Ressource, nicht nur als Defizit. Schwerpunkte sind die Konzepte der Transnationalität, Transmigration und transnationaler Räume.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung von der Arbeitsmigration zur transnationalen Migration, die begriffliche Klärung von Transnationalität, Transmigration und transnationalen Räumen, die Analyse transnationaler Biographien europäischer Migranten, die Untersuchung der Strukturierung biographischer Verläufe (insbesondere Berufsbiographien) und die Betrachtung transnationaler Migration als Ressource.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Hinführung zum Thema (inkl. Einleitung und einem Vergleich traditioneller und neuer Perspektiven auf Migration), ein Kapitel über die Entwicklung von der Arbeitsmigration zur transnationalen Migration (mit Fokus auf Deutschland und den rechtlichen Unterschied zwischen EU und Nicht-EU-Einwanderern), ein Kapitel zu Transnationalität (inkl. Begriffserklärungen, Transmigration und transnationalen Räumen) und ein Kapitel zu transnationalen Biographien (mit Beispielen von europäischen Migranten unterschiedlicher sozialer Schichten), sowie eine Schlussbemerkung.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Transnationalität, Transmigration, transnationale Biographien, Arbeitsmigration, Migrationsforschung, Europa, Globalisierung, Integration, Identitätsbildung, soziale Räume und Berufsbiographien.
Wie wird die traditionelle Migrationsforschung kritisiert?
Die Arbeit kritisiert die traditionelle Migrationsforschung dafür, sich zu stark auf Arbeitsmigration und Integration zu konzentrieren und die Existenz transnationaler Identitäten und Räume zu übersehen. Sie plädiert für einen Perspektivwechsel, der die Mobilität zwischen verschiedenen nationalen Kontexten als Ressource anerkennt.
Welche Beispiele werden verwendet?
Die Arbeit verwendet Beispiele aus dem Alltag, um die Tendenz zur exklusiven Klassifizierung von Individuen zu illustrieren. Im Kapitel über transnationale Biographien werden die Lebensläufe von Herrn A. (als Beispiel für eine europäisch geprägte Elite-Biographie) und Herrn W. (als Beispiel für europäische Unterschichtswanderung) analysiert.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Methode, indem sie transnationale Biographien analysiert und Konzepte wie Transnationalität und Transmigration begrifflich klärt. Die Analyse basiert auf empirischen Beispielen und literaturwissenschaftlichen Quellen.
- Quote paper
- Daniela Hammerschmidt (Author), 2008, Transnationalität, Transmigration und transnationale Biographien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111976