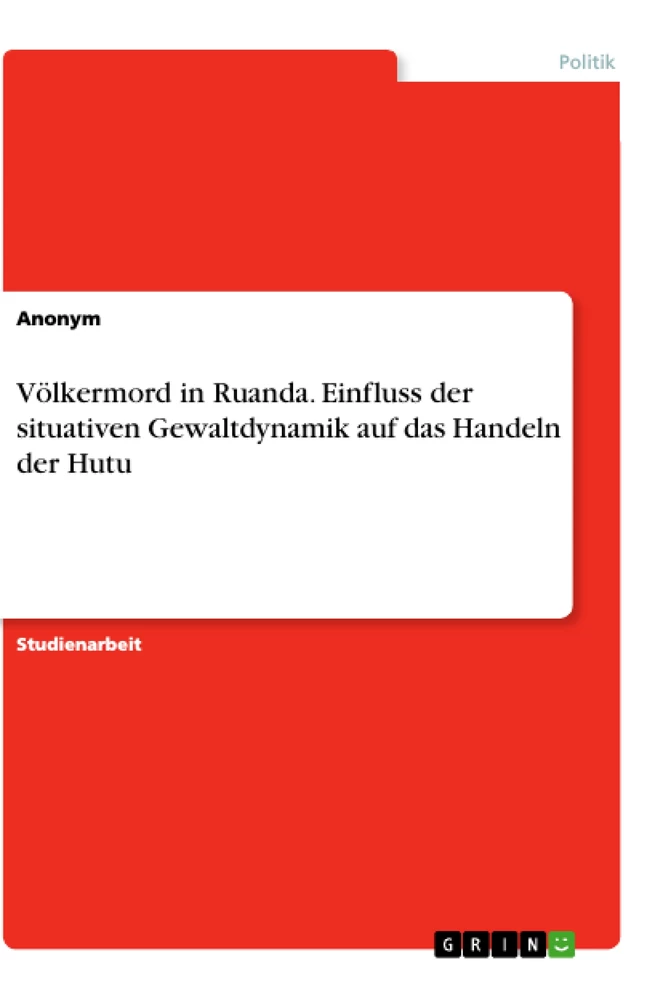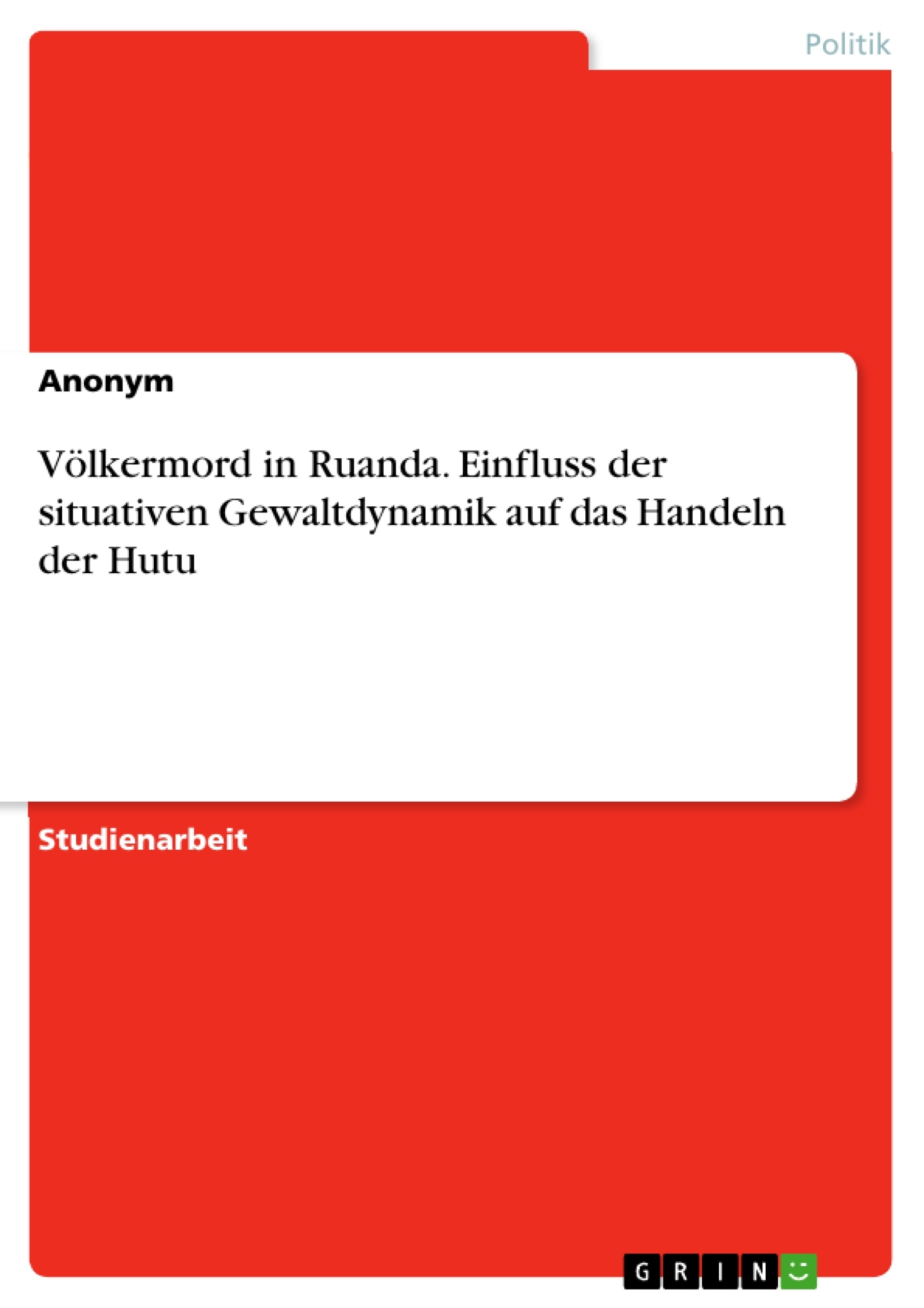Der Abschuss der Flugmaschine im April 1994, in welcher sich der ruandische Präsident Habyarimana befand, setzte den Beginn für einen 100 Tage andauernden Völkermord, in dessen Verlauf etwa 800.000 Tutsi in systematischer Weise von Hutu ermordet wurden. Vor dem Hintergrund der Art und Intensität der Gewalt wird in der Arbeit die Frage aufgeworfen, inwiefern die situative Dynamik jener Gewalt als Erklärungsfaktor für das exzessive Handeln der Hutu betrachtet werden kann.
Zunächst wird im Folgenden die „Theorie der Konfrontationsspannung“ nach Collins als Grundlage der Untersuchung jener situativen Gewaltdynamik dargestellt, nach welcher die Gewalt einen mikrosoziologischen Moment der Anspannung und physiologischen Erregung passieren muss, damit Akteure in den Tunnel der Gewalt eintreten können. Methodisch ergänzt wird der theoretische Rahmen durch die qualitative Inhaltsanalyse, die in ihren Grundzügen dargestellt und nach einer Skizzierung des Völkermordes, welcher von den Vereinten Nationen definiert wird, über „Handlungen, die in der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören“ (Art. II der UN-Völkermordkonvention), an von Hatzfeld durchgeführten Interviews der Täter und Opfer Anwendung finden wird. Die dabei deduktiv abgeleiteten und an den Textkorpus angelegten Kategorien Besessenheit, Autopilot und Gruppenzwang sollen im Ergebnis die Grundlage zur Beurteilung bilden, inwiefern die situative Dynamik der Gewalt als Erklärungsfaktor für die Gräueltaten des Völkermordes betrachtet werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Verortung und Methodik
- "Theorie der Konfrontationsspannung" nach Collins.
- Qualitative Inhaltsanalyse
- Empirie: Völkermord in Ruanda
- Mikrosoziologische Analyse: Situative Gewaltdynamik im ruandischen Völkermord ...
- Textkorpus und Analyseeinheiten.
- Kategoriensystem und Kodierleitfaden.
- Ergebnisse.
- Einfluss der situativen Gewaltdynamik auf das Handeln der Hutu..
- Fazit....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die situative Gewaltdynamik im ruandischen Völkermord von 1994 und untersucht, inwiefern diese als Erklärungsfaktor für das exzessive Handeln der Hutu betrachtet werden kann. Dabei wird die "Theorie der Konfrontationsspannung" von Collins als theoretischer Rahmen genutzt und die qualitative Inhaltsanalyse als methodisches Werkzeug eingesetzt.
- Die Bedeutung der situativen Gewaltdynamik für das Verständnis des Völkermordes
- Die Rolle von Angst, Stress und physiologischer Erregung im Prozess der Gewalt
- Die Anwendung der "Theorie der Konfrontationsspannung" auf den ruandischen Kontext
- Die Analyse von Interviews mit Tätern und Opfern des Völkermordes
- Die Untersuchung der Kategorien "Besessenheit", "Autopilot" und "Gruppenzwang" im Zusammenhang mit der situativen Gewaltdynamik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den historischen Hintergrund des ruandischen Völkermordes dar und führt den Forschungsgegenstand der Arbeit ein. Dabei werden die Besonderheiten der Gewalt, die hohe Opferzahl und die Rolle der "massenhaften Beteiligung der Bevölkerung" hervorgehoben.
- Theoretische Verortung und Methodik: Dieses Kapitel erläutert die "Theorie der Konfrontationsspannung" von Collins, welche die Entstehung von Gewalt aus mikrosoziologischer Perspektive betrachtet. Es werden die Mechanismen der "Konfrontationsspannung" und der "Tunnel der Gewalt" sowie die Rolle von Angst, Stress und physiologischer Erregung im Prozess der Gewalt erläutert. Zudem wird die qualitative Inhaltsanalyse als methodisches Instrument vorgestellt und ihre Anwendung in der Untersuchung des Völkermordes in Ruanda erläutert.
- Empirie: Völkermord in Ruanda: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Geschichte Ruandas, insbesondere über die Kolonialzeit und die Rolle der deutschen und belgischen Kolonialmächte in der Etablierung rassenideologischer Überzeugungen. Es werden die ethnischen Konflikte zwischen Hutu und Tutsi sowie die "Hutu-Revolution" von 1959 und ihre Auswirkungen auf das Land beschrieben.
- Mikrosoziologische Analyse: Situative Gewaltdynamik im ruandischen Völkermord: Dieses Kapitel beschreibt die konkrete Vorgehensweise der mikrosoziologischen Analyse. Es werden der Textkorpus, die Analyseeinheiten, das Kategoriensystem und der Kodierleitfaden vorgestellt.
- Einfluss der situativen Gewaltdynamik auf das Handeln der Hutu: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Analyse und untersucht den Einfluss der situativen Gewaltdynamik auf das Handeln der Hutu im Völkermord.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Untersuchung der situativen Gewaltdynamik im Völkermord in Ruanda und deren Einfluss auf das Handeln der Täter. Schlüsselbegriffe sind dabei die "Theorie der Konfrontationsspannung" nach Collins, die qualitative Inhaltsanalyse, die Kategorien "Besessenheit", "Autopilot" und "Gruppenzwang", sowie die ethnischen Konflikte zwischen Hutu und Tutsi in Ruanda.
Häufig gestellte Fragen
Welche Forschungsfrage steht im Zentrum der Arbeit zum Völkermord in Ruanda?
Die Arbeit untersucht, inwiefern die situative Gewaltdynamik das exzessive Handeln der Hutu während des Völkermordes 1994 erklären kann.
Was besagt die „Theorie der Konfrontationsspannung“ nach Collins?
Nach Collins muss Gewalt einen Moment der Anspannung und physiologischen Erregung passieren, bevor Akteure in einen sogenannten „Tunnel der Gewalt“ eintreten können.
Welche methodische Vorgehensweise wurde gewählt?
Es wurde eine qualitative Inhaltsanalyse von Interviews mit Tätern und Opfern durchgeführt, die von Jean Hatzfeld gesammelt wurden.
Welche Kategorien werden zur Analyse der Gewalt genutzt?
Die Analyse basiert auf den deduktiv abgeleiteten Kategorien Besessenheit, Autopilot und Gruppenzwang.
Welchen historischen Hintergrund beleuchtet die Arbeit?
Die Arbeit skizziert die Kolonialgeschichte Ruandas, die Etablierung rassenideologischer Überzeugungen und die Hutu-Revolution von 1959.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Völkermord in Ruanda. Einfluss der situativen Gewaltdynamik auf das Handeln der Hutu, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1119823