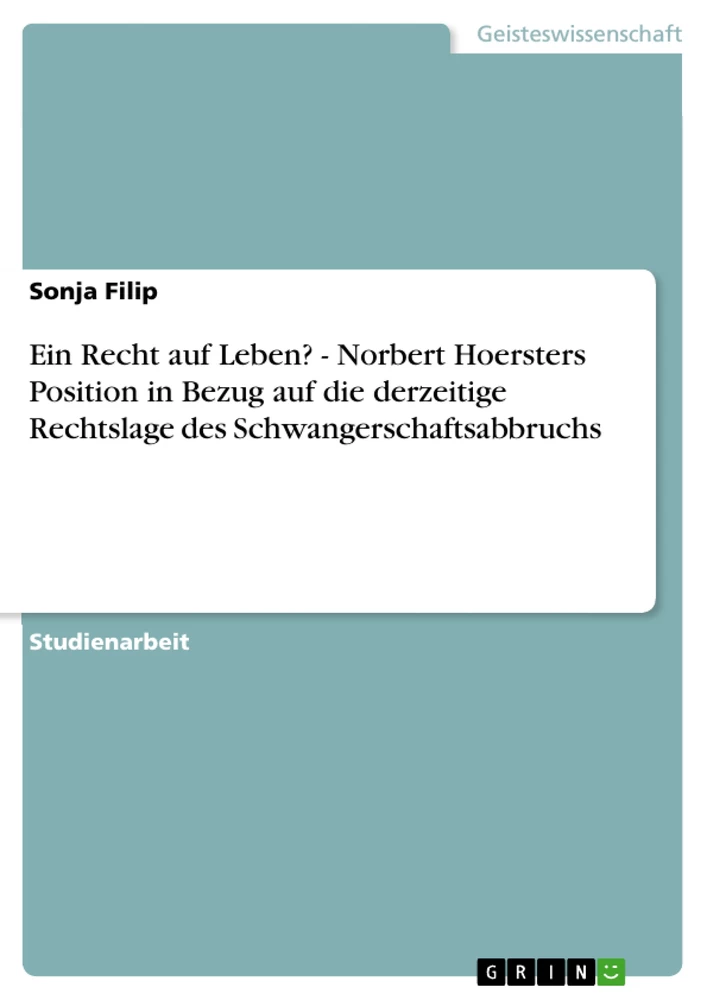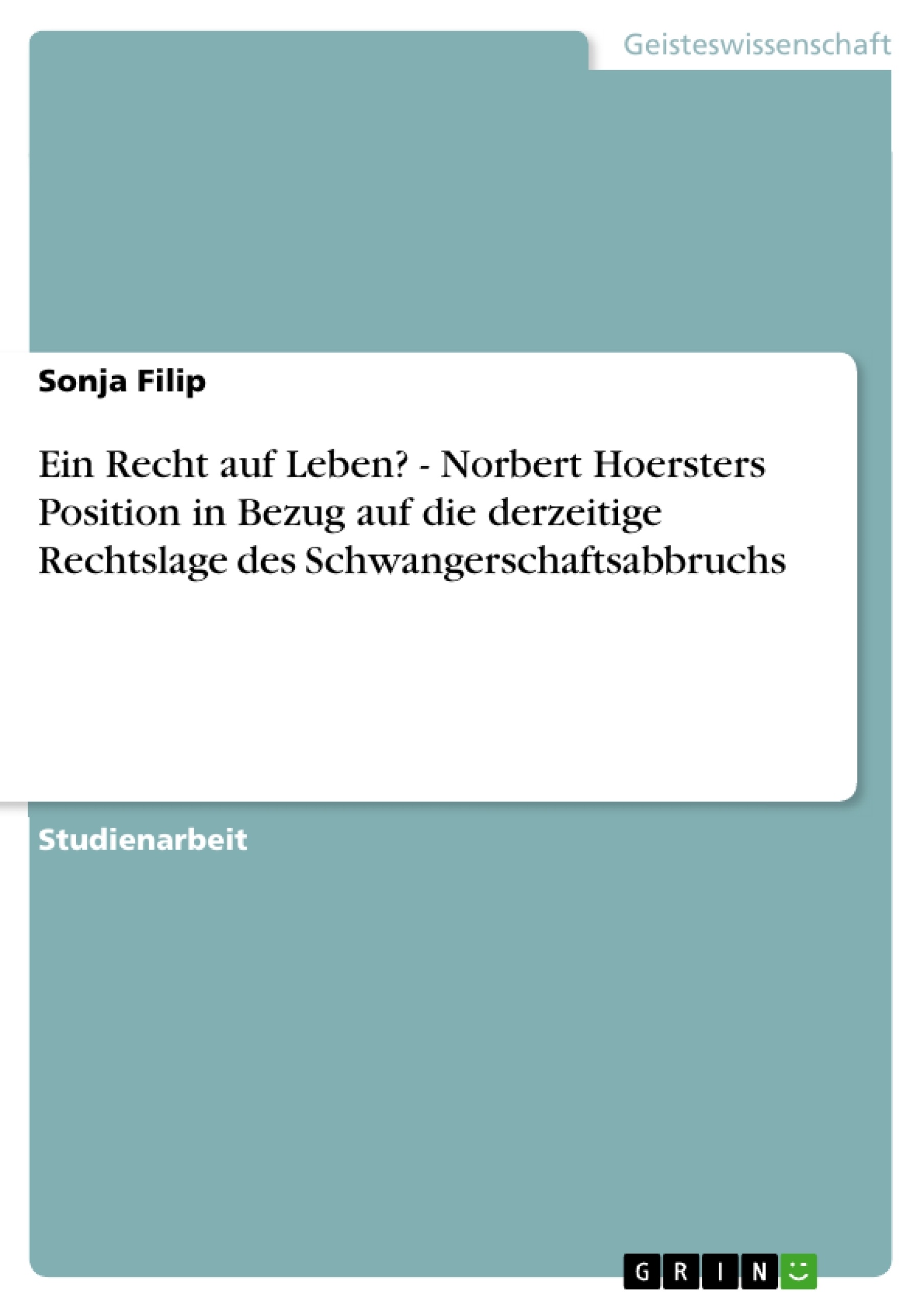Es gibt nur wenige Themen, die über so viele Jahre derart kontinuierlich diskutiert werden wie die Thematik der Abtreibung1 und den dazugehörigen Strafrechtsparagraphen 218 des deutschen Strafgesetzbuches. Der § 218 enthielt über Jahrzehnte ein absolutes Verbot der Abtreibung. Erst im Jahr 1927 wurde die medizinische Indikation eingeführt – es wurde also hiermit erlaubt, dass im Falle der Lebensgefahr der Mutter das Kind im Mutterleib abgetrieben werden darf. Doch nicht nur in Deutschland, sondern in fast allen westlichen Demokratien ist es in den vergangenen drei Jahrzehnten per Gesetzesreformen zu einer Liberalisierung der Abtreibungspraxis gekommen. Es wurden Ausnahmesituationen geschaffen, in denen der Schwangerschaftsabbruch nun erlaubt ist, oder aber das Verbot der Abtreibung wurde bis zu einem bestimmten Zeitpunkt der Schwangerschaft ganz aufgehoben.
Hartnäckig kämpfen Konservative Seite an Seite mit der katholischen Kirche gegen den "Mord an unschuldigen Kindern"2, während vor allem die Frauenbewegung das Recht auf Selbstbestimmung der Frauen über ihren Körper fordert. Allerorts liest man zudem davon, dass ein Verbot oder auch eine Erlaubnis des Schwangerschaftsabbruchs daran gekoppelt wird, ob das ungeborene Kind bereits den Personenstatus zugesprochen bekommt und insofern ebenfalls Personenrechte in dem Sinne des besonderen Schutzes genießt. Sollte das der Fall sein, so wäre dies mit einem generellen Abtreibungsverbot zu beantworten. Mit derselben Frage beschäftigt sich auch Norbert Hoerster, der sicherlich zu den umstrittensten Gelehrten Deutschlands zählt. Seine Schriften zur Bioethik lösten so heftige Diskussionen und Kontroversen aus, dass er 1998 vorzeitig aus dem Universitätsdienst ausschied, nachdem er seit 1974 in Mainz als Professor für Rechts- und Sozialphilosophie gelehrt hatte. Sein Buch „Abtreibung im säkularen Staat. Argumente gegen den §218“3 liegt dieser Arbeit als Hauptwerk zugrunde. Es wird untersucht, wie er den Personenbegriff versteht und welche Konsequenzen sich hieraus für ein eventuelles Abtreibungsverbot ergeben. Außerdem sollen im Schlussteil dieser Arbeit exemplarisch auch Kritiker Hoersters wie zum Beispiel Robert Spaemann zu Wort kommen und Hoersters Nähe zu Peter Singer untersucht werden.
Zuvor soll jedoch im ersten Teil dieser Arbeit auf die Geschichte der Abtreibung eingegangen werden. Ebenso wird die Rechtslage in Deutschland und in anderen Ländern kurz erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Geschichte der Abtreibung
- Die Rechtslage
- Deutschland
- Andere Länder
- Die Haltung Hoersters
- Überlebensinteresse
- Personalität
- Zum Begriff der Person
- Der Fötus als Person?
- Potentielle Personalität
- Hoerster und Peter Singer
- Die Haltung der katholischen Kirche
- Gegenpositionen zu Hoerster
- Allgemeine Diskussion
- Die Position Spaemanns
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Norbert Hoersters Position zum Schwangerschaftsabbruch im Kontext der deutschen Rechtslage und der bioethischen Debatte. Sie analysiert seinen Personenbegriff und dessen Konsequenzen für die Frage nach einem Abtreibungsverbot. Zusätzlich werden Gegenpositionen und die Einordnung Hoersters in den Diskurs mit anderen relevanten Denkern beleuchtet.
- Die Geschichte des Schwangerschaftsabbruchs und die Entwicklung der Rechtslage.
- Hoersters Verständnis des Personenbegriffs und seine Argumentation gegen ein Abtreibungsverbot.
- Der Vergleich Hoersters Position mit der Haltung der katholischen Kirche und anderen Philosophen.
- Die Rolle des Überlebensinteresses und der potentiellen Personalität in der Debatte.
- Die Auseinandersetzung mit Gegenpositionen, insbesondere der Position Robert Spaemanns.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Schwangerschaftsabbruchs und des §218 StGB ein. Sie beschreibt die langjährige Kontroverse um Abtreibung und die Liberalisierung der Abtreibungspraxis in westlichen Demokratien. Der Fokus liegt auf Norbert Hoersters umstrittener Position und der Frage nach dem Personenstatus des Fötus als entscheidenden Faktor für ein Abtreibungsverbot. Die Arbeit kündigt die Untersuchung von Hoersters Personenbegriff und den Vergleich mit Gegenpositionen an.
Die Geschichte der Abtreibung: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Abtreibung von der Antike bis zur frühen Neuzeit. Es zeigt, wie die Einstellung zur Abtreibung von antiken Gesellschaften, die den Fötus nicht als eigenständiges Lebewesen betrachteten, über das Mittelalter mit dem Einfluss der christlichen Kirche bis zur Neuzeit mit der Etablierung weltlicher Justiz reichte. Der Fokus liegt auf der Entwicklung unterschiedlicher moralischer und rechtlicher Perspektiven auf den Schwangerschaftsabbruch und dem sich wandelnden Verständnis von Fötus und Menschwerdung.
Die Rechtslage: Dieser Abschnitt befasst sich mit der aktuellen Rechtslage zum Schwangerschaftsabbruch in Deutschland und anderen Ländern. Es werden die unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen und ihre Entwicklung beschrieben, um den Kontext von Hoersters Argumentation und der anhaltenden Debatte zu verdeutlichen. Der Vergleich verschiedener nationaler Rechtssysteme unterstreicht die komplexen und unterschiedlichen Perspektiven auf die Thematik.
Die Haltung Hoersters: Dieses Kapitel analysiert ausführlich Norbert Hoersters Argumentation gegen §218 StGB. Es untersucht seine Definition des Personenbegriffs und seine Begründung, warum der Fötus nicht als Person im rechtlichen Sinne betrachtet werden sollte. Die Rolle des Überlebensinteresses und die Frage nach potentieller Personalität werden detailliert beleuchtet. Seine Argumente und deren Begründung werden kritisch geprüft und im Kontext der bioethischen Debatte eingeordnet.
Schlüsselwörter
Schwangerschaftsabbruch, §218 StGB, Abtreibung, Norbert Hoerster, Personenbegriff, Personalität, potentielle Personalität, Überlebensinteresse, Bioethik, Robert Spaemann, Peter Singer, Katholische Kirche, Rechtslage.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Position Norbert Hoersters zum Schwangerschaftsabbruch
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Position von Norbert Hoerster zum Schwangerschaftsabbruch, seinen Personenbegriff und dessen Konsequenzen für die Frage nach einem Abtreibungsverbot. Sie vergleicht seine Position mit der katholischen Kirche und anderen Philosophen (z.B. Peter Singer, Robert Spaemann) und beleuchtet die deutsche Rechtslage (§218 StGB) sowie internationale Unterschiede.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst die Geschichte des Schwangerschaftsabbruchs, die aktuelle Rechtslage in Deutschland und anderen Ländern, Hoersters Argumentation gegen ein Abtreibungsverbot (inklusive seiner Definition von Personalität und Überlebensinteresse), den Vergleich mit Gegenpositionen (insbesondere Robert Spaemann) und die Rolle der katholischen Kirche in der Debatte.
Wie definiert Hoerster den Personenbegriff, und welche Rolle spielt er in seiner Argumentation?
Die Arbeit untersucht detailliert Hoersters Personenbegriff und wie er diesen verwendet, um seine Argumentation gegen ein Abtreibungsverbot zu stützen. Die Rolle des Überlebensinteresses und die Frage nach potentieller Personalität werden dabei kritisch beleuchtet.
Wie wird Hoersters Position im Vergleich zu anderen Philosophen und der katholischen Kirche dargestellt?
Die Arbeit vergleicht Hoersters Position explizit mit der Haltung der katholischen Kirche und anderen relevanten Denkern wie Peter Singer und Robert Spaemann. Die unterschiedlichen Perspektiven und Argumentationslinien werden gegenübergestellt.
Welche Rolle spielt die Rechtslage im Kontext der Arbeit?
Die Rechtslage zum Schwangerschaftsabbruch in Deutschland und anderen Ländern bildet einen wichtigen Kontext für die Analyse. Die Arbeit beschreibt die aktuelle Rechtslage und deren historische Entwicklung, um Hoersters Argumentation besser einzuordnen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schwangerschaftsabbruch, §218 StGB, Abtreibung, Norbert Hoerster, Personenbegriff, Personalität, potentielle Personalität, Überlebensinteresse, Bioethik, Robert Spaemann, Peter Singer, Katholische Kirche, Rechtslage.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet Kapitel zur Einleitung, der Geschichte der Abtreibung, der Rechtslage, Hoersters Position (inklusive detaillierter Analyse seines Personenbegriffs), einem Vergleich mit anderen Positionen (Katholische Kirche, Peter Singer, Robert Spaemann) und einem Fazit.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit ist nicht explizit im bereitgestellten Text enthalten. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung der vorherigen Kapitel und der Analyse der verschiedenen Positionen, bietet aber keine explizite Schlussfolgerung.)
- Quote paper
- Sonja Filip (Author), 2005, Ein Recht auf Leben? - Norbert Hoersters Position in Bezug auf die derzeitige Rechtslage des Schwangerschaftsabbruchs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111989