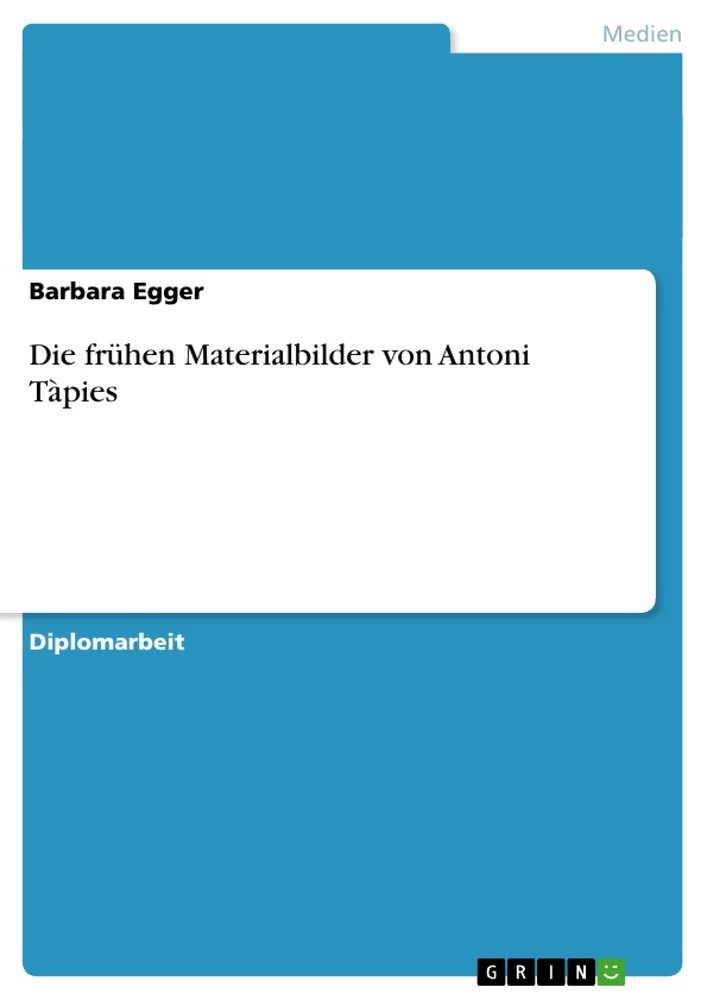Die vorliegende Arbeit ist schwerpunktmäßig den Materialbildern von Antoni Tàpies von 1954 bis in die 1970er Jahre gewidmet. Eingangs wird die Entwicklung von Tàpies Frühwerk ab 1946 skizziert. Besonders herausgestellt werden hier die Beziehungen der frühen magisch-visionären und mythischen Formulierungen des Künstlers zum Symbolismus sowie seine im Zusammenhang mit dem Protest gegen das Franco-Regime sich vollziehende Hinwendung zum Surrealismus. Wichtige Bezugspunkte von Tàpies sind hier neben der katalanischen Tradition (Ribera und Ribalta) die Kunst von Dalí, Miró, Max Ernst und Paul Klee. Ab 1952 arbeitet Tàpies dann zunehmend abstrakt und experimentiert mit verschiedenen Texturen – bis dann 1954 der künstlerische Durchbruch zu den wandartigen Materialbildern erfolgte (katalan. Tàpia/pl. Tàpies = Lehmwand bzw. Gartenmauer).
Die beiden Kapitel des Mittelteils der Arbeit thematisieren zunächst die Wahrnehmung der Materialbilder, ihre perzeptive Ambiguität und Zeitlichkeit. Im Folgenden gilt das Interesse dann der Formlosigkeit und Deformation der „niederen Motive“ dieser Malerei. Tàpies wird in Verbindung mit Batailles informe und der Bedeutung des Niederen, des Abstoßenden und des bas realisme im Werk von Man Ray, Abac, Boiffard und Brassai und die Beschäftigung des Künstlers mit Magie und dem Okkulten wird unter Hinweis auf den großen Katalanen Raimundus Lullus diskutiert. Im abschließenden Kapitel werden die Materialbilder von Tàpies als Archive der kollektiven Erinnerung aufgefasst. Im Anschluss an Adornos Überlegungen zur Geschichtlichkeit des Materials und an die Positionen von Halbwachs und Assmann zum kollektiven bzw. kulturellen Gedächtnis wird die Erinnerungsarbeit der Materialbilder herausgestellt, ihr zeichenhaftes Eingedenken der Kultur Kataloniens und seiner Geschichte (etwa im Spanischen Bürgerkrieg), ihre Qualität als „emblematische und heraldische Historienbilder“.
Neben erhellenden Analysen einzelner Gemälde, werden die zentralen Qualitäten der Materialbilder theoretisch produktiv kontextualisiert, indem etwa Formlosigkeit, die Spannung von Form und Materie sowie die Wahrnehmung dieser Malerei, ihr offener Charakter und ihre Dimension als „Erinnerungsraum kultureller Identitätsstiftung“ im Rückgang auf die hier jeweils wichtige theoretische Positionen (Bataille, Bachelard, Merleau-Ponty, Eco und Halbwachs/Assmann) diskutiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- DIE ZEIT UND DIE MATERIALBILDER VON ANTONI TAPIES —
- DIE ENTWICKLUNG HIN ZU DEN MATERIALBILDERN —
- Das Frühwerk
- Die frühesten Werke von Tapies und der Symbolismus
- Die Hinwendung zum Surrealismus
- Das soziale Bewusstsein
- Von den abstrakten Tendenzen zur Textur
- DIE MATERIALBILDER
- Der Entstehungsrahmen der Materialbilder
- DIE WAHRNEHMUNG DER MATERIALBILDER.mmmm..m..m..m..m..m..m..m.mm
- Die Wahrnehmung der Materialbilder
- Am Beispiel Relleu gris sobre fusta
- Die Bewegung und das offene Kunstwerk
- Die perzeptive Ambiguität
- Die Sprachfragmente und deren drei Wahrnehmungsbereiche
- Das Kunstwerk als Wahrnehmungsproblem
- VON DEN NIEDERE.VMOTIVEN„mmmmmmmmmmmm..m..m..m..m..m..m..m.mm
- L' informe
- Die Techniken des informe
- Der Mimétisme
- Exkurs: Assemblagen und Objekte
- UBER DIE FORMLOSIGKEIT UND (DE)FORMATION DER MOTIVE.m..m..m..m..m..m..mmm.
- ZUR ZEITLICHKEIT DER OBJEKTE —
- Die Techniken des b!forme
- AssEMBLAGEN l_mn OBJEKTE
- DIE MATERIALBILDERALS ERINNERUNGSRAUMEmmmmm..m..m..m..m..m..m..m.mm
- Die Zeitlichkeit der Erde
- Das Werk als Gedächtnisarchäologie
- Das kollektive und kulturelle Gedächtnis
- Die Mémoire collective
- Das kulturelle Gedächtnis zur kollektiven Identitätsbildung
- Die Mauerbilder
- Die emblematischen und heraldischen Historienbilder
- ZUR KULTURELLEN IDENTITATSSTIFTUNG„mmmmmmm..m..m..m..m..m..m..m..mmm.
- DEZEITLICHKEITDERERDE___ .
- DAS
- Das kollektive und kulturelle Gedächtnis
- Die Mémoire
- Das kulturelle Gedächtnis zur kollektiven Identitätsbildung
- Die _
- Die emblematischen und heraldischen Historienbilder
- Vl DIE ZEIT ODERFURDIE EWIGKEIT m..m..m..m..m..m..m..m. 94
- vil BIBLIOGRAPHIE — 9
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Zeitlichkeit in den Materialbildern von Antoni Tåpies. Die Arbeit untersucht, wie sich die Zeit in den Werken des Künstlers manifestiert, insbesondere in Bezug auf die Erinnerung (vergangen), die Anschauung (gegenwärtig) und die Erwartung (zukünftig). Der Fokus liegt dabei auf den Materialbildern der 1950er bis 1970er Jahre, da Tåpies in dieser Phase die Grundfesten seiner künstlerischen Sprache entwickelte.
- Die Materialbilder als Ausdruck von Zeitlichkeit
- Die Rolle der Erinnerung in den Materialbildern
- Die Bedeutung des Materials und seiner (De)formation
- Die Funktion des Kunstwerks als Wahrnehmungsproblem
- Die Materialbilder als Erinnerungsräume und ihre Verbindung zur kulturellen Identität Kataloniens
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich der Entwicklung von Antoni Tåpies' Werk von seinen Anfängen im Jahr 1946 bis hin zu den ersten Materialbildern des Jahres 1954. Es wird die Auseinandersetzung des Künstlers mit dem Symbolismus, dem Surrealismus, dem sozialen Realismus und der geometrischen Abstraktion beleuchtet. Tåpies' Hinwendung zur Textur und der Einsatz von Materialien wie Sand, Marmorstaub und farbiger Erde werden als entscheidende Schritte hin zu den Materialbildern betrachtet.
Das zweite Kapitel analysiert die Wahrnehmung der Materialbilder. Am Beispiel des Werks "Relleu gris sobre fusta" (Graues Relief auf Holz, 1965) wird die komplexe Struktur des Bildes untersucht. Die Ambiguität der Bildelemente, die Bewegung und das offene Kunstwerk sowie die perzeptive Ambiguität werden als zentrale Aspekte der Wahrnehmung von Tåpies' Werken betrachtet.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den niederen Motiven und der Formlosigkeit in den Materialbildern. Es wird ein Bezug zu George Batailles "informe" hergestellt und die Bedeutung von Motiven wie dem Fuß und dem Anus im Werk von Tåpies analysiert. Der Begriff des "mimétisme" von Roger Caillois wird im Kontext der (De)formation der Motive und der Verschmelzung von Form und Material betrachtet.
Das vierte Kapitel untersucht die Materialbilder als Erinnerungsräume. Es wird die Rolle der Erde als Material mit einer spezifischen Zeitlichkeit und Geschichte betrachtet. Die Materialbilder werden als eine Art Gedächtnisarchäologie interpretiert, in der Tåpies Fragmente der Vergangenheit in die Gegenwart überführt. Der Bezug zu den Schriften von Maurice Halbwachs und Aleida und Jan Assmann wird hergestellt, um die Bedeutung des kollektiven und kulturellen Gedächtnisses im Werk von Tåpies zu beleuchten.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit den emblematischen und heraldischen Historienbildern von Antoni Tåpies. Die Werke, die auf gelbem Grund vier vertikale Balken zeigen, werden als Ausdruck der katalanischen Identität und als politische Statements während der Franco-Diktatur betrachtet. Die Verbindung zu den Schriften von Ingeborg Bachmann und den katalanischen Mystikern wird hergestellt, um die Bedeutung der Erinnerung an die Geschichte Kataloniens im Werk von Tåpies zu verstehen.
Das sechste Kapitel reflektiert über die Materialbilder als Werke, die für die Zeit oder für die Ewigkeit geschaffen wurden. Die Unmittelbarkeit der Materialbilder, die Offenheit der Wahrnehmung und die Erkenntnispotenz des Werks werden als zentrale Aspekte betrachtet. Die Frage, ob die Materialbilder trotz ihrer Gegenwärtigkeit als Werke der Ewigkeit zu verstehen sind, wird gestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Materialbilder von Antoni Tåpies, Zeitlichkeit, Erinnerung, Anschauung, Erwartung, Wahrnehmung, Formlosigkeit, Mimétisme, Informe, Gedächtnis, kulturelle Identität, Katalonien, Franco-Diktatur, Kunst als Kommunikation, Kunst als Wahrnehmungsproblem, Kunst als Realerfahrung.
- Quote paper
- Barbara Egger (Author), 2007, Die frühen Materialbilder von Antoni Tàpies, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111998