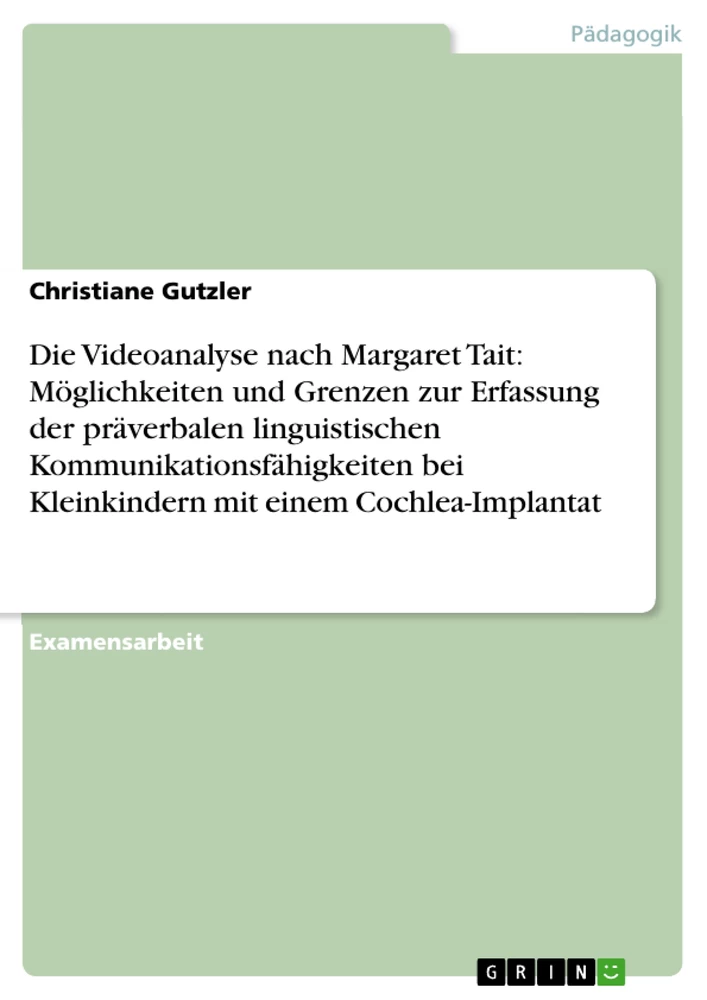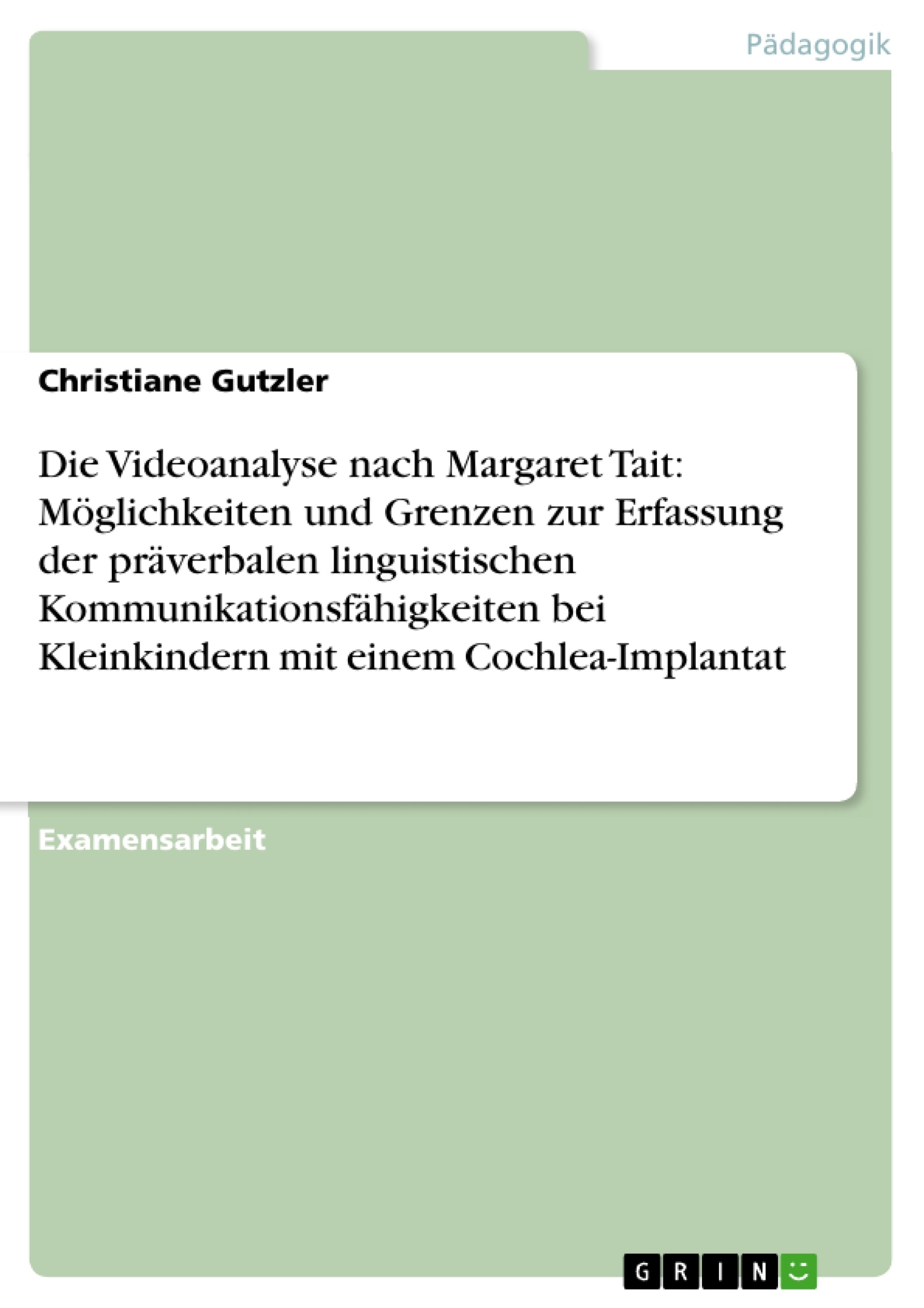Die Anzahl hörgeschädigter Kleinkinder, die vor dem zweiten Lebensjahr mit einem Cochlea-Implantat versorgt werden, nimmt kontinuierlich zu. Untersuchungsverfahren und Entwicklungsnormen zur Beurteilung der vorsprachlichen Kommunikationsentwicklung dieser Kinder fehlen allerdings bisher. In der Literatur wird die Entwicklung präverbaler Kommunikationsstrukturen als wesentlicher Indikator für eine regelrechte Sprachentwicklung bei Kleinkindern betont. Eine Überprüfung der frühen Gestenkommunikation, die eng mit der Entwicklung sprachlicher Fähigkeiten zusammenhängt, wird in den allgemein bekannten Untersuchungsverfahren für hörgeschädigte Kinder oft vernachlässigt (Lenarz et al. 1999). Neuere Forschungsergebnisse betonen jedoch, welch kritischer Stellenwert der Verwendung kommunikativer Gesten als wesentliche Vorläufer für die Sprachentwicklung sowohl bei hörgeschädigten als bei normalhörenden Kindern zukommt (Grimm 2003, Volterra und Iverson 1995).
Bei der vorliegenden Arbeit geht es darum, zu zeigen, dass durch die Aufnahme zusätzlicher, qualitativer Kriterien in den bestehenden Kriterienkatalog der Videoanalyse nach Margaret Tait eine differenziertere Einsicht in die präverbal- und ersten verbal-kommunikativen Kompetenzen sowie das Kommunikationsniveau von cochlea-implantierten Kindern möglich ist. Zu diesem Zweck wurden sieben neue Analysekriterien in das Verfahren aufgenommen, welche dann neben der ursprünglichen Originalversion an drei Kindern mit prälingual erworbener Hörstörung angewendet wurden. Die Originalversion wurde im Rahmen einer Longitudinalstudie, die in den Jahren 2000 bis 2004 am Royal Institute for Deaf and Blind Children (Australien) durchgeführt wurde, an insgesamt fünf prälingual ertaubten Kindern und einem mittleren Alter von 1;2 Jahren (Spanne 1;0 – 4;10 Jahren) angewendet. Die Testpersonen wiesen im Durchschnitt einen mittleren Hörverlust des besseren Ohres von 88 dB Hearing Level (HL) (Spanne 75 - 108 dB) in den Frequenzen 500, 1000 und 2000 Hz auf. Nach der Cochlea Implantation lag ihre Hörschwelle im Durchschnitt bei 40 dB (Spanne 35-45 dB).
Die erhobenen Daten zeigen, dass die Sprachentwicklung von Kleinkindern individuell sehr unterschiedlich verläuft. Neben den messbaren und bereits als Standardeinflussfaktoren zu betrachtenden Faktoren (Art der Versorgung, Alter bei Erstdiagnose und Hörhilfenversorgung, Art und Grad der Hörstörung, optimale technische Versorgung, etc.) können anhand der Ergebnissen aus den Videoanalysen weitere Faktoren (triangulärer Blickkontakt, Gebrauch kommunikativer Gesten) als mögliche Einflussfaktoren auf die Sprachentwicklung identifiziert werden.
Mittels der Tait-Videoanalyse ist es möglich, bereits bei Kleinkindern während der sensiblen Phase der Hör- und Sprachentwicklung die präverbale und frühe linguistische Entwicklung zu dokumentieren. Die qualitative Analyse der präverbalen Kompetenzen nach dem erweiterten Kategorienschema liefert detaillierte Informationen hinsichtlich ihres Sprachentwicklungsstandes. Die damit gewonnenen Ergebnisse dienen somit einer bessere Beratung und Anleitung von Eltern und Therapeuten und können auch zur Qualitätskontrolle hinsichtlich der Effizienz der Hörhilfen eingesetzt werden.
Es lässt sich schlussfolgern, dass sich die qualitativen Beobachtungskriterien als eine sinnvolle Ergänzung zu dem bestehenden quantitativ ausgerichteten Testprotokoll erweisen und dass das erweiterte Testprotokoll in Kombination mit der Originalversion der Tait-Videoanalyse in besonderem Maße für die Evaluation des präverbalen Kommunikationrverhaltens von Kindern mit einer Hörschädigung geeignet ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Hör- und Sprachentwicklung normalhörender Kinder
- Motivation und Kompetenzen des Kindes
- Wahrnehmungsfähigkeiten und frühe auditive Entwicklung
- Entwicklung der Lautproduktion
- Visuelle Wahmehmung und Entwicklung des Blickkontakts
- Motivation und Kompetenzen des erwachsenen Interaktionspartners
- Aufbau der frühen face-to-face-Interaktion
- Entwicklung kommunikativer Kompetenz
- Intentionalität und Produktion der referentiellen Gesten
- Die gemeinsame Aufmerksamkeit
- Aus gemeinsamer Aufmerksamkeit wird Referenz
- Die symbolische Kommunikation
- Die Hör- und Sprachentwicklung hörgeschädigter Kinder
- Auswirkungen der Hörschädigung auf den Lautspracherwerb
- Auswirkungen der Hörschädigung auf das Blickverhalten
- Auswirkungen der Hörschädigung auf die sozial-emotionale Entwicklung
- Auswirkungen der Hörschädigung auf die Interaktion kommunikative Entwicklung
- Früherkennung und apparative Versorgung
- Sprachemerb bei Kindem mit Cochlea-Implantat
- Beurteilung des sprachlichen Entwicklungsniveaus
- Die Videoanalyse nach Margaret Tait
- Entstehung der Videoanalyse nach Margaret Tait
- Durchführung der Videoanatyse
- Bisherige Untersuchungsergebnisse
- Methodisches Vorgehen
- Beschreibung der Stichprobe
- Der Untersuchungsplan
- Videographische Aufzeichnung
- Transkription der Daten
- Quantitative Auswertung
- Qualitative Auswertung
- Die Gütekriterien
- Darstellung und Interpretation der Ergebnisse
- Quantitative Auswertung der Videosequenzen des Kindes Nancy
- Quantitative Auswertung der Videosequenzen des Kindes Marc
- Quantitative Auswertung der Videosequenzen des Kindes Eva
- Qualitative Auswertung der gestischen Entwicklung des Kindes Eva
- Quantitative Auswertung der Videosequenzen des Kindes Tom
- Qualitative Auswertung der gestischen Entwicklung des Kindes Tom
- Quantitative Auswertung der Videosequenzen des Kindes Rita
- Qualitative Auswertung der gestischen Entwicklung des Kindes Rita
- Reliabilitätsprüfung
- Diskussion
- Möglichkeiten der Tat-Videoanalyse
- Reliabilität und Objektivität der Methode
- Dauer und Durchführung der Methode
- Einbezug der Eltem
- Umgang mit den Ergebnissen
- Die Bewertung der gestischen Entwicklung und des Blickkontaktes
- Zusammenfassende Beurteilung und Schlussfolgerung
- Literaturverzeichnis
- Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Videoanalyse nach Margaret Tait als Methode zur Erfassung der präverbalen linguistischen Kommunikationsfähigkeiten bei Kleinkindern mit einem Cochlea-Implantat. Die Arbeit analysiert die Möglichkeiten und Grenzen des Verfahrens, indem sie die Entwicklung der Kommunikationsfähigkeiten von fünf Kindern mit prälingual erworbener Hörstörung im Alter von 1;2 Jahren bis 2;7 Jahren untersucht. Das Verfahren wird dabei um sieben qualitative Beobachtungskriterien erweitert, um eine detailliertere Einsicht in die präverbal- und ersten verbal-kommunikativen Kompetenzen sowie das Kommunikationsniveau der Kinder zu ermöglichen.
- Die Entwicklung präverbaler Kommunikationsfähigkeiten bei Kleinkindern mit Cochlea-Implantat
- Die Möglichkeiten und Grenzen der Videoanalyse nach Margaret Tait
- Die Auswirkungen der Hörschädigung auf die sprachliche Entwicklung
- Die Bedeutung der frühen Intervention und Förderung
- Die Bedeutung von Gesten und Blickkontakt in der Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Bedeutung des frühen Spracherwerbs für die kognitive und soziale Entwicklung des Kindes dar und beleuchtet die Herausforderungen, die sich für hörgeschädigte Kinder im Prozess des Sprachemerbs ergeben. Die Arbeit fokussiert auf die Videoanalyse nach Margaret Tait als Methode zur Beurteilung der präverbalen Kommunikationsfähigkeiten von Kindern mit Cochlea-Implantat.
Kapitel 1 beschreibt die Hör- und Sprachentwicklung normalhörender Kinder im Rahmen der frühen Eltern-Kind-Interaktion. Es wird die Entwicklung der sprachrelevanten Wahrnehmung, der sozialen Kognition und der allgemeinen Kognition dargestellt, die für den Spracherwerb von Bedeutung sind. Außerdem wird die Bedeutung des Blickkontakts und der Responsivität der Eltern für die Entwicklung des Kindes beleuchtet.
Kapitel 2 befasst sich mit der Entwicklung kommunikativer Kompetenz bei hörenden Kindern. Es werden die verschiedenen Stadien der präverbalen Kommunikation, wie die Produktion von referentiellen Gesten, die gemeinsame Aufmerksamkeit und die symbolische Kommunikation, erläutert. Die Arbeit verdeutlicht die Bedeutung der Interaktion zwischen Kind und Bezugsperson für die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz.
Kapitel 3 analysiert die Auswirkungen einer Hörschädigung auf die Entwicklung sozial-kommunikativer und sprachlicher Fähigkeiten bei Kleinkindern. Es werden die Folgen der Hörstörung für den Lautspracherwerb, das Blickverhalten, die sozial-emotionale Entwicklung und die Interaktion mit den Bezugspersonen dargestellt. Außerdem wird die Bedeutung der Früherkennung und apparativen Versorgung für die Sprachentwicklung hörgeschädigter Kinder betont.
Kapitel 4 stellt die Videoanalyse nach Margaret Tait als Methode zur Beurteilung der präverbalen Kommunikationsfähigkeiten von Kindern mit Cochlea-Implantat vor. Es werden die Entstehung des Verfahrens, die Durchführung der Videoanatyse und bisherige Untersuchungsergebnisse dargestellt.
Kapitel 5 beschreibt das methodische Vorgehen der vorliegenden Arbeit. Es werden die Stichprobe, der Untersuchungsplan, die videographische Aufzeichnung, die Transkription der Daten, die quantitative und qualitative Auswertung sowie die Gütekriterien der Studie erläutert.
Kapitel 6 präsentiert die Ergebnisse der Videoanalyse. Die Arbeit analysiert die präverbalen und frühen linguistischen Fähigkeiten der fünf untersuchten Kinder anhand von quantitativen und qualitativen Daten und stellt die individuellen Entwicklungsprofile der Kinder dar.
Kapitel 7 diskutiert die Möglichkeiten und Grenzen der Videoanalyse nach Margaret Tait. Es werden die Reliabilität und Objektivität der Methode, die Dauer und Durchführung der Methode, die Einbeziehung der Eltern, der Umgang mit den Ergebnissen und die Bewertung der gestischen Entwicklung und des Blickkontaktes beleuchtet.
Die Schlussfolgerung fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und betont die Bedeutung der Videoanalyse als Methode zur Beurteilung der präverbalen Kommunikationsfähigkeiten von Kindern mit Cochlea-Implantat. Die Arbeit unterstreicht die Notwendigkeit einer frühen Intervention und Förderung, um die sprachliche Entwicklung hörgeschädigter Kinder zu unterstützen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Videoanalyse nach Margaret Tait, die präverbale linguistische Kommunikationsfähigkeiten, Cochlea-Implantat, Hörstörung, Sprachentwicklung, Frühförderung, Blickkontakt, Gesten, Interaktion, Eltern-Kind-Beziehung, und die qualitative und quantitative Auswertung.
- Citation du texte
- Christiane Gutzler (Auteur), 2006, Die Videoanalyse nach Margaret Tait: Möglichkeiten und Grenzen zur Erfassung der präverbalen linguistischen Kommunikationsfähigkeiten bei Kleinkindern mit einem Cochlea-Implantat, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112041