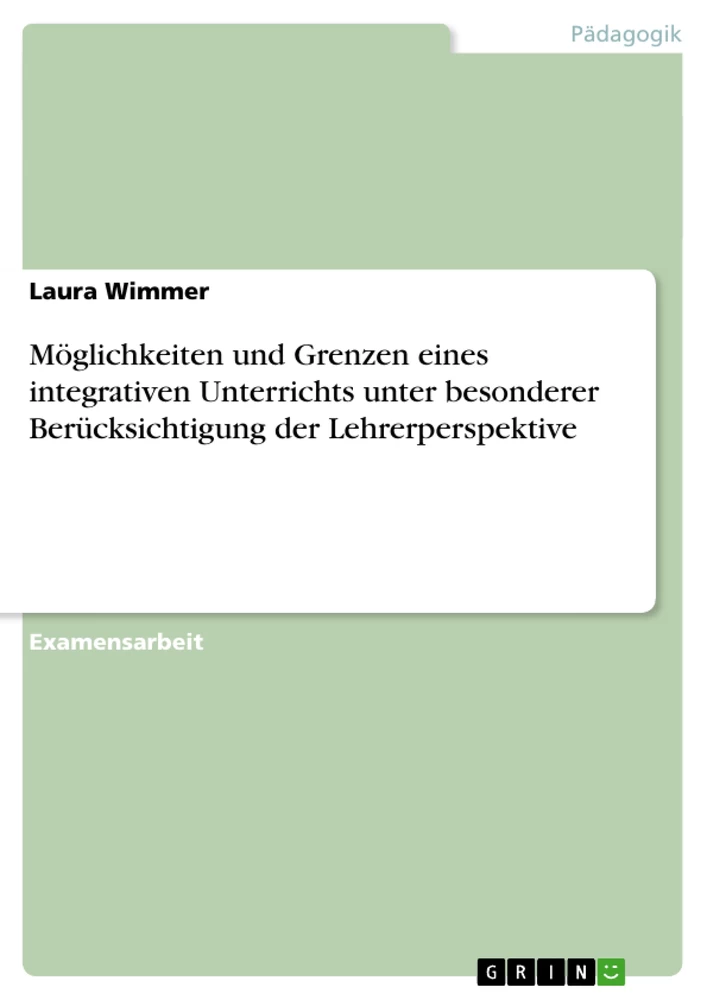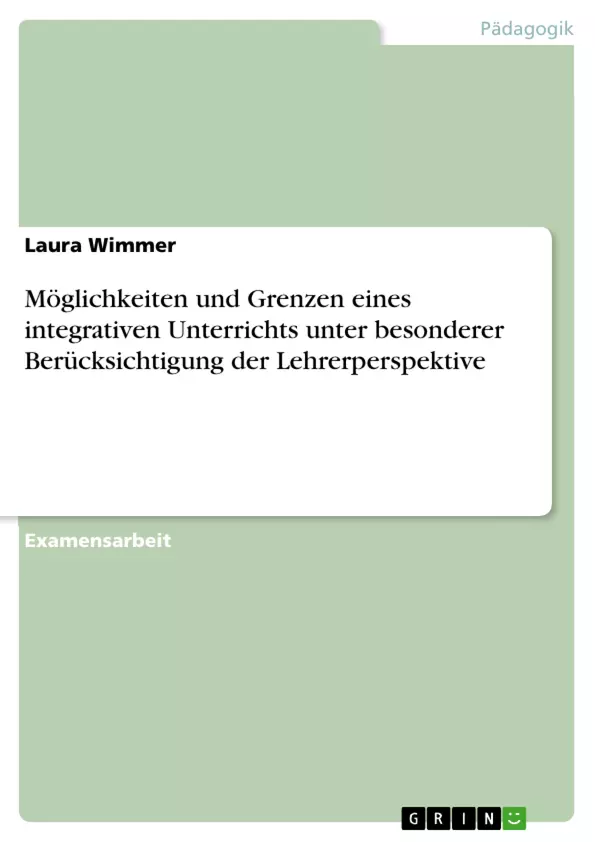Vor nunmehr über 30 Jahren sind in verschiedenen Bundesländern unter Einfluss von Elterninitiativen die ersten Schulversuche ins Leben gerufen worden, in denen behinderte und nicht behinderte Schüler gemeinsam unterrichtet wurden. Spätestens mit den 1994 von der Kultusministerkonferenz veröffentlichten „Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen der BRD“ gilt die Beschulung in Regel- und Sonderschulen als gleichwertig. Im Zuge dessen sind seitdem in allen Bundesländern verschiedene Formen integrativen Unterrichts gesetzlich verankert. Dieser ist also nicht mehr nur beschränkt auf Modellversuche, sondern mittlerweile schulische Realität (vgl. Heimlich 2007, S. 69).
Zahlreiche Pädagogen haben sich damit auseinandergesetzt, die Bedingungen für erfolgreiches Lernen in integrativen Klassen zu ermitteln. Es besteht Einigkeit darüber, dass man den vielfältigen Lern- und Leistungsvoraussetzungen der Schüler am ehesten im Rahmen eines zieldifferenten gemeinsamen Unterrichts durch offene Unterrichtsformen gerecht wird, wenn gleichzeitig Formen der Individualisierung und Differenzierung realisiert werden, um so alle Kinder bestmöglich fördern zu können (vgl. Leonhardt/Wember 2003, S. 734).
Diese Aspekte gilt es im Laufe der Examensarbeit näher zu diskutieren, um die Möglichkeiten und Grenzen integrativen Unterrichts genauer zu beleuchten. Ein besonderer Stellenwert muss hierbei auf der Perspektive der Lehrer liegen. Es soll kritisch hinterfragt werden, wie sie integrativen Unterricht konkret umsetzen können, ohne dabei an die Grenzen der Realisierbarkeit oder ihrer eigenen Belastbarkeit zu stoßen. Inwieweit gelingt es, die abstrakten Konzepte im Berufsalltag zu verwirklichen, und welche Schwierigkeiten treten bei der Umsetzung der programmatischen Forderungen in der Praxis auf? Ziel ist es, darzustellen, wie die Unterrichtsgestaltung laut der theoretischen Konzeptionen sein sollte und wie sie im alltäglichen Unterrichtsgeschehen tatsächlich ist.
Der erste Teil meiner Arbeit - der Theorieteil - umreißt dementsprechend die Literatursituation zu diesen Fragen, während sich der zweite Teil - der empirische Teil - im Rahmen einer eigenen Befragung mit konkreten Alltagserfahrungen und –beispielen integrativ arbeitender Lehrer auseinandersetzt. Schließlich sind sie es, die im tagtäglichen Unterrichtsgeschehen mit einer äußerst heterogenen Schülerschaft konfrontiert sind und darauf reagieren müssen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- ERWARTUNGEN AN DEN INTEGRATIVEN UNTERRICHT
- FORMEN SCHULISCHER INTEGRATION
- Integrationsklassen
- Regelklassen mit sonderpädagogischer Unterstützung
- Kooperationsklassen
- DIDAKTISCHE KONZEPTE
- Feuser: Kooperation am gemeinsamen Gegenstand
- Wocken: Theorie der gemeinsamen Lernsituationen
- Unterrichtspraktische Relevanz der Konzepte von Feuser und Wocken
- MERKMALE INTEGRATIVER GRUNDSCHULDIDAKTIK
- Individualisierung des Unterrichts
- Das Spannungsfeld zwischen Gleichheit und Differenz
- Gefahr der Vereinzelung
- Differenzierung
- Innere und äußere Differenzierung
- Umsetzung im Unterricht
- Pädagogische Diagnostik
- Mögliche Problembereichen
- Erforderliche Kompetenzen
- Förderplanung und sukzessive Lernbegleitung
- OFFENER UNTERRICHT ALS UMSETZUNGSMÖGLICHKEIT
- Merkmale des offenen Unterrichts
- Die Metaanalyse von Jürgens (2004)
- Spezielle Konsequenzen für das Lehrerhandeln
- Formen Offenen Unterrichts
- Wochenplanarbeit
- Projektarbeit
- Lehrerbefragungen zur Umsetzung offenen Unterrichts
- EMPIRISCHE BEFUNDE AUS DER FACHLITERATUR
- Persönliche Ebene
- Schulstrukturelle Ebene
- Schweregrad der Behinderung
- Didaktische Ebene
- EIGENE EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG
- Methode der Interviewdurchführung und Auswertung
- Diskussion
- Aussagen zur Zufriedenheit mit dem integrativen Unterricht
- Aussagen zu Merkmalen integrativer Grundschuldidaktik
- Individualisierung und Differenzierung (vgl. Kap. 5.1 und 5.2)
- Zur Notwendigkeit äußerer Differenzierung (vgl. Kap. 5.2.1)
- Das Spannungsfeld zwischen Gleichheit und Differenz und die Gefahr der Vereinzelung (vgl. Kap. 5.1.1 bzw. Kap. 5.1.2)
- Kritik: Fehlende behindertenspezifische Förderung
- Diagnostik und Förderplanung (vgl. Kap. 5.3 und Kap. 5.4)
- Aussagen zum offenen Unterricht als Umsetzungsmöglichkeit
- Unterrichtspraktische Umsetzung (vgl. Kap. 6.3)
- Wochenplan- und Projektarbeit (vgl. Kap. 6.2)
- Anforderungen an das Lehrerhandeln (vgl. Kap. 4/ 5/ 6)
- Schwierigkeiten (vgl. Kap. 6.2)
- Aussagen zu den Rahmenbedingungen
- Klassenzusammensetzung
- Schülerzahlen
- Art der Behinderung
- Personelle Besetzung
- Räumliche und sächliche Ausstattung
- SCHLUSS
- LITERATUR
- ANHANG
- Die Erwartungen an den integrativen Unterricht
- Die verschiedenen Formen schulischer Integration
- Die didaktischen Konzepte von Feuser und Wocken
- Die Merkmale integrativer Grundschuldidaktik
- Der offene Unterricht als Umsetzungsmöglichkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese schriftliche Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen mit dem Studienschwerpunkt Grundschule befasst sich mit der Frage, welche Möglichkeiten und Grenzen der integrative Unterricht bietet, insbesondere aus der Perspektive der Lehrkraft. Die Arbeit fokussiert auf die didaktische Umsetzung integrativen Unterrichts und untersucht, wie die programmatischen Forderungen in der Praxis konkret umgesetzt werden können.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet die Erwartungen an den integrativen Unterricht und die Ziele, die mit der gemeinsamen Unterrichtung behinderter und nichtbehinderter Schüler verbunden sind. Es wird betont, dass soziales Lernen, die Förderung von Empathie und Toleranz sowie die bestmögliche Lern- und Leistungsentwicklung aller Schüler zentrale Ziele des integrativen Unterrichts sind.
Kapitel 3 stellt verschiedene Formen schulischer Integration vor, wie Integrationsklassen, Regelklassen mit sonderpädagogischer Unterstützung und Kooperationsklassen. Die verschiedenen Modelle werden hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile sowie ihrer Umsetzung in der Praxis diskutiert.
Kapitel 4 widmet sich den didaktischen Konzepten von Feuser und Wocken, die als wichtige Beiträge zur Gestaltung integrativen Unterrichts gelten. Feusers Konzept der „Kooperation am gemeinsamen Gegenstand" und Wockens „Theorie der gemeinsamen Lernsituationen" werden vorgestellt und hinsichtlich ihrer unterrichtspraktischen Relevanz analysiert. Es werden Grenzen und Schwierigkeiten aufgezeigt, die sich bei der Umsetzung der Konzepte in der Praxis ergeben können.
Kapitel 5 beleuchtet die Merkmale integrativer Grundschuldidaktik, insbesondere die Bedeutung von Individualisierung und Differenzierung. Die verschiedenen Formen der Differenzierung, die pädagogische Diagnostik und die Förderplanung werden im Hinblick auf ihre Möglichkeiten und Grenzen für den integrativen Unterricht diskutiert. Es werden die Anforderungen an das Lehrerhandeln sowie die notwendigen Kompetenzen für die Gestaltung eines differenzierten Unterrichts hervorgehoben.
Kapitel 6 stellt den offenen Unterricht als eine wichtige Umsetzungsmöglichkeit für die Prinzipien der Individualisierung und Differenzierung vor. Die Merkmale des offenen Unterrichts sowie die spezifischen Anforderungen an das Lehrerhandeln werden erläutert. Zwei Formen des offenen Unterrichts - die Wochenplanarbeit und die Projektarbeit - werden exemplarisch vorgestellt und hinsichtlich ihrer Möglichkeiten und Grenzen für den integrativen Unterricht analysiert. Es werden Ergebnisse aus Lehrerbefragungen zur tatsächlichen Umsetzung offener Unterrichtsformen im integrativen Unterricht präsentiert.
Kapitel 7 fasst empirische Befunde aus der Fachliteratur zusammen, die sich mit den Schwierigkeiten und Grenzen des integrativen Unterrichts auseinandersetzen. Die Ergebnisse zeigen, dass Lehrer häufig mit dem erhöhten Arbeitsaufwand, der mangelnden Qualifikation, den ungünstigen schulstrukturellen Rahmenbedingungen, dem Schweregrad der Behinderung und den didaktisch-methodischen Herausforderungen konfrontiert sind.
Kapitel 8 präsentiert die Ergebnisse einer eigenen empirischen Untersuchung, die im Rahmen von Lehrerinterviews durchgeführt wurde. Die Befragten schildern ihre Erfahrungen mit dem integrativen Unterricht und geben Einblicke in ihre Unterrichtspraxis. Die Ergebnisse zeigen, dass die Lehrerinnen zwar sehr zufrieden mit dem integrativen Unterricht sind, jedoch auch zahlreiche Schwierigkeiten und Grenzen erkennen. Es werden die Anforderungen an das Lehrerhandeln, die notwendigen Kompetenzen sowie die Bedeutung von Rahmenbedingungen für das Gelingen des integrativen Unterrichts diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den integrativen Unterricht, die Lehrerperspektive, die Möglichkeiten und Grenzen des integrativen Unterrichts, die Individualisierung und Differenzierung, die pädagogische Diagnostik, die Förderplanung, den offenen Unterricht, die Wochenplanarbeit, die Projektarbeit, die Klassenzusammensetzung, die personelle Besetzung, die räumliche und sächliche Ausstattung sowie die Herausforderungen und Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem integrativen Unterricht.
- Citation du texte
- Laura Wimmer (Auteur), 2008, Möglichkeiten und Grenzen eines integrativen Unterrichts unter besonderer Berücksichtigung der Lehrerperspektive, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112069