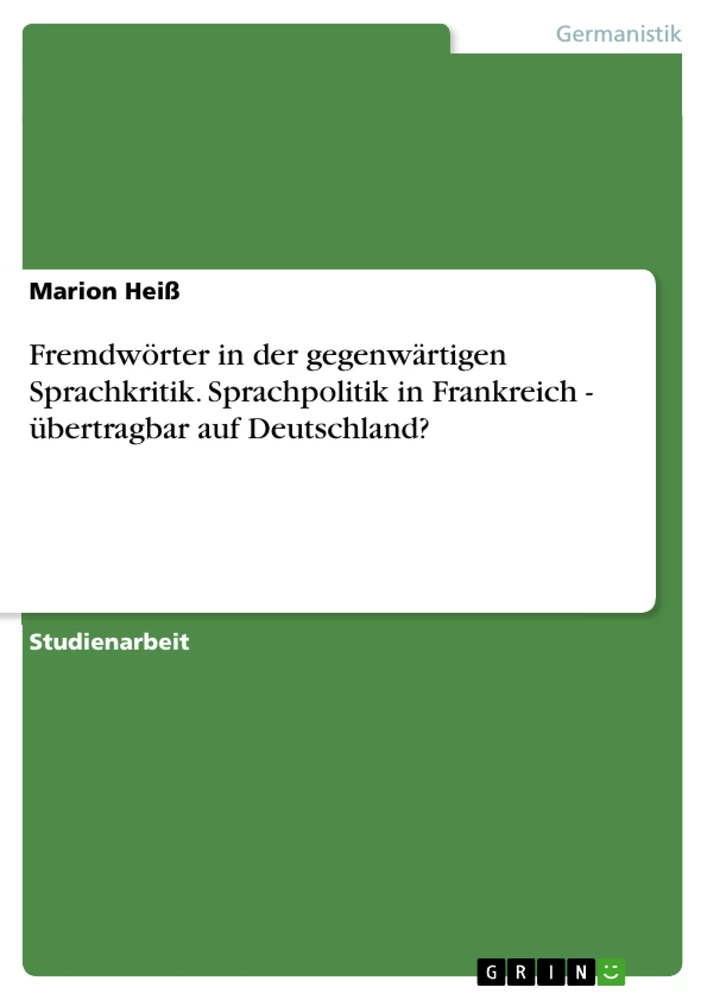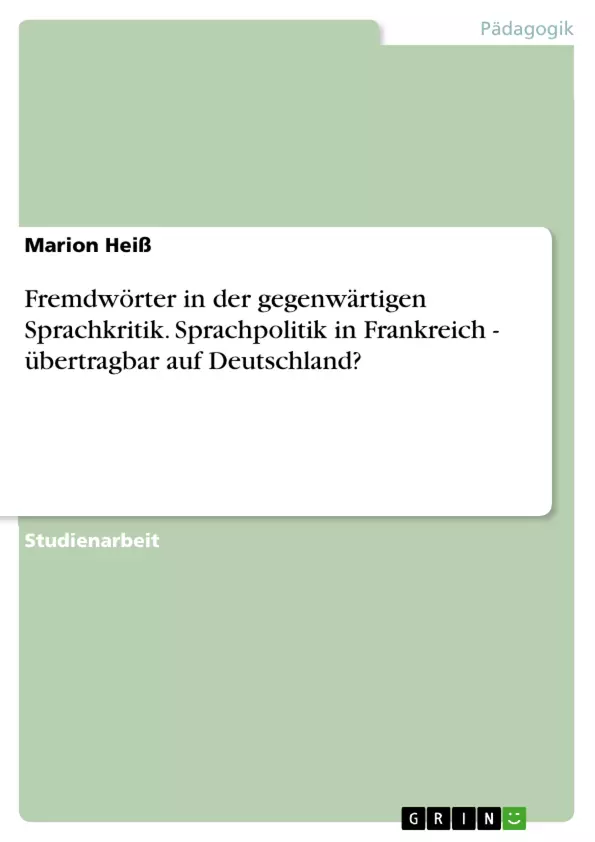Als 1994 in Frankreich das zweite Sprachgesetz durchgesetzt wurde, äußerte sich die deutsche Presse durchgehend herablassend über den lächerlichen Sprachchauvinismus der Franzosen. Es wurde stolz die deutsche Weltbürgerlichkeit betont und der sprachlichen Entwicklung freien Lauf gelassen. Doch in der jetzigen Phase, in welcher der Einfluss des Englischen auf alle europäischen Sprachen immer stärker wird, finden sich zunehmend Gegenbewegungen, die dem starken Druck der Anglizismen entgegentreten wollen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen die Deutschen Anglizismen bereitwillig auf, da aufgrund der Vorkommnisse jede Form von Fremdwortbekämpfung unmöglich war. Bis heute kann man sagen, dass die deutsche Sprachgemeinschaft sich immer noch im „Modernisierungsfieber“ befindet, stets mit Blick auf das amerikanische Idol. Doch einzelne Pioniere im Bereich der Sprachpflege, wie der „Verein deutsche Sprache“ (VDS) nehmen sich nun trotz früherer Kritik ein Vorbild an den Franzosen, die ihre Sprache als kulturelles Erbe hart gegen den Einbruch des Englischen verteidigen. Doch die Hoffnung, die Errungenschaften der französischen Sprachpolitik auch für das Deutsche erreichen zu können, müssen wohl enttäuscht werden. Man kann die französischen Entwicklungen nicht wie eine Folie auf Deutschland legen und glauben, den Kampf gegen das Englische, wenn dieser überhaupt nötig ist, im letzten Moment zu gewinnen. Die Fremdwortdiskussion hängt auf das Engste mit gesellschaftlichen Entwicklungen zusammen, wobei zwischen Deutschland und Frankreich gravierende Unterschiede bestehen.
Inhaltsverzeichnis
- Französische Sprachpolitik — ein Modell für Deutschland?
- Anfänge und Hintergründe der französischen Sprachpolitik
- Die Académie française
- Die „Crise du français"
- Die französische Sprachpolitik der Gegenwart
- Definition „Sprachpolitik"
- Ziele, Maßnahmen und offizielle Begründungen der französischen Sprachpolitik
- Sprachgesetze
- Loi Bas-Lauriol
- Loi Toubon
- Rechtssprechung der Sprachgesetze
- Sprachpolitisch aktive Institutionen
- Ersatzwörter für Anglizismen
- Spontane Ersatzwörter (bilingual)
- äußeres Lehngut
- inneres Lehngut
- Künstliche Ersatzwörter (monolingual)
- äußere Anpassung
- Néologie de forme
- Néologie de sens
- Rezeption der französischen Sprachpolitik
- Fazit / Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Entwicklung und Geschichte der französischen Sprachpolitik
- Die „Crise du français" und die Rolle des Englischen
- Ziele und Strategien der französischen Sprachpolitik
- Sprachgesetze und ihre Auswirkungen
- Die Rolle von Institutionen und Sprachpflegeorganisationen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der französischen Sprachpolitik und ihrer Relevanz für Deutschland. Sie analysiert die Anfänge und Hintergründe der französischen Sprachpolitik, beleuchtet die aktuelle Situation und diskutiert die Effektivität der Maßnahmen. Dabei werden die Ziele, Maßnahmen und offiziellen Begründungen der französischen Sprachpolitik untersucht, sowie die verschiedenen Institutionen und Akteure in diesem Bereich.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Anfänge und Hintergründe der französischen Sprachpolitik, beginnend mit der Gründung der Académie française im 17. Jahrhundert. Die Bedeutung des „bon usage" und die Entwicklung des Sprachbewusstseins in Frankreich werden dargestellt. Das Kapitel analysiert auch die Ursachen der „Crise du français", die durch den zunehmenden Einfluss des Englischen im 20. Jahrhundert entstand.
Kapitel II beschäftigt sich mit der französischen Sprachpolitik der Gegenwart. Es werden die Ziele, Maßnahmen und offiziellen Begründungen der Sprachpolitik definiert und analysiert. Die beiden Sprachgesetze von 1975 und 1994 werden detailliert dargestellt, sowie die Rolle von Institutionen und Sprachpflegeorganisationen.
Kapitel III behandelt die Frage, wie Anglizismen im Französischen ersetzt werden. Es werden die verschiedenen Arten von Ersatzwörtern, sowohl spontane als auch künstliche, untersucht und die Mechanismen der sprachlichen Entlehnung und Anpassung analysiert.
Kapitel IV beleuchtet die Rezeption der französischen Sprachpolitik in der französischen Gesellschaft. Es werden Umfrageergebnisse dargestellt und die Effektivität der Sprachpolitik diskutiert. Die Arbeit zeigt, dass die französische Sprachpolitik auf Schwierigkeiten stößt und die breite Öffentlichkeit oft skeptisch gegenüber den Maßnahmen ist.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die französische Sprachpolitik, die „Crise du français", den Einfluss des Englischen, Sprachpflege, Sprachplanung, Anglizismen, Ersatzwörter, Sprachgesetze, Institutionen, Sprachpflegeorganisationen, Sprachbewusstsein und Kulturpolitik.
- Arbeit zitieren
- Marion Heiß (Autor:in), 2004, Fremdwörter in der gegenwärtigen Sprachkritik. Sprachpolitik in Frankreich - übertragbar auf Deutschland?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112080