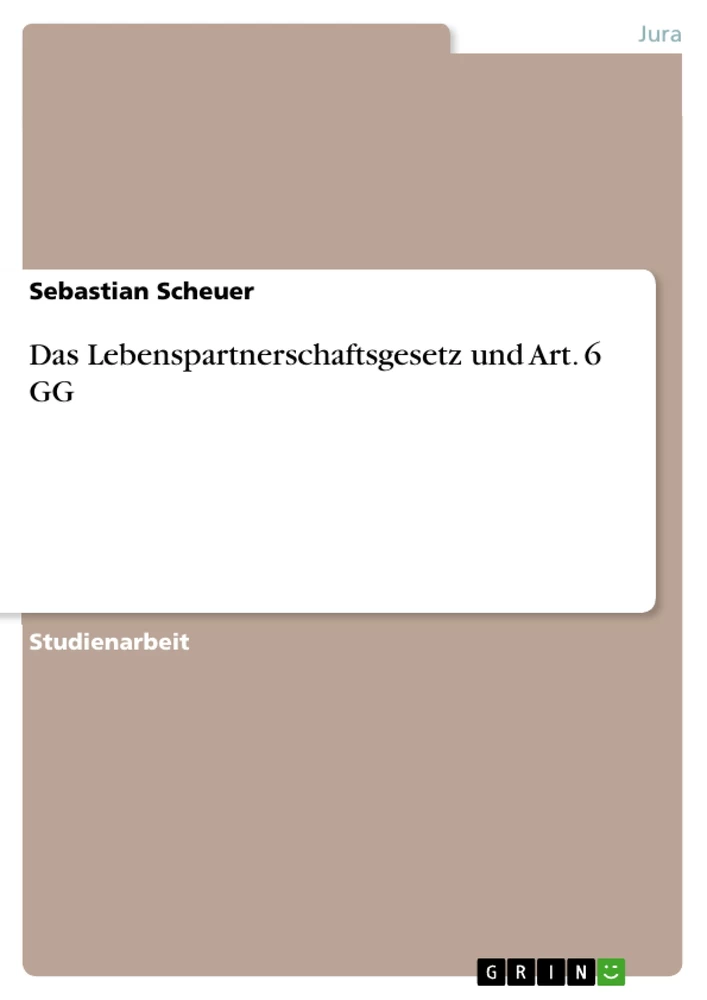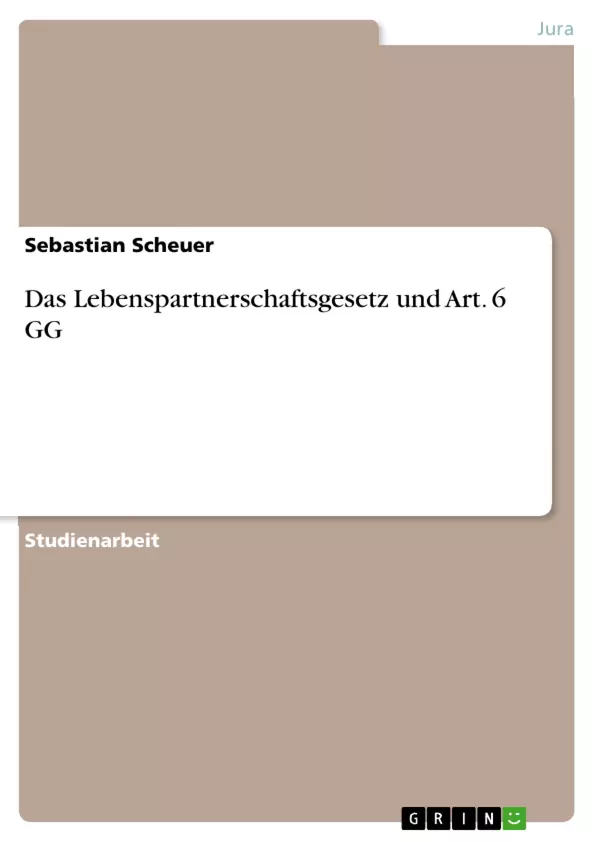Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, nach Betrachtung zurückliegender Entwicklungen streitige Fragen im Spannungsfeld zwischen dem am 01.08.2001 in Kraft getretenen Lebenspartnerschaftsgesetz und der Regelung des Art. 6 GG, dort genauer des „besonderen Schutzes der Ehe und Familie“, zu untersuchen. Vor allem das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17.07. 2002 soll in diesem Zusammenhang einer kritischen Analyse unterzogen werden. Zunächst soll in einem ersten Abschnitt auf die Entwicklung des rechtlichen Umgangs mit Homosexualität und den sich daraus im Laufe der Zeit ergebenen gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften eingegangen werden. Dieser Blick wird bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zurückreichen und sich bis zu den letzten bis jetzt unternommenen Schritten mit dem Ziel der Gleichstellung gleichgeschlechtlicher mit verschiedengeschlechtlicher Lebensgemeinschaften erstrecken.
In einem dann folgenden zweiten Teil wird es darum gehen, das Verständnis und die Auslegung von Art. 6 I GG, auch gegenüber einem möglichen Eingriff durch das LPartG, durch Literatur und Verfassungsrechtsprechung bis zum aktuellen Urteil zu betrachten.
Daran anknüpfend widmet sich ein dritter Abschnitt dem im Zentrum dieser Arbeit stehenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17.07.2002. Hier wird eine kritische Betrachtung insbesondere der Argumentation über die Verletzung von Art. 6 I GG durch das LPartG stattfinden. So werden auf der einen Seite die Argumentationslinien des erkennenden Senats und auf der anderen Seite die Positionen der Antragsteller der Normenkontrollanträge nachzuzeichnen sein. Die gleichfalls sehr interessante Frage der formellen Verfassungsmäßigkeit des LPartG im Hinblick auf die Aufspaltung der Gesetzesmaterie wird nur relativ knapp betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- A. Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- I. Ziel der Arbeit
- II. Gang der Arbeit
- B. Entwicklung des rechtlichen Umgangs mit Homosexualität und gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften
- I. Pönalisierung von Homosexualität
- II. Ende der Pönalisierung von Homosexualität
- III. Von der Entpönalisierung der Homosexualität zur rechtlichen Organisation gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften
- 1. Anstoß durch die Europäische Union
- 2. Entwicklung in Deutschland zur Schaffung eines Gesetzes zur Regelung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften
- IV. Häufigkeit und „Qualität“ von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften
- 1. Häufigkeit gleichgeschlechtlicher Partnerschaften
- 2. „Qualität“ von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften
- C. Verständnis und Auslegung von Art. 6 I GG durch Literatur und Verfassungsrechtsprechung im Hinblick auf gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften und das LPartG
- I. Mehrdimensionalität des Art. 6 I GG
- 1. Institutsgarantie in Art. 6 I GG
- 2. Abwehr-/Freiheitsrecht in Art. 6 I GG
- 3. Wertentscheidende Grundsatznorm in Art. 6 I GG
- II. Unterschiedliche Auffassungen zum Eingriff in die Dimensionen des Art. 6 I GG durch das LPartG in der Literatur
- 1. Kein Eingriff durch das LPartG in Art. 6I GG
- a) in die Dimension „Institutsgarantie“
- b) in die Dimension „Abwehr-/Freiheitsrecht“
- c) in die Dimension „wertentscheidende Grundsatznorm“
- 2. Eingriff durch das LPartG in Art. 6 IGG
- a) in die Dimension „Institutsgarantie“
- b) in die Dimension „wertentscheidende Grundsatznorm“
- III. Gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften in der Judikatur des Bundesverfassungsgerichts bis zum 17.07.2002
- D. Das Urteil des Bundesverfassungsgericht vom 17.07.2002
- I. Die zum Urteil führende Entwicklung
- II. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17.07.2002 im Einzelnen
- 1. Formelle Verfassungswidrigkeit/-mäßigkeit des LPartDisBG
- a) Die Position der Antragsteller
- b) Die Position des Bundesverfassungsgerichts
- 2. Materielle Verfassungswidrigkeit/-mäßigkeit des LPartDisBG im Hinblick auf Art. 6 I GG
- a) Die Position der Antragsteller
- b) Die Position des Bundesverfassungsgerichts
- aa) Eheschließungsfreiheit
- bb) Institutsgarantie
- cc) Wertentscheidende Grundsatznorm
- c) Die Minderheitsvoten des Richters Papier und der Richterin Haas
- d) Bewertung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 17.07.2002
- E. Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts und verbleibende offene Fragen
- I. Auswirkungen
- II. Verbleibende offene Fragen
- F. Schlussbemerkung: Ergebnisse der Arbeit und Schlussthese
- I. Öffnung des Eheverständnisses
- II. Keine Analyse im Einzelnen
- III. Schlussthese
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Vereinbarkeit des Lebenspartnerschaftsgesetzes mit Artikel 6 des Grundgesetzes. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des rechtlichen Umgangs mit Homosexualität und gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften in Deutschland und Europa, untersucht verschiedene juristische Interpretationen von Art. 6 GG und bewertet das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Lebenspartnerschaftsgesetz.
- Entwicklung des Rechts in Bezug auf Homosexualität und gleichgeschlechtliche Partnerschaften
- Auslegung von Art. 6 I GG im Kontext gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften
- Analyse des Lebenspartnerschaftsgesetzes und seiner verfassungsrechtlichen Aspekte
- Bewertung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts
- Offene Fragen und zukünftige Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
A. Zielsetzung und Aufbau der Arbeit: Diese Einleitung beschreibt das Ziel der Arbeit – die Prüfung der Vereinbarkeit des Lebenspartnerschaftsgesetzes mit Artikel 6 GG – und skizziert den methodischen Aufbau der Untersuchung. Sie legt die Struktur der Arbeit dar und dient als Wegweiser durch die folgenden Kapitel.
B. Entwicklung des rechtlichen Umgangs mit Homosexualität und gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften: Dieses Kapitel zeichnet die historische Entwicklung der rechtlichen Behandlung von Homosexualität in Deutschland nach, von der Pönalisierung bis hin zu den Bemühungen um die rechtliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Es beleuchtet den Einfluss der Europäischen Union auf diesen Prozess und die verschiedenen Schritte, die zur Einführung des Lebenspartnerschaftsgesetzes geführt haben. Der Abschnitt über die „Qualität“ der Partnerschaften deutet vermutlich auf soziologische Aspekte und deren Relevanz für die juristische Bewertung hin.
C. Verständnis und Auslegung von Art. 6 I GG durch Literatur und Verfassungsrechtsprechung im Hinblick auf gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften und das LPartG: Dieses zentrale Kapitel analysiert die verschiedenen Interpretationen von Artikel 6 GG (Ehe und Familie) in der Rechtsliteratur und Rechtsprechung im Hinblick auf gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften. Es untersucht die Mehrdimensionalität des Artikels und die unterschiedlichen Auffassungen darüber, ob das Lebenspartnerschaftsgesetz in die verschiedenen Dimensionen von Art. 6 I GG eingreift (Institutsgarantie, Abwehr-/Freiheitsrecht, wertentscheidende Grundsatznorm). Es wird ein Überblick über verschiedene juristische Meinungen gegeben, die für oder gegen eine Verletzung von Art. 6 I GG durch das LPartG argumentieren.
D. Das Urteil des Bundesverfassungsgericht vom 17.07.2002: Dieses Kapitel beschreibt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Lebenspartnerschaftsgesetz vom 17. Juli 2002. Es analysiert die Argumentation des Gerichts sowohl im Hinblick auf die formelle als auch die materielle Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes. Es beleuchtet die Positionen der Antragsteller und die Gegenargumente des Gerichts. Die Berücksichtigung der Minderheitsvoten unterstreicht die Komplexität der Entscheidung und die verschiedenen juristischen Perspektiven auf das Thema.
E. Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts und verbleibende offene Fragen: Dieses Kapitel diskutiert die Folgen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts und benennt die noch offenen Fragen, die sich aus der Entscheidung ergeben. Dies könnte zum Beispiel die Frage nach der zukünftigen Entwicklung des Rechts und der weiterhin bestehenden Ungleichheiten zwischen gleichgeschlechtlichen und heterosexuellen Paaren betreffen.
Schlüsselwörter
Lebenspartnerschaftsgesetz, Artikel 6 GG, Homosexualität, gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften, Verfassungsrecht, Bundesverfassungsgericht, Eheschließungsfreiheit, Institutsgarantie, wertentscheidende Grundsatznorm, Rechtsprechung, Rechtsvergleichung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Vereinbarkeit des Lebenspartnerschaftsgesetzes mit Artikel 6 GG
Was ist das Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Vereinbarkeit des deutschen Lebenspartnerschaftsgesetzes (LPartG) mit Artikel 6 des Grundgesetzes (GG), der Ehe und Familie betrifft. Sie analysiert die rechtliche Entwicklung im Umgang mit Homosexualität und gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und bewertet das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum LPartG.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die historische Entwicklung des rechtlichen Umgangs mit Homosexualität in Deutschland und Europa, die verschiedenen juristischen Interpretationen von Art. 6 GG im Kontext gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften, eine detaillierte Analyse des LPartG und seiner verfassungsrechtlichen Aspekte, eine Bewertung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Juli 2002, sowie eine Diskussion der verbleibenden offenen Fragen und zukünftigen Entwicklungen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist strukturiert in mehrere Kapitel: Einleitung (Zielsetzung und Aufbau), die Entwicklung des rechtlichen Umgangs mit Homosexualität, die juristische Auslegung von Art. 6 GG, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, die Auswirkungen des Urteils und verbleibende Fragen, sowie eine Schlussbemerkung mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse und der Schlussthese. Jedes Kapitel ist detailliert untergliedert.
Welche juristischen Fragen werden untersucht?
Die zentralen juristischen Fragen drehen sich um die Auslegung von Art. 6 GG, insbesondere um die Frage, ob das LPartG in die verschiedenen Dimensionen dieses Artikels eingreift (Institutsgarantie, Abwehr-/Freiheitsrecht, wertentscheidende Grundsatznorm). Es wird untersucht, ob das LPartG die Eheschließungsfreiheit einschränkt und ob es mit dem verfassungsrechtlich geschützten Verständnis von Ehe und Familie vereinbar ist.
Welche Rolle spielt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Juli 2002?
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Juli 2002 bildet einen zentralen Bestandteil der Arbeit. Die Argumentation des Gerichts, sowohl in Bezug auf die formelle als auch die materielle Verfassungsmäßigkeit des LPartG, wird detailliert analysiert. Auch die Minderheitsvoten werden berücksichtigt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts eine Öffnung des Eheverständnisses darstellt, jedoch analysiert die Arbeit nicht im Einzelnen, was das im Detail bedeutet. Die Schlussthese fasst die wesentlichen Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Rechts in Bezug auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lebenspartnerschaftsgesetz, Artikel 6 GG, Homosexualität, gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften, Verfassungsrecht, Bundesverfassungsgericht, Eheschließungsfreiheit, Institutsgarantie, wertentscheidende Grundsatznorm, Rechtsprechung, Rechtsvergleichung.
- Citar trabajo
- Sebastian Scheuer (Autor), 2002, Das Lebenspartnerschaftsgesetz und Art. 6 GG, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112130