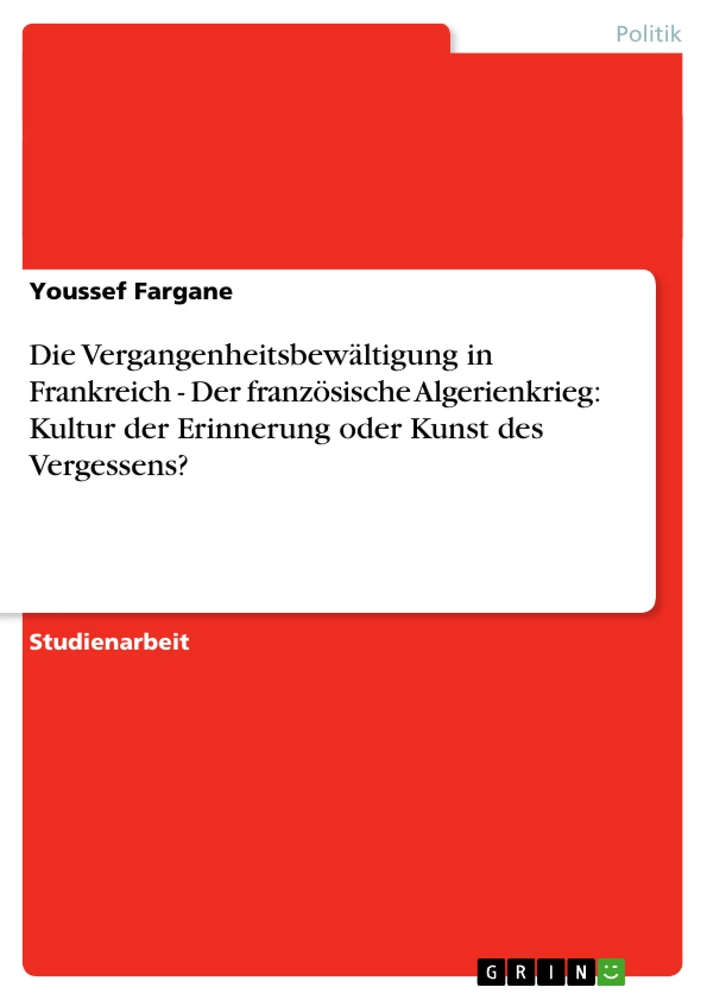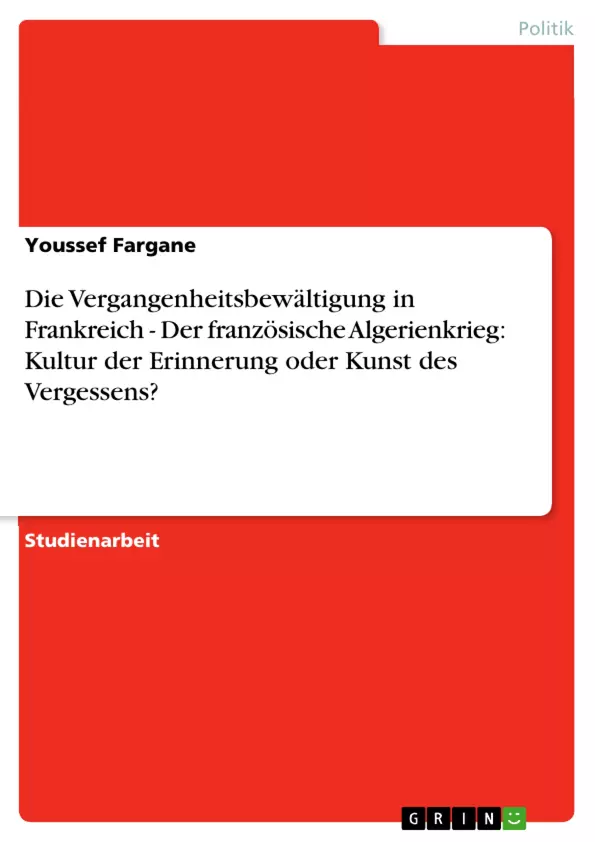Am 8. Mai 1945, am Tag der Befreiung Europas und des Waffenstillstands nach dem brutalen
zweiten Weltkrieg, schossen französische Truppen auf der anderen Seite des Mittelmeers im
algerischen Constantine auf Demonstranten, die für die Autonomie ihres Landes innerhalb des
französischen Staatsverbandes eintraten. Dem brutalen Vorgehen der französischen Armee
fielen Hunderte, wenn nicht Tausende von Algeriern zum Opfer. Der Versuch der
Kolonialmacht Frankreich, die Unabhängigkeitsbewegung vom Anfang an im Keim zu
ersticken, ist damit entgültig gescheitert.
Was danach folgte, war eine brutale militärische Auseinandersetzung zwischen der Front de
Libération National (FLN) und der französischen Armee, die erst 40 Jahre nach dem Ende des
Konfliktes offiziell von der französischen Regierung als Krieg bezeichnet werden konnte. In
diesem von der FLN und der ALN ( Armée de Libération National) geführten
Unabhängigkeitskrieg kamen mehr als 1 Millionen Algerier und 24.000 Franzosen ums
Leben.
Bei den “Maßnahmen zur Wiederherstellung der Ordnung „- wie man offiziell 38 Jahre lang
diesen schmutzigen Krieg bezeichnete- mobilisierte Frankreich seine ganzen militärischen
Kräfte und im Dienste der La Grande Nation waren 2 Millionen französische Soldaten in
Algerien stationiert. Mit allen zur Verfügung stehenden Gewaltmitteln sollte verhindert
werden, dass 132 Jahre koloniale Herrschaft in Algerien beendet wird.
Folter, Vergewaltigungen, willkürliche Ermordung von FLN-Militanten und
Massenhinrichtungen gehörten zur tagtäglichen Praxis der französischen Armee während des
offiziell von 1954 bis 1962 dauernden Algerienkriegs1.
Die Enthüllungen von in Algerien begangenen Massakern sorgten vor einem Jahr für eine
heftige Debatte über die Verstrickung Frankreichs in Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Anders kann man die Geständnisse und die Kriegserinnerungen von ehemaligen
französischen Generälen in Algerien, die zugaben, im Dienste der französischen
Kolonialmacht verdächtige FLN-Militanten gefoltert und anschließend exekutiert zu haben,
nicht bewerten.
Diese an die französische Öffentlichkeit gelangten Informationen über die unmenschlichen
Methoden der französischen Armee waren den Politikern des Landes von rechts bis links
schon längst bekannt. [...]
1 Thankmar von Münchhausen: Kolonialismus und Demokratie, die Französische Algerienpolitik von 1945-
1962, München 1977. S, 221-229.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Die Verdrängten Bilder des Algerienkriegs und die blutige Logik des Kolonialismus
- 2.1 Historischer Überblick
- 2.2 Erinnerungen an vergessene Verbrechen
- 2.3 Algerienkrieg im Spiegel des Geschichtsunterrichts
- 2.3.1 Leugnung und Verschleierung der Wahrheit
- 2.3.2 Ideologische Einflussnahme des Staats
- 2.3.3 Algerienkrieg als Randthema im Geschichtsunterricht
- 3 Algerienkrieg und seine Folgen: Die Vergangenheitsbewältigung à la francaise
- 3.1 Algerienkrieg: Stachel im Fleisch der französischen Politik und Gesellschaft
- 3.2 Hochdekorierte Militärs: Folter und Mord als Pflichterfüllung?
- 3.3 Massaker auf höchstem Befehl?
- 4 Das Massaker vom 17. Oktober 1961: Die Erinnerung als Geheimnis der Republik
- 4.1 Massaker ohne Namen und Erinnerung mit Gesicht
- 4.2 Aufklärung nach 40 Jahren: Gedächtnisschwund oder Exzessive Erinnerung?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Umgang Frankreichs mit seiner Kolonialgeschichte und analysiert die Vergangenheitsbewältigung im Hinblick auf den Algerienkrieg. Im Fokus steht die Frage, ob es sich um eine aktive Aufarbeitung oder eher um eine Vermeidung des Erinnerns an die dunklen Kapitel der „zivilisatorischen Mission Frankreichs“ handelt.
- Die historische Einordnung des Algerienkriegs und die blutige Logik des französischen Kolonialismus.
- Die Rolle der Erinnerung und des Vergessens in der französischen Geschichtspolitik.
- Die Darstellung des Algerienkriegs im französischen Geschichtsunterricht.
- Die Aufarbeitung von Massakern und Kriegsverbrechen.
- Der Vergleich des französischen Umgangs mit der Vergangenheit im Kontext der deutschen Vergangenheitsbewältigung.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Die Einführung beginnt mit dem Massaker von Constantine 1945 als Auftakt zum Algerienkrieg, der erst 40 Jahre später offiziell als solcher anerkannt wurde. Sie beschreibt den brutalen Krieg mit seinen hohen Opferzahlen auf beiden Seiten und betont die Anwendung von Folter, Vergewaltigung und willkürlichen Morden durch die französische Armee. Die Enthüllungen von Massakern führten zu heftigen Debatten, obwohl diese Informationen der Politik schon lange bekannt waren. Im Gegensatz zur deutschen Vergangenheitsbewältigung weigert sich Frankreich, Verantwortung zu übernehmen und sich zu entschuldigen. Die Arbeit will den Umgang Frankreichs mit seiner Kolonialgeschichte untersuchen und feststellen, ob von einer öffentlichen Bewältigung der Vergangenheit die Rede sein kann, oder ob es sich eher um die Vermeidung des Erinnerns handelt.
2 Die Verdrängten Bilder des Algerienkriegs und die blutige Logik des Kolonialismus: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über den Algerienkrieg und beleuchtet die vergessenen Massaker der französischen Kolonialmacht. Es analysiert die Rolle des Geschichtsunterrichts in der Verdrängung und Verschleierung der Wahrheit, untersucht die ideologische Einflussnahme des Staats und zeigt, wie der Algerienkrieg als Randthema behandelt wird. Der Fokus liegt auf der systematischen Verdrängung der grausamen Realität des Krieges durch die französische Regierung und deren Bestreben, das kollektive Vergessen zu organisieren. Die 'blutige Logik des Kolonialismus' wird als zentraler Aspekt des Kapitels hervorgehoben, mit Bezug auf das Denken von Alexis de Tocqueville.
3 Algerienkrieg und seine Folgen: Die Vergangenheitsbewältigung à la francaise: Dieses Kapitel untersucht den Algerienkrieg als andauernden "Stachel im Fleisch" der französischen Politik und Gesellschaft. Es beleuchtet die Rolle hochdekorierter Militärs, die Folter und Mord als Pflichterfüllung betrieben, und analysiert Massaker, die auf höchstem Befehl begangen wurden. Die Zusammenfassung deckt auf, wie Frankreich versucht, die Erinnerung an den Krieg zu steuern und zu kontrollieren, und untersucht die anhaltenden Folgen dieses Konflikts auf die französische Identität und Politik. Der Fokus liegt auf der systematischen Verdrängung der grausamen Realität und der Versuche der Regierung, das kollektive Vergessen zu fördern.
4 Das Massaker vom 17. Oktober 1961: Die Erinnerung als Geheimnis der Republik: Dieses Kapitel konzentriert sich auf das Massaker vom 17. Oktober 1961 als ein besonders gravierendes Beispiel für die Verbrechen der französischen Kolonialmacht. Es analysiert die lange Verdrängung dieses Ereignisses und den Prozess der schrittweisen Aufklärung nach 40 Jahren. Die Zusammenfassung beleuchtet den Gegensatz zwischen dem Verschweigen des Massakers und den Bemühungen der Opfer, ihre Erinnerung zu bewahren und Gerechtigkeit zu erlangen. Es untersucht die Frage, ob der späte Umgang mit dem Massaker auf Gedächtnisschwund oder exzessive Erinnerung zurückzuführen ist, und welche Rolle die staatliche Politik dabei spielt.
Schlüsselwörter
Algerienkrieg, Frankreich, Kolonialismus, Vergangenheitsbewältigung, Erinnerungskultur, Geschichtspolitik, Massaker, Folter, Kriegsverbrechen, kollektives Vergessen, Staatsraison, ideologische Einflussnahme, Geschichtsunterricht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Der Umgang Frankreichs mit dem Algerienkrieg
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text untersucht den Umgang Frankreichs mit seiner Kolonialgeschichte und insbesondere mit dem Algerienkrieg. Im Fokus steht die Analyse der französischen Vergangenheitsbewältigung – handelt es sich um eine aktive Aufarbeitung oder eher um eine Vermeidung des Erinnerns an die dunklen Kapitel der französischen Kolonialzeit?
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt verschiedene Aspekte des Algerienkriegs und der darauf folgenden französischen Geschichtspolitik. Dazu gehören die historische Einordnung des Krieges, die Rolle der Erinnerung und des Vergessens, die Darstellung des Krieges im französischen Geschichtsunterricht, die Aufarbeitung von Massakern und Kriegsverbrechen sowie ein Vergleich mit der deutschen Vergangenheitsbewältigung. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Massaker vom 17. Oktober 1961 gewidmet.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es jeweils?
Der Text gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 bietet eine Einführung mit einem Überblick über den Algerienkrieg und den Umgang Frankreichs mit seiner Vergangenheit. Kapitel 2 analysiert die Verdrängung des Algerienkriegs und die "blutige Logik des Kolonialismus", einschließlich der Rolle des Geschichtsunterrichts. Kapitel 3 untersucht den Algerienkrieg als anhaltenden Konflikt und beleuchtet die Rolle hochrangiger Militärs und staatlich angeordneter Massaker. Kapitel 4 konzentriert sich auf das Massaker vom 17. Oktober 1961 als Beispiel für die Verbrechen der französischen Kolonialmacht und die lange Verdrängung dieses Ereignisses.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text zielt darauf ab, den Umgang Frankreichs mit seiner Kolonialgeschichte kritisch zu analysieren und zu untersuchen, inwieweit eine öffentliche und umfassende Bewältigung der Vergangenheit stattgefunden hat oder ob Vermeidung und Verdrängung im Vordergrund stehen. Der Vergleich mit der deutschen Vergangenheitsbewältigung dient als Referenzpunkt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Textinhalt?
Schlüsselwörter sind: Algerienkrieg, Frankreich, Kolonialismus, Vergangenheitsbewältigung, Erinnerungskultur, Geschichtspolitik, Massaker, Folter, Kriegsverbrechen, kollektives Vergessen, Staatsraison, ideologische Einflussnahme, Geschichtsunterricht.
Wie wird der Algerienkrieg im französischen Geschichtsunterricht dargestellt?
Der Text deutet darauf hin, dass der Algerienkrieg im französischen Geschichtsunterricht lange Zeit ein Randthema war, gekennzeichnet von Verdrängung und Verschleierung der Wahrheit. Die ideologische Einflussnahme des Staates spielte dabei eine bedeutende Rolle.
Welche Rolle spielt das Massaker vom 17. Oktober 1961?
Das Massaker vom 17. Oktober 1961 dient als Fallbeispiel für die Verbrechen der französischen Kolonialmacht und die lange Verdrängung dieser Ereignisse. Der Text untersucht den späten Prozess der Aufklärung und den Gegensatz zwischen dem staatlichen Verschweigen und den Bemühungen der Opfer, ihre Erinnerung zu bewahren.
Wie wird die "blutige Logik des Kolonialismus" im Text behandelt?
Die "blutige Logik des Kolonialismus" wird als zentraler Aspekt des französischen Kolonialismus dargestellt und analysiert, mit Bezug auf die Anwendung von Folter, Vergewaltigung und willkürlichen Morden durch die französische Armee während des Algerienkriegs.
Wie lässt sich der französische Umgang mit dem Algerienkrieg im Vergleich zur deutschen Vergangenheitsbewältigung einordnen?
Der Text impliziert einen kritischen Vergleich mit der deutschen Vergangenheitsbewältigung, wobei Frankreich im Gegensatz zu Deutschland eine deutlich geringere Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung und zur Entschuldigung zeigt.
- Quote paper
- MA Youssef Fargane (Author), 2002, Die Vergangenheitsbewältigung in Frankreich - Der französische Algerienkrieg: Kultur der Erinnerung oder Kunst des Vergessens?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11215