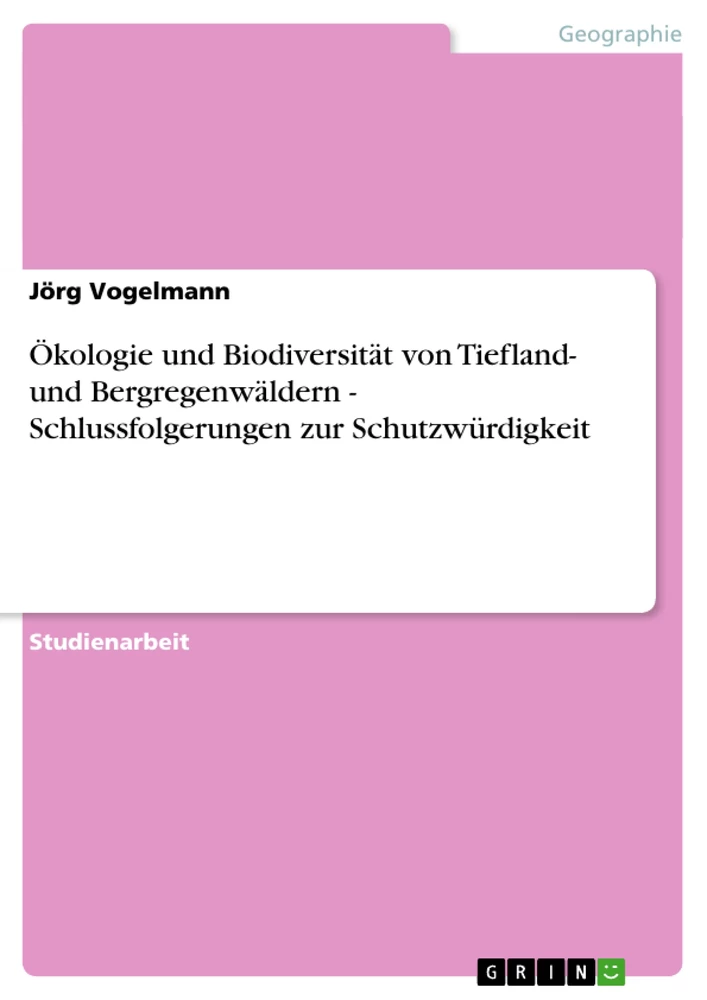“Unter den verschiedenen tropischen Regenwaldformationen finden wir die strukturell komplexesten und reichhaltigsten Landökosysteme, die die Erde je trug” (Whitmore 1993: 21). Dennoch gehört dieser Lebensraum zu den Waldflächen der Erde, die am stärksten der anthropogene Zerstörung zum Opfer fallen.
Die Abholzung und Degradierung tropischer Regenwälder wird sich in den nächsten Jahrzehnten kaum abschwächen. Folglich ist die Menschheit zunehmend aufgefordert, Maßstäbe und Kriterien zu entwickeln, die bei der Entscheidung helfen, welche Regenwaldformationen schon aus eigenem Interesse der Menschheit heraus unbedingt für die Zukunft erhalten werden müssen und welche man auf Grund der vielfältigen (kurzfristigen) Nutzungsansprüche der stetig anwachsenden Bevölkerungen vielleicht eher der Veränderung preisgibt. Die in den Geo- und Biowissenschaften noch umstrittene Frage, ob tropische Bergregenwälder oder tropische Tieflandregenwälder schutzwürdiger sind, steht somit im Zentrum dieser Arbeit – eine Frage, die angesichts des immensen jährlichen Verlustes an tropischen Wäldern immer dringender zu beantworten ist.
Neben einem Blick auf die Konzepte Tieflandregenwald, Bergregenwald und Schutzwürdigkeit untersucht die Arbeit, ob Biodiversität als Kriterium zur Beurteilung letzterer dienen kann. Im zentralen Teil der Arbeit werden Ökologie und Artenvielfalt der beiden Lebensräume theoretisch und empirisch dargestellt und miteinander verglichen. Anhand der sechs Kategorien physiognomische Merkmale/Biomasseproduktion, Vermeidung von Erosion und Überschwemmungen, Fähigkeit zur CO2-Speicherung, Böden und Nährstoffkreisläufe, Bedrohtheit sowie Artenvielfalt werden Aussagen über die relative Schutzwürdigkeit der behandelten Regenwaldformationen abgeleitet, die im Fazit zu einer Gesamteinschätzung komprimiert werden. Zudem gibt die Arbeit einen Ausblick auf die weitere prognostizierte Entwicklung der Regenwaldzerstörung und darauf, wie die Bewahrung dieser Lebensräume gemäß neuer Ideen im Sinne eines “conservation management” aussehen könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Grundlagen, Begriffsdefinitionen und Untersuchungsgegenstand
- Die Ökologie von Tiefland- und Gebirgsregenwäldern
- Der tropische immergrüne Tieflandregenwald: Darstellung und Ökologie
- Der tropische immergrüne Bergregenwald: Darstellung und Ökologie
- Formations- und Ökologie-Vergleich der beiden Formationen tropischer Bergregenwald und Tieflandregenwald
- Physiognomische Merkmale
- Nährstoffkreisläufe
- Ökologie der Böden im Tiefland- und Bergregenwald
- Biodiversität von Berg- und Tieflandregenwäldern
- Überblick: Was ist Biodiversität? Theoretische Grundlagen.
- Theoretische Deduktionen zur Biodiversität von Berg- und Tieflandregenwäldern
- Empirische Ergebnisse
- Überblick
- Die Artenvielfalt von Berg- und Tieflandregenwäldern: Empirische Ergebnisse und Forschungsdebatte
- Die Schutzwürdigkeit von Berg- und Tieflandregenwäldern
- Wie ist der Begriff Schutzwürdigkeit und Naturschutz in Bezug auf Regenwälder zu verstehen?
- Kann Biodiversität als Kriterium für die Schutzwürdigkeit eines Lebensraumes dienen?
- Ableitungen aus den Erkenntnissen aus Ökologie und Biodiversität: Bewertung der Schutzwürdigkeit von Berg- und Tieflandregenwäldern.
- Physiognomische Merkmale/ Biomasseproduktion
- Vermeidung von Erosion und Überschwemmungen
- Fähigkeit zur C02-Speicherung
- Böden und Nährstoffkreisläufe
- Bedrohtheit
- Biodiversität
- Fazit zur Schutzwürdigkeit
- Ausblick (fakultativ)
- Quellenverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Schutzwürdigkeit von Tiefland- und Gebirgsregenwäldern. Nach der Klärung von Begriffen wie Tieflandregenwald und Bergregenwald werden Ökologie und Biodiversität der beiden Lebensräume theoretisch und empirisch dargestellt und miteinander verglichen. Nach der Einführung in den Begriff Schutzwürdigkeit wird dann untersucht, ob Biodiversität als Kriterium zur Beurteilung dieser dienen kann. Zuletzt sollen sich aus den durchgeführten Analysen zu Berg- und Tieflandregenwald subjektive Aussagen über die Schutzwürdigkeit der behandelten Formationen ableiten lassen und im Fazit zu einer Gesamteinschätzung komprimiert werden.
- Ökologie von Tiefland- und Bergregenwäldern
- Biodiversität von Tiefland- und Bergregenwäldern
- Schutzwürdigkeit von Tiefland- und Bergregenwäldern
- Nährstoffkreisläufe in den beiden Ökosystemen
- Bedrohung durch Abholzung und Nutzung
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel behandelt die Grundlagen, Begriffsdefinitionen und den Untersuchungsgegenstand. Es wird die Abhängigkeit des Pflanzenwuchses von klimatischen Bedingungen erläutert und die Vegetationszonen der Erde mit den Klimazonen in Verbindung gebracht. Der Begriff des tropischen Regenwaldes wird definiert und die verschiedenen Formationen, die innerhalb der Vegetationszone des tropischen Regenwaldes vorkommen, werden vorgestellt.
Im dritten Kapitel wird die Ökologie von Tiefland- und Bergregenwäldern behandelt. Es werden die wichtigsten Merkmale der beiden Formationen, wie Wuchshöhe, Biomasseproduktion, Stockwerksbau und Nährstoffkreisläufe, verglichen. Die Unterschiede in der Physiognomie, der Artenvielfalt und der Ökologie der Böden werden detailliert beschrieben.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Biodiversität von Berg- und Tieflandregenwäldern. Es wird der Begriff der Biodiversität erläutert und verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung der Artenvielfalt in den beiden Ökosystemen vorgestellt. Die empirischen Ergebnisse verschiedener Studien werden präsentiert, die Hinweise auf die Unterschiede in der Artenvielfalt von Berg- und Tieflandregenwäldern liefern.
Das fünfte Kapitel behandelt die Schutzwürdigkeit von Berg- und Tieflandregenwäldern. Es werden verschiedene Kriterien für die Schutzwürdigkeit von Lebensräumen vorgestellt und diskutiert, ob Biodiversität als Kriterium für die Schutzwürdigkeit dienen kann. Anhand der Erkenntnisse aus den Kapiteln über Ökologie und Biodiversität werden die Schutzwürdigkeit von Berg- und Tieflandregenwäldern bewertet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den tropischen Regenwald, Tieflandregenwald, Bergregenwald, Ökologie, Biodiversität, Schutzwürdigkeit, Artenvielfalt, Nährstoffkreisläufe, Bodeneigenschaften, Abholzung, Nutzung, Schutzgebiete, Biosphärenreservate, und die Bedrohung durch den Menschen. Die Arbeit analysiert die ökologischen und biologischen Unterschiede zwischen Tiefland- und Bergregenwäldern und untersucht, welche dieser Formationen aufgrund ihrer Bedeutung für die Biodiversität und die Ökosystemleistungen stärker geschützt werden sollte.
- Citar trabajo
- Jörg Vogelmann (Autor), 2006, Ökologie und Biodiversität von Tiefland- und Bergregenwäldern - Schlussfolgerungen zur Schutzwürdigkeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112162