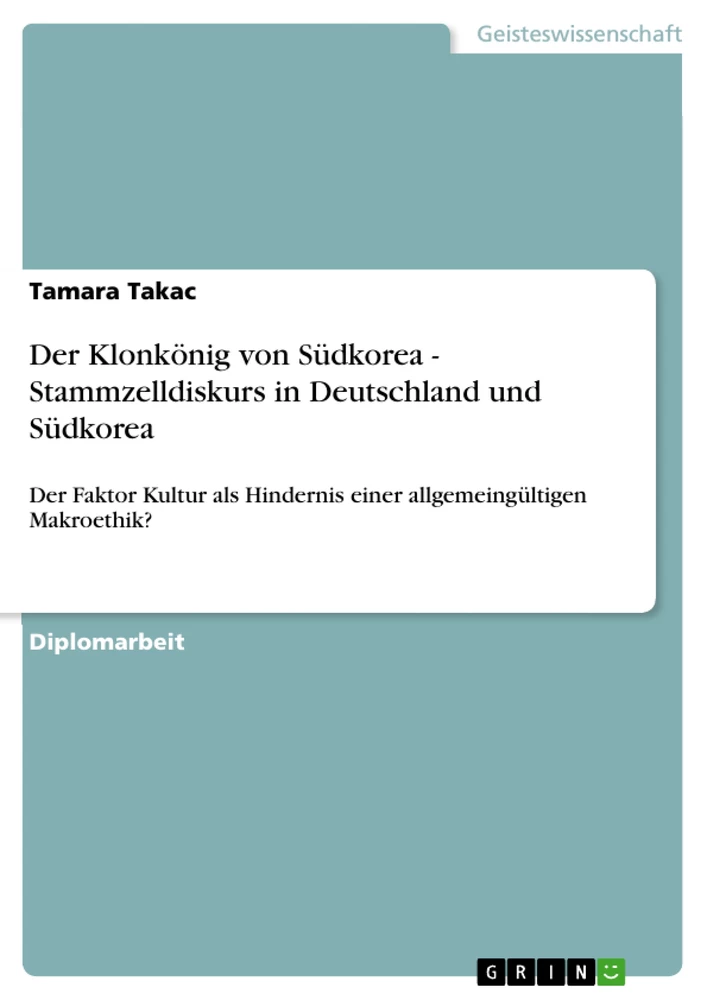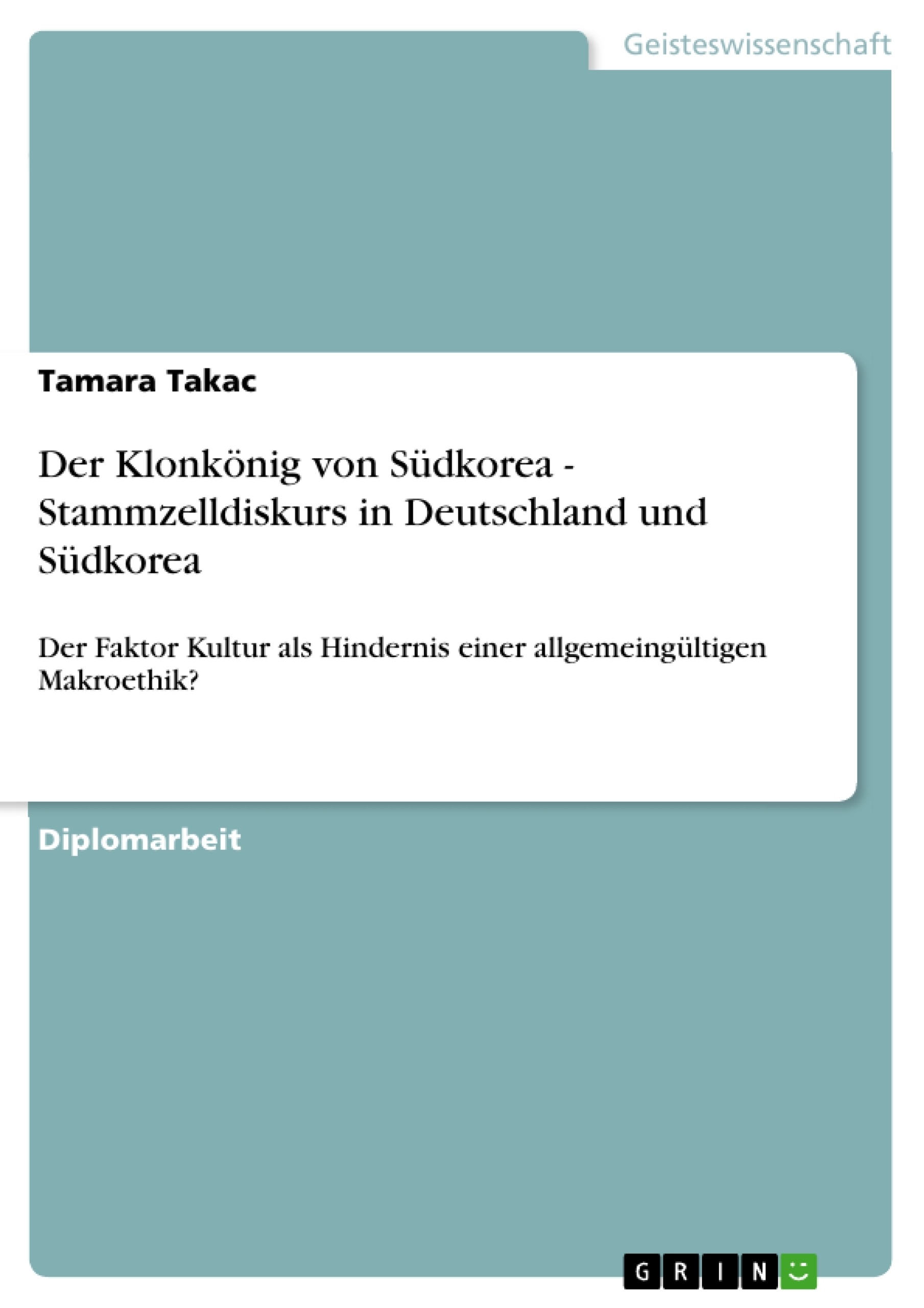Hwang Woo-suk, der „Klonkönig von Südkorea“. Zu diesem Titel gelangt der südkoreanische Wissenschaftler nach seinem erfolgreichen Klonexperiment im Februar 2004. Bei diesem Experiment klonten er und sein Team Embryos und extrahierten aus diesen Stammzellen. Hwang Woo-suk wird mehr und mehr als Nationalheld Südkoreas gerühmt und die ganze Welt debattiert über seine spektakulären Ergebnisse. Doch Ende 2005 bricht die Euphorie plötzlich zusammen: Der bekannte Klonforscher soll all seine Ergebnisse gefälscht haben.
Es lassen sich zu dem Thema Stammzell- und Embryonenforschung Diskurse beobachten, zum einen innerhalb der Länder, zum anderen auf internationaler Ebene. Die Koreaner hatten 2004 gezeigt, was machbar schien und daran wird im Diskurs der moralische Status von menschlichen Embryonen erörtert, ethische Fragen um Grenzziehungen gestellt.
Es wird debattiert, Stellung bezogen, Gesetze entworfen. Doch auch wenn die Regelungen hinsichtlich einem strikten Klonverbot oder der Erlaubnis des therapeutischen Klonens sehr unterschiedlich sind, die einzelnen Länder zeigen sowohl national als auch international Uneinigkeit, gerade in der ethischen Beurteilung der Experimente. Angesichts der Chancen der Stammzellforschung, die neue Hoffnung und Wunderheilungen verheißen, und der Angst vor Grenzüberschreitungen in Experimenten, geklonten Menschen und Instrumentalisierungen, werden konsequente Ablehnung oder Zustimmung schwierig.
Deutschland und Südkorea stehen in einem besonderen Gegensatz: In Deutschland herrschen sehr strenge Reglementierungen hinsichtlich der Embryonen- und Stammzellforschung, in Südkorea wird diese Forschung vehement vorangetrieben. Geteilte Welt? Der Westen auf der einen, asiatische Länder auf der anderen Seite?
Der Faktor Kultur wird zu einer scheinbar unbestreitbaren Größe, er funktioniert als beliebtes Argument für die unterschiedlichen Einstellungen und erschwert weitere kommunikative Anschlussmöglichkeiten. Normen wie Menschenrechte und Menschenwürde, für welche die Vereinten Nationen und ihre Mitgliedstaaten eintreten, sollen gewahrt, Instrumentalisierung und Ausnutzung von menschlichem Leben verhindert werden. Nicht nur im eigenen Land, sondern weltweit.
Kann eine „Makroethik“ als Lösung dienen, eine Ethik, die auf einer übergeordneten Ebene, ungehindert der verschiedenen Kulturen, Gültigkeit besitzt?
Inhaltsverzeichnis
- Wirbel um Südkorea
- Begriffsklärung
- Die Klonexperimente in Südkorea
- Grenzziehung mit Hilfe des Klonbegriffs: reproduktives und therapeutisches Klonen
- Embryonale Stammzellen — adulte Stammzellen
- Chancen und Probleme der neuen Technologien
- Südkorea und Deutschland: ein Vergleich
- Deutschland
- Wirtschaft und Wissenschaft
- Gesetzeslage in Deutschland
- Religion und „Menschenbild"
- Südkorea
- Wirtschaft und Wissenschaft
- Gesetzeslage in Südkorea
- Religion und „Menschenbild"
- Internationaler Stand: Entwicklungen und Gesetzeslage
- Deutschland
- Theoretischer und methodischer Rahmen
- Kultur im Diskurs — Diskurs der Kulturen
- Was ist kulturell am Kulturellen?
- Zur Bedeutung von Kultur und Uneindeutigkeit
- Die Idee einer „Makroethik" aufgrund „kultureller Sprecher"
- Ethik und Moral
- Diskurse: Archäologie und Wissen
- Methode: Diskursanalyse anhand Qualitativer Inhaltsanalyse
- Deutsche und koreanische Printmedien als Datengrundlage
- Das methodische Vorgehen
- Analyseeinheiten: das Jahr 2004 und 2005
- Bestimmung von Dimensionen
- Diskursanalyse: Grundlagen und Strukturelemente
- Kultur im Diskurs — Diskurs der Kulturen
- Der Stammzelldiskurs: eine Frage der Ethik
- Analyseeinheit I: das Klonexperiment als Anstoß des Diskurses
- Spannung im Diskurs: zum Status des Embryos
- Deutschland im Konflikt
- Die Hoffnung Südkoreas
- Die Etablierung bestimmter Sprecher
- Deutschland
- Die „Experten" der Wissenschaft, Forschung oder Medizin: Glaube und Zweifel
- „Experten" der Ethik: die Trennung des Klonbegriffs
- Vertreter einer Religion: der Mensch im Mittelpunkt
- Politik: Uneinigkeit der Parteien
- Die Sprecherpositionen und ihre „sagbaren" Sätze
- Südkorea
- „Experten" der Wissenschaft, Forschung oder Medizin: Hwang im Mittelpunkt
- „Betroffene" als „authentische Sprecher"
- Öffentliche Gruppen üben Widerstand
- Politiker als Unterstützer von Hwang Woo-suk
- Religion: Legitimiert der Buddhismus die Forschung?
- Das Auftauchen „kultureller Sprecher"
- Deutschland
- Erste Bilanz: zur Uneindeutigkeit der Kultur
- Spannung im Diskurs: zum Status des Embryos
- Analyseeinheit II: weitere Entwicklungen im Jahr 2005
- Der „König des Klonens" macht neue Schlagzeilen
- Deutschland Land der „neuen Möglichkeiten"?
- Politiker im Umschwung
- „Trickreiche" Forscher in Deutschland
- Welche Zukunft schaffen wir uns?
- Kultur als Thema im Diskurs
- Südkorea: Konfrontation mit den „anderen Möglichkeiten"
- Buddhismus und die Stammzellforschung
- Bilanz 2005: Annäherung und Auseinanderdriften
- Internationale Entwicklungen: globaler Diskurs und Interdependenz
- Analyseeinheit I: unversöhnlich angesichts des reproduktiven und therapeutischen Klonens
- Deutschland als Zünglein an der Waage?
- Südkorea bangt um den Fortschritt
- Analyseeinheit II: eine unverbindliche Deklaration
- Zusammenfassung der internationalen Entwicklungen
- Analyseeinheit I: unversöhnlich angesichts des reproduktiven und therapeutischen Klonens
- Kultur und Religion im Angesicht neuen Wissens
- Zur Bedeutung der Religion und neuem Wissen
- Die Stabilität der Kultur im Diskurs
- Der Hindernisvorwurf
- Ausblick: der Fall des Klonkönigs
- Verzeichnis: Literatur und weitere Quellen
- Anhang
- Empirisches Material: Verzeichnis der Grundgesamtheit
- Dossier I: (2004 und 2005)
- Dossier II (2004)
- Dossier III (2005)
- Praktisches Beispiel zum methodischen Vorgehen
- Empirisches Material: Verzeichnis der Grundgesamtheit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese freie wissenschaftliche Arbeit untersucht den Stammzelldiskurs in Deutschland und Südkorea, wobei der Fokus auf der Rolle des Faktors Kultur als mögliches Hindernis für eine allgemeingültige Makroethik liegt. Die Arbeit analysiert die Diskursentwicklung in den Jahren 2004 und 2005 anhand von Printmedien aus beiden Ländern, um zu ergründen, ob und wie kulturelle Unterschiede die Bildung eines Konsenses in Bezug auf die Stammzellforschung erschweren.
- Der Status des menschlichen Embryos und die ethische Bewertung seiner Verwendung in der Forschung
- Die Spannung zwischen dem Schutz des Embryos und der Verantwortung gegenüber Kranken, die von der Stammzellforschung profitieren könnten
- Die Rolle von Religion und Kultur im Diskurs und die Konstruktion von „Menschenbildern"
- Die Etablierung von „kulturellen Sprechern" und die Bedeutung des Kulturarguments in der bioethischen Debatte
- Die Möglichkeiten und Grenzen einer kulturübergreifenden „Makroethik" im Kontext der Globalisierung und der neuen Technologien
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema „Der Klonkönig von Südkorea" ein und beleuchtet die Klonexperimente des südkoreanischen Wissenschaftlers Hwang Woo-suk im Februar 2004 und Mai 2005. Die Bedeutung der Stammzellforschung für die Heilung unheilbarer Krankheiten wird hervorgehoben, ebenso wie die ethischen Bedenken, die mit der Zerstörung von Embryonen verbunden sind. Die Arbeit stellt den Kontrast zwischen Deutschlands strengen Reglementierungen und Südkoreas forschungsfreundlicher Haltung dar und stellt die zentrale Forschungsfrage: Kann der Faktor Kultur als Hindernis für eine allgemeingültige Makroethik im Stammzelldiskurs fungieren?
Das zweite Kapitel erläutert wichtige Begriffe, die im Stammzelldiskurs verwendet werden, wie z.B. Klonen, therapeutisches Klonen, reproduktives Klonen, embryonale Stammzellen und adulte Stammzellen. Es werden die biologischen Grundlagen des Klonens und der Stammzellforschung erläutert und die unterschiedlichen Zielsetzungen des therapeutischen und reproduktiven Klonens dargestellt.
Das dritte Kapitel beleuchtet die Chancen und Probleme der neuen Technologien im Bereich der Stammzell- und Embryonenforschung. Es werden die Hoffnungen auf Heilung unheilbarer Krankheiten, die wirtschaftlichen Interessen und die ethischen Bedenken, die mit der Instrumentalisierung menschlichen Lebens verbunden sind, diskutiert. Das Kapitel vertieft die Frage, ob das Fehlen eines globalen Konsenses in bioethischen Fragen problematisch ist und ob jedes Land selbst entscheiden kann, was es für Recht hält.
Das vierte Kapitel vergleicht die wirtschaftlichen, politischen, religiösen und kulturellen Strukturen Deutschlands und Südkoreas, um einen Kontext für den Stammzelldiskurs in beiden Ländern zu schaffen. Es werden die unterschiedlichen Gesetzeslagen, die Rolle des Christentums in Deutschland und die Vielfalt der Religionen in Südkorea beleuchtet, die zu verschiedenen „Menschenbildern" führen. Der internationale Stand der Entwicklungen und die Gesetzeslage im Bereich der Stammzellforschung werden kurz dargestellt.
Das fünfte Kapitel erläutert den theoretischen und methodischen Rahmen der Arbeit. Der Kulturbegriff wird als komplex und schwer zu fassen dargestellt und die Bedeutung von Kultur in der Generierung von Eindeutigkeiten und der Einschränkung von Kontingenz beleuchtet. Die Idee einer „Makroethik" wird als möglicher Ansatz für einen kulturübergreifenden Konsens vorgestellt. Der Unterschied zwischen Ethik und Moral wird erörtert und Foucaults Diskurstheorie als Grundlage für die Analyse des Stammzelldiskurses eingeführt. Die Qualitative Inhaltsanalyse und die Diskursanalyse werden als Methoden der Arbeit vorgestellt und die Analyseeinheiten, Dimensionen und Strukturelemente der Diskursanalyse erläutert.
Das sechste Kapitel analysiert den Stammzelldiskurs anhand von Printmedien aus Deutschland und Südkorea in den Jahren 2004 und 2005. Es werden die Reaktionen auf das erste Klonexperiment Hwangs im Jahr 2004 und die weiteren Entwicklungen nach der Veröffentlichung des zweiten Experiments im Jahr 2005 betrachtet. Die unterschiedlichen Sprecherpositionen, Argumente und Deutungsschemata werden analysiert, wobei der Fokus auf der Rolle von Kultur und Religion liegt. Die internationale Entwicklung des Stammzelldiskurses wird im Kontext der Vereinten Nationen beleuchtet und die Schwierigkeiten bei der Konsensfindung aufgezeigt.
Das siebte Kapitel untersucht die Bedeutung von Kultur und Religion im Angesicht neuen Wissens im Bereich der Stammzellforschung. Es wird die Funktion der Religion als Mittel zur Herstellung von Eindeutigkeit und zur Bewältigung von Unsicherheiten in Bezug auf den Beginn und das Ende des Lebens beleuchtet. Die Stabilität des Kulturarguments im Diskurs wird hinterfragt und die Paradoxie der Kultur als Erklärungs- und Zuschreibungsmedium dargestellt. Die Arbeit stellt den Hindernisvorwurf in Bezug auf eine kulturübergreifende „Makroethik" in Frage und diskutiert die Möglichkeiten und Grenzen einer solchen Ethik im Kontext der Globalisierung.
Das achte Kapitel befasst sich mit dem Fall des Klonkönigs Hwang Woo-suk und den Fälschungsvorwürfen, die Ende 2005 gegen ihn erhoben wurden. Die Folgen des Skandals für Südkorea und die internationale Forschungslandschaft werden betrachtet. Die Arbeit stellt abschließend die Frage, wie sich der Stammzelldiskurs nach dem Fall Hwangs weiterentwickeln wird und ob eine allgemeingültige „Makroethik" in diesem Kontext überhaupt möglich ist.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Stammzellforschung, Embryonenforschung, Klonen, therapeutisches Klonen, reproduktives Klonen, Kultur, Religion, „Menschenbild", Makroethik, Bioethik, Diskursanalyse, Deutschland, Südkorea, Hwang Woo-suk.
- Analyseeinheit I: das Klonexperiment als Anstoß des Diskurses
- Quote paper
- Tamara Takac (Author), 2004, Der Klonkönig von Südkorea - Stammzelldiskurs in Deutschland und Südkorea, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112233