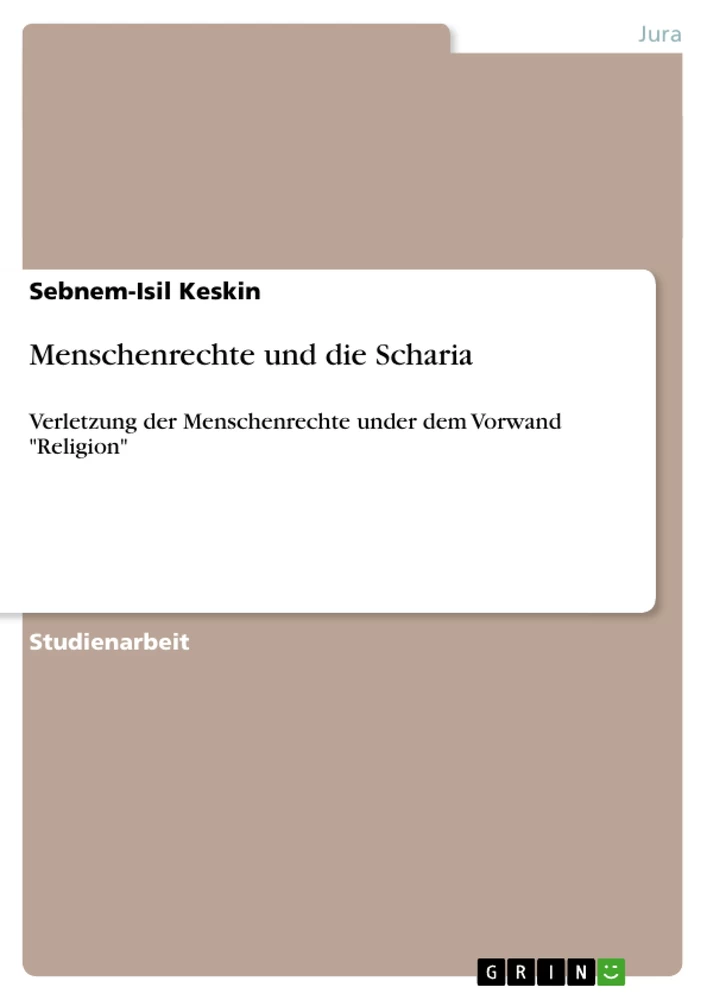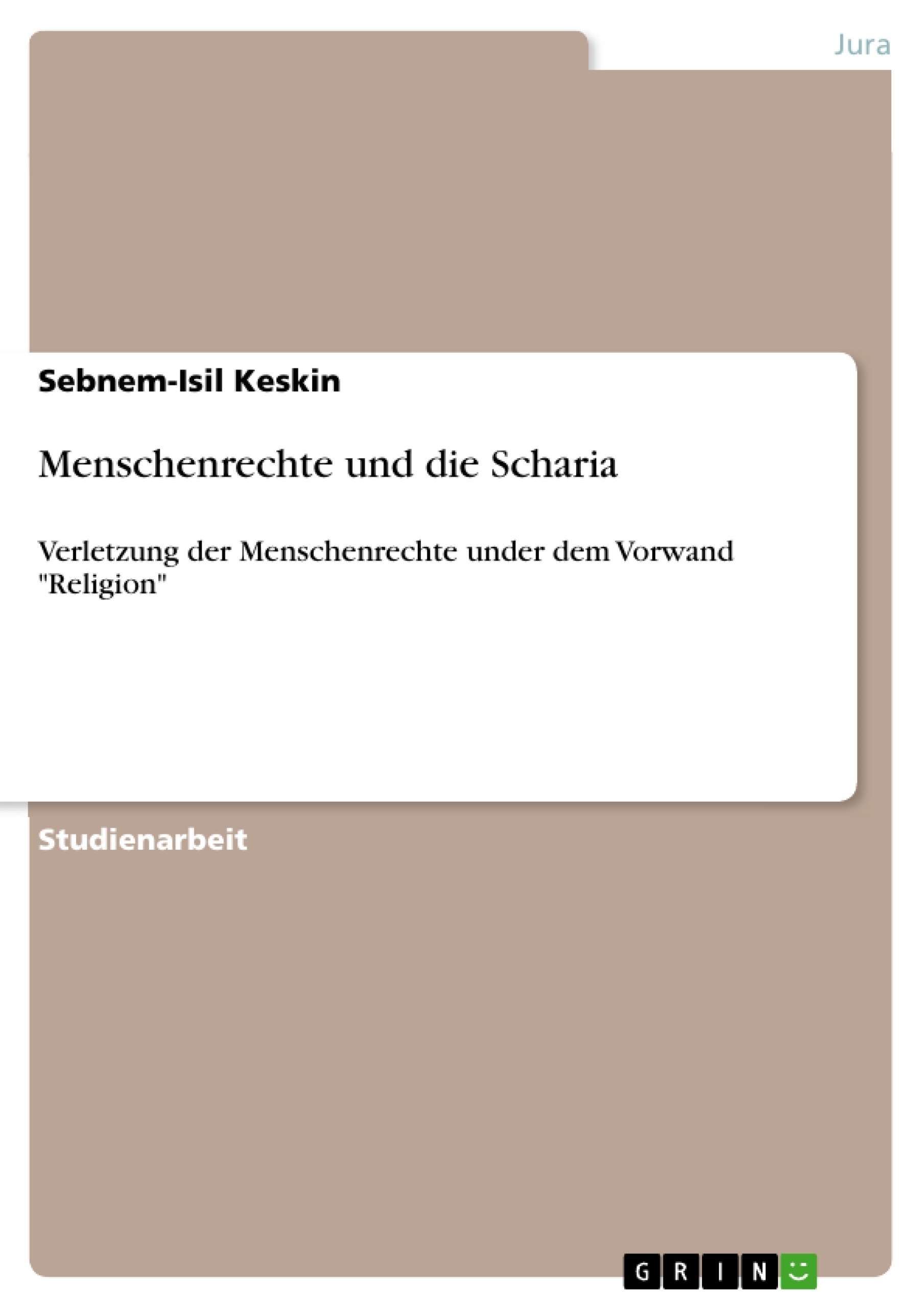,,Wenn wir die Weltbevölkerung auf 100 Menschen in einem globalen Dorf einschränken würden, so bestehe diese aus Folgendem: Es gäbe 57 Asiaten, 21 Europäer, 14 aus Nord-/Südamerika und 8 Afrikaner. Wir wären 51 Frauen und 49 Männer; 70 wären Nicht-Christen, 30 wären Christen; 50% aller Reichtümer gehörten sechs Menschen, die alle aus den USA kommen würden. Die Behausung von 80 wäre in einem schlechten Zustand; 70 wären Analphabeten; 50 würden an Unterernährung leiden, und nur einer hätte einen Hochschulabschluss. Keiner hätte einen Computer."1
Es ist nicht unschwer zu erkennen, dass bei dieser Konstellation ,,verschiedene Welten" aufeinandertreffen. Diese werden insbesondere durch die unterschiedlichen Religionen und der damit verbundenen Kulturen, sowie der Denkweisen und Lebensvorstellungen, aber auch der sozialen Verhältnisse eines jeden Menschen gekennzeichnet. Durch diese Völkervielfalt entstehen neben positiven Effekten, meist auch negative Effekte, die sich in Gewalt und Machtkämpfen niederschlagen können, um Idealvorstellungen zu verfolgen. Um derartiges zu vermeiden bzw. diesem entgegenzuwirken, ist es notwendig eine Basis festzulegen und zu realisieren, die zu einer gegenseitigen Achtung und der Völkerverständigung führen sollte. Kurz gesagt: Diese Basis sollten und müssen die Menschenrechte sein.
Das Hauptproblem in unserer heutigen Welt aber ist, dass Menschenrechte wie wir sie in unserer ,,westlichen" Zivilisationen verstehen, nicht gleich Menschenrechte sind, da diese aufgrund der kulturellen Unterschiede und religiösen Auffassungen anders definiert werden können.
Hierbei geht es um das islamische Recht, die Scharia, die vor allem durch ihre als Rechtsmaßstab festgelegten Grausamkeiten im Strafrecht, das uns bekannte Menschenrechtsbild missachtet und dadurch einen Konflikt auslöst.
Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, dem Leser einen fundierten Überblick über die Entstehung und Entwicklung der elementarsten Menschenrechte zu geben. Anschließend folgt auch eine Darstellung über die in den Medien oft als negativ interpretierte Scharia. Dabei soll deutlich gezeigt werden, dass das islamische Recht bei rechtmäßiger und zeitgemäßer Interpretation die Menschenrechte nicht verletzt, sondern eher primär schützt. Auch werden hier die Gründe für die Fehlinterpretation der Scharia vor allem im Strafrecht in den islamischen Ländern in denen sie angewandt wird, erörtert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Menschenrechte
- Die Goldene Regel
- Entstehung und Entwicklung
- Schutz der Menschenrechte – Staatliche Ebene
- Menschenrechtskommission
- Generalversammlung
- Hochkommissar für Menschenrechte
- Wirtschafts- und Sozialrat (ECISOC)
- Vertraglich festgelegte Überwachungsgremien
- Beratungsdienste und technische Hilfe
- Schutz der Menschenrechte – Nichtstaatliche Ebene
- Menschenrechtskonferenzen
- Fünfzig Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948 - 1998)
- Scharia
- Entwicklung Faktischer Normen
- Koran
- Sunna und Hadithe
- Ijtihad
- Idjma
- Kiyas
- Fikh
- Rechtsschulen
- Interpretation
- Koran und Scharia
- Islamisches Strafrecht
- Ewig Gültiges und zeitlich Bedingtes im Koran
- Mekkanische und Medinensische Botschaft
- Fundamentalismus und Re-Islamisierung
- Harmonisierung von Religion und Staat
- Laizismus
- Entwicklung Faktischer Normen
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Verhältnis von Menschenrechten und Scharia. Sie soll dem Leser einen fundierten Überblick über die Entstehung und Entwicklung der elementarsten Menschenrechte geben. Anschließend folgt eine Darstellung der Scharia, wobei deutlich gezeigt werden soll, dass das islamische Recht bei rechtmäßiger und zeitgemäßer Interpretation die Menschenrechte nicht verletzt, sondern eher primär schützt. Auch werden die Gründe für die Fehlinterpretation der Scharia vor allem im Strafrecht in den islamischen Ländern in denen sie angewandt wird, erörtert.
- Entstehung und Entwicklung der Menschenrechte
- Die Scharia als Rechtsmaßstab
- Interpretation der Scharia im Kontext von Menschenrechten
- Konflikte zwischen Menschenrechten und Scharia
- Die Rolle des Laizismus in der Beziehung von Religion und Staat
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung setzt den Kontext für die Arbeit, indem sie auf die unterschiedlichen Welten und kulturellen Unterschiede in unserer heutigen Gesellschaft aufmerksam macht. Sie stellt die Bedeutung von Menschenrechten als Basis für die gegenseitige Achtung und Völkerverständigung heraus.
- Menschenrechte: Dieses Kapitel erörtert die Entwicklung und die zentralen Elemente der Menschenrechte. Es beleuchtet die "Goldene Regel" als Grundprinzip des Umgangs mit Mitmenschen und geht auf die verschiedenen Schutzmechanismen der Menschenrechte auf staatlicher und nichtstaatlicher Ebene ein.
- Scharia: Dieses Kapitel widmet sich dem islamischen Recht. Es beleuchtet die Entwicklung der Scharia, die verschiedenen Rechtsquellen und deren Interpretation. Besonderes Augenmerk wird auf das islamische Strafrecht und die Frage der zeitlichen Gültigkeit von koranischen Botschaften gelegt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themenfeldern Menschenrechte, Scharia, islamisches Recht, Koran, Interpretation, Rechtsschulen, Laizismus, Fundamentalismus, Völkerverständigung und kulturelle Unterschiede.
Häufig gestellte Fragen
Stehen die Scharia und Menschenrechte grundsätzlich im Konflikt?
Die Arbeit argumentiert, dass die Scharia bei zeitgemäßer Interpretation die Menschenrechte nicht verletzt, sondern primär schützen kann.
Was sind die Hauptquellen der Scharia?
Die wichtigsten Quellen sind der Koran, die Sunna (Hadithe), sowie Methoden wie Ijtihad, Idjma und Kiyas.
Warum wird die Scharia oft negativ wahrgenommen?
Dies liegt häufig an der Fehlinterpretation und Anwendung grausamer Strafen im Strafrecht einiger islamischer Länder, die dem modernen Menschenrechtsbild widersprechen.
Was ist der Unterschied zwischen mekkanischen und medinensischen Koranversen?
Die Unterscheidung ist wichtig für die Interpretation, da mekkanische Verse eher spirituell-ethisch und medinensische Verse eher rechtlich-organisatorisch geprägt sind.
Welche Rolle spielt der Laizismus in dieser Debatte?
Laizismus thematisiert die Trennung von Religion und Staat, was eine Harmonisierung von Glauben und modernen Rechtsnormen beeinflussen kann.
- Arbeit zitieren
- Sebnem-Isil Keskin (Autor:in), 2002, Menschenrechte und die Scharia, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11229