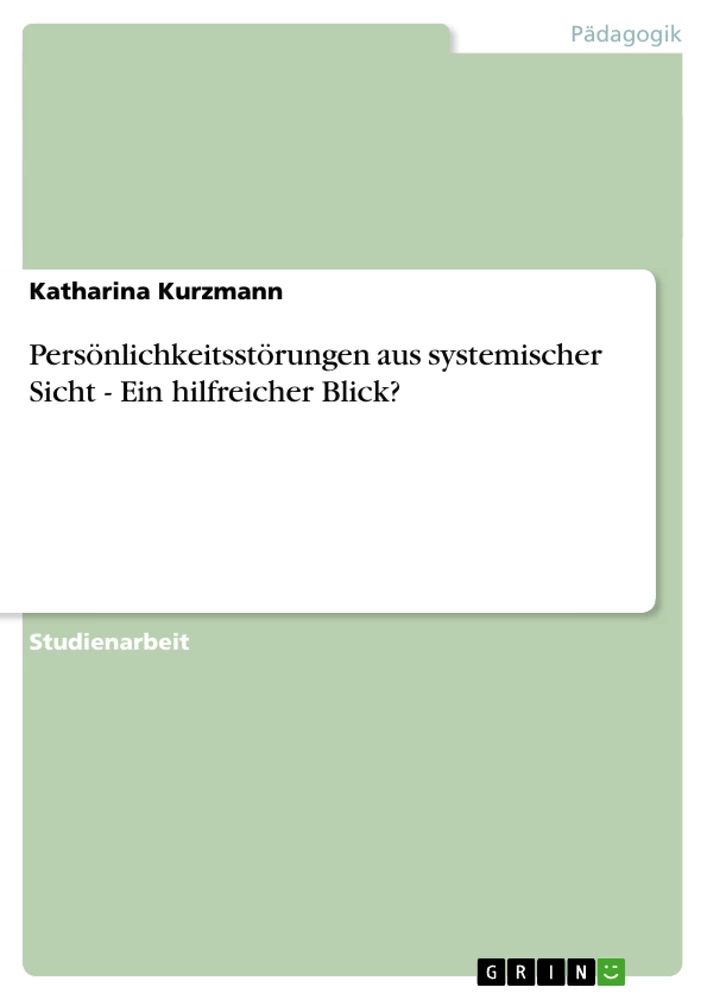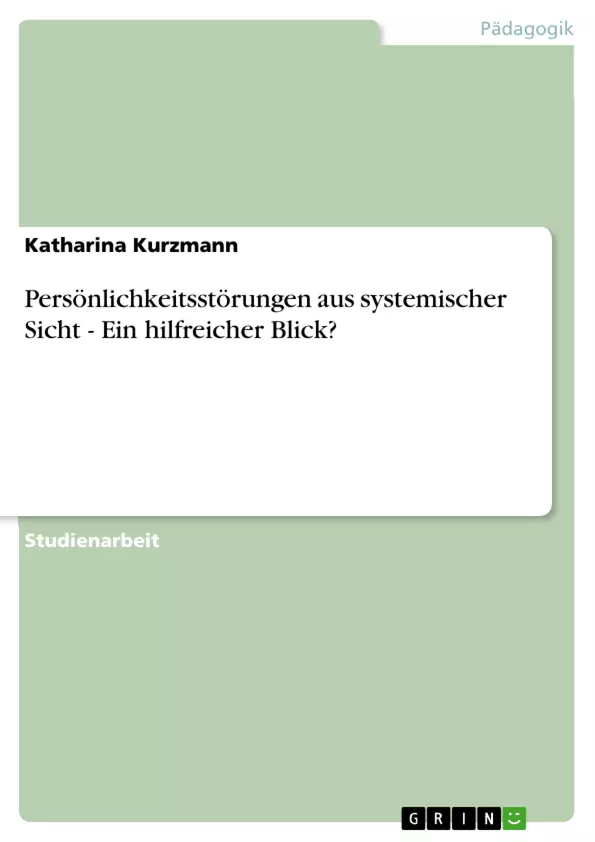Innerhalb dieser Arbeit, die ich im Zuge des Mittelseminars „Systemische Beratung“ verfasst habe, beschäftige ich mich mit der systemischen Sichtweise auf Persönlichkeitsstörungen. Dabei soll herausgefunden werden, ob und inwieweit systemische Therapie auch bei schwer persönlichkeitsgestörten Menschen helfen kann, denn für viele psychiatrische Langzeitpatienten ist ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben nicht mehr denkbar. Hierauf basiert aber die systemische Sichtweise im Gegensatz zu „anerkannten“ Therapieverfahren und der medikamentösen Behandlung nach medizinisch-kausalen Krankheitsmodellen. Des Weiteren soll geklärt werden, ob es hilfreich ist, gerade in Bezug auf Persönlichkeitsstörungen, das ganze System sowohl in die Diagnostik als dann auch in die Therapie mit einzubeziehen. Gibt es Zusammenhänge zwischen bestimmten Beziehungskonstellationen innerhalb Familien mit einem persönlichkeitsgestörten Mitglied? Und wie wirkt sich die Zuschreibung „Du hast eine Persönlichkeitsstörung“ auf das Verhalten des Betroffenen und dessen Umwelt aus? All dies sind Fragen, die in den folgenden Ausführungen beantwortet oder zumindest so behandelt werden sollen, dass ein Verstehen von Persönlichkeitsstörungen aus dem systemischen Blickwinkel möglich wird.
Dazu erscheint es zu Beginn sinnvoll, einige grundlegenden Gedanken des Systemischen darzustellen sowie einige Definitionen anzuführen, die den folgenden Ausführungen eine Basis geben. Dabei liegt ein Fokus auf dem Krankheitsverständnis in der systemischen Therapie, welches auch eng im Zusammenhang mit dem dort herrschenden Verständnis des Problembegriffs steht. Dabei darf nicht verschwiegen werden, dass aufgrund des Umfangs der Arbeit eine eingehende Beschäftigung mit konstruktivistischen Ideen und den Kommunikationstheorien, auf die sich die systemische Therapie stützt, nicht möglich ist und deshalb zum größten Teil vorausgesetzt wird.
Darauf folgend soll das spezifische Vorgehen in der systemischen Therapie mit persönlichkeitsgestörten Menschen dargestellt werden. Auch hier kann nur ein genereller Blick ermöglicht werden, der nicht auf die einzelnen Störungen eingeht, sondern sich mehr auf ein generelles Therapiekonzept für Persönlichkeitsstörungen und hilfreiche Methoden zur Entstörung richtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen und Grundlagen
- Persönlichkeit
- Persönlichkeitsstörung
- Klassifikationssysteme und Diagnostik
- Krankheit aus systemischer Sicht
- Das „Problem“ und dessen Chronifizierung
- Systemische Therapie bei Persönlichkeitsstörungen
- Therapiekonzept
- Wie wirksam ist Systemische Therapie?
- Resümee
- Literatur
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der systemischen Sichtweise auf Persönlichkeitsstörungen. Ziel ist es, zu untersuchen, ob und inwieweit systemische Therapie auch bei schwer persönlichkeitsgestörten Menschen hilfreich sein kann. Dabei wird insbesondere die Frage beleuchtet, ob es sinnvoll ist, das gesamte System in die Diagnostik und Therapie einzubeziehen. Die Arbeit analysiert, ob Zusammenhänge zwischen bestimmten Beziehungskonstellationen innerhalb Familien mit einem persönlichkeitsgestörten Mitglied bestehen und wie die Zuschreibung „Du hast eine Persönlichkeitsstörung“ das Verhalten des Betroffenen und seiner Umwelt beeinflusst.
- Systemische Sichtweise auf Persönlichkeitsstörungen
- Wirksamkeit systemischer Therapie bei Persönlichkeitsstörungen
- Bedeutung des Systems in Diagnostik und Therapie
- Zusammenhänge zwischen Beziehungskonstellationen und Persönlichkeitsstörungen
- Einfluss der Zuschreibung „Persönlichkeitsstörung“ auf Verhalten und Umwelt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der systemischen Sichtweise auf Persönlichkeitsstörungen ein und stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit dar. Im zweiten Kapitel werden grundlegende Begriffe wie Persönlichkeit und Persönlichkeitsstörung definiert. Außerdem werden die Klassifikationssysteme und die Diagnostik aus psychiatrischer und systemischer Sicht beleuchtet. Das Krankheitsverständnis in der systemischen Therapie sowie die Chronifizierung von Problemen werden ebenfalls erläutert. Das dritte Kapitel widmet sich der systemischen Therapie bei Persönlichkeitsstörungen. Es wird ein generelles Therapiekonzept vorgestellt und hilfreiche Methoden zur Entstörung erläutert. Abschließend wird die Evaluation in der systemischen Therapie und Beratung thematisiert und einige Befunde dargestellt, die zur Beantwortung der Frage nach der Sinnhaftigkeit systemischer Therapie bei Persönlichkeitsstörungen beitragen sollen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Persönlichkeitsstörungen, systemische Therapie, Systemtheorie, Familientherapie, Beziehungskonstellationen, Diagnostik, Chronifizierung, Krankheit, Problem, Verhalten, Umwelt, Wirksamkeit, Evaluation.
- Quote paper
- Katharina Kurzmann (Author), 2008, Persönlichkeitsstörungen aus systemischer Sicht - Ein hilfreicher Blick?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112313