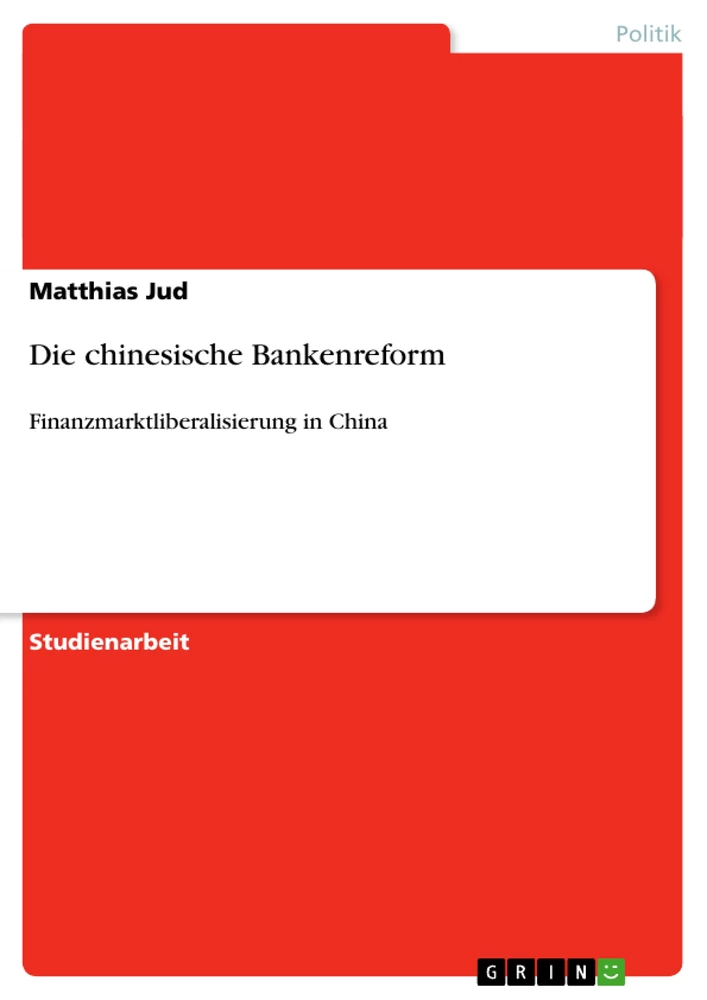In den 30 Jahren seit Deng Xiaoping am Nationalen Parteikongress 1978 sehr vorsichtig, zunächst mit kleinen "kapitalistischen Experimenten" in Sonderwirtschaftszonen, den Übergang von der zentralen Planwirtschaft zur Marktwirtschaft einleitete, hat sich die chinesische Volkswirtschaft mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von ca. 9.5 Prozent sehr positiv entwickelt. Als man 1980 als offizielle Zielsetzung die Vervierfachung des Bruttosozialprodukts bis Ende des Jahrtausends propagierte, war man sich selbst von amtlicher Seite her nicht sicher, ob dies überhaupt möglich sei. Dieses Ziel, nämlich bis zum Jahr 2000 ein BIP von 2.8 Billionen Yuan Renminbi (dt: Volkswährung; RMB) zu erreichen, wurde dann aber um ein Mehrfaches übertroffen, indem die Ziffer 2002 die 10 Billionen-Grenze überschritt (ca. 1.2 Billionen US-Dollar). 2005 betrug das BIP gemäss Schätzungen der CIA 1.83 Billionen USD. Am 16. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas (KPC), vom November 2002 wurde von Staatschef Jiang Zemin, dem Nachfolger Dengs, ein neues Ziel formuliert. Man wollte nun bis 2020 den Aufbau einer so genannten "fairly well-off society", zu Deutsch einer "ziemlich wohlhabenden Gesellschaft", anstreben. Dieser politische Terminus, erklärtes Hauptziel der Kommunistischen Partei, bildet auch heute noch einen der wichtigsten Eckpfeiler der chinesischen Staatsdoktrin, und wird in den heimischen Medien täglich erwähnt.
Per Ende 2005 betrug Chinas BIP laut Schätzungen des CIA World Factbook ca. 1.8 Milliarden USD, was in China einer Kaufkraftparität von 8.2 Billionen USD entspricht. China rangiert somit nach den USA und der EU auf Platz 3 der Weltrangliste, was dieses Land zu einem der grössten Märkte der Welt macht. Nicht zuletzt der somit riesige Finanzsektor bietet deshalb ausländischen Investoren grosse Chancen.
Inhaltsverzeichnis
- A. ALLGEMEINER TEIL: DIE CHINESISCHE WIRTSCHAFT UND IHRE PROBLEMFELDER.
- 1. Chinas Wirtschaftsentwicklung seit 1978.
- 2. Sozioökonomische Probleme
- 2.1. Fehlendes Pensions- und Gesundheitssystem
- 2.2. Hohe Ausbildungskosten........
- 2.3. Überalterung der Gesellschaft.
- 2.4. Anzeichen einer Deflation.....
- 3. Anpassungen und Herausforderungen
- 3.1. Strukturelle Anpassungen
- 3.2. Die vier grossen Herausforderungen………......
- B. BESONDERER TEIL: DIE CHINESISCHE BANKENREFORM..
- 1. Die Probleme im Bankensektor....
- 1.1. Die notleidenden Kredite
- 1.2. Bürokratie und Personalüberhang
- 1.3. Technologischer Nachholbedarf
- 1.4. Träger Agrarbereich .......
- 2. Die Bankenreform.
- 2.1. Positive Voraussetzungen
- 2.2. Negative Voraussetzungen
- 2.3. Bisherige Bemühungen
- 2.4 Aktionärsreform und Reform der Kreditvergabe.
- 3. Ausländische Beteiligungen am Beispiel von Schweizer Banken …………………………………….
- 3.1. Aktuelle Situation.....
- 3.2. Auflagen.
- 3.3. Probleme...
- 3.4. Positive Aussichten für die ausländischen Akteure
- 4. Schlussbemerkungen ......
- 5. Bibliographie.
- Wirtschaftsentwicklung Chinas seit 1978
- Sozioökonomische Probleme in China
- Die chinesische Bankenreform
- Ausländische Beteiligungen am chinesischen Bankensektor
- Finanzmarktliberalisierung in China
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Kolloquiumsarbeit befasst sich mit der chinesischen Bankenreform und ihrer Bedeutung für die Finanzmarktliberalisierung in China. Sie analysiert die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Reform für den chinesischen Bankensektor und ausländische Akteure ergeben. Der Fokus liegt auf der Analyse der Probleme im Bankensektor, den Zielen und Strategien der Bankenreform sowie den Auswirkungen auf die ausländischen Banken.
Zusammenfassung der Kapitel
Der allgemeine Teil der Arbeit gibt einen Überblick über die chinesische Wirtschaftsentwicklung seit 1978 und beleuchtet die relevanten sozioökonomischen Probleme des Landes. Die Wirtschaftsentwicklung wird anhand von Statistiken zum Bruttosozialprodukt (BSP) und dem Export- und Importvolumen dargestellt. Die sozioökonomischen Probleme umfassen das fehlende Pensions- und Gesundheitssystem, hohe Ausbildungskosten, die Überalterung der Gesellschaft und Anzeichen einer Deflation. Der allgemeine Teil beleuchtet auch die strukturellen Anpassungen und die vier grossen Herausforderungen, die sich aus der Wirtschaftsentwicklung ergeben.
Der besondere Teil der Arbeit konzentriert sich auf die chinesische Bankenreform. Er analysiert die Probleme im Bankensektor, die zu der Reform führten, darunter die notleidenden Kredite, Bürokratie und Personalüberhang, technologischer Nachholbedarf und die starke Abhängigkeit vom Agrarbereich. Die Arbeit beleuchtet die positiven und negativen Voraussetzungen für die Bankenreform und beschreibt die bisherigen Bemühungen zur Reform des Bankensektors. Ein Schwerpunkt liegt auf der Aktionärsreform und der Reform der Kreditvergabe. Der besondere Teil der Arbeit untersucht auch die Beteiligung ausländischer Banken am chinesischen Bankensektor am Beispiel von Schweizer Banken. Er analysiert die aktuelle Situation, die Auflagen für ausländische Banken, die Probleme, die sich aus der Reform ergeben, und die positiven Aussichten für ausländische Akteure.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die chinesische Wirtschaft, die Wirtschaftsentwicklung, die sozioökonomischen Probleme, die Bankenreform, die Finanzmarktliberalisierung, die notleidenden Kredite, die Bürokratie, den technologischen Nachholbedarf, die Aktionärsreform, die Kreditvergabe, die ausländischen Banken, die Schweizer Banken und die Auswirkungen der Bankenreform auf den chinesischen Bankensektor und die ausländischen Akteure.
- Arbeit zitieren
- stud. phil. I Matthias Jud (Autor:in), 2006, Die chinesische Bankenreform, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112326