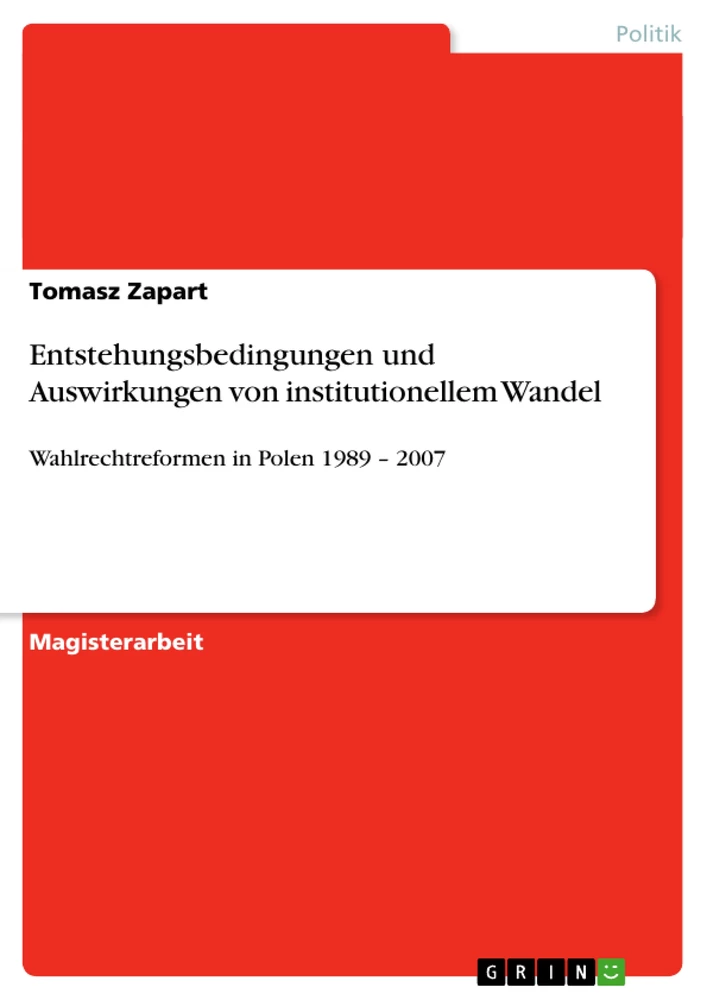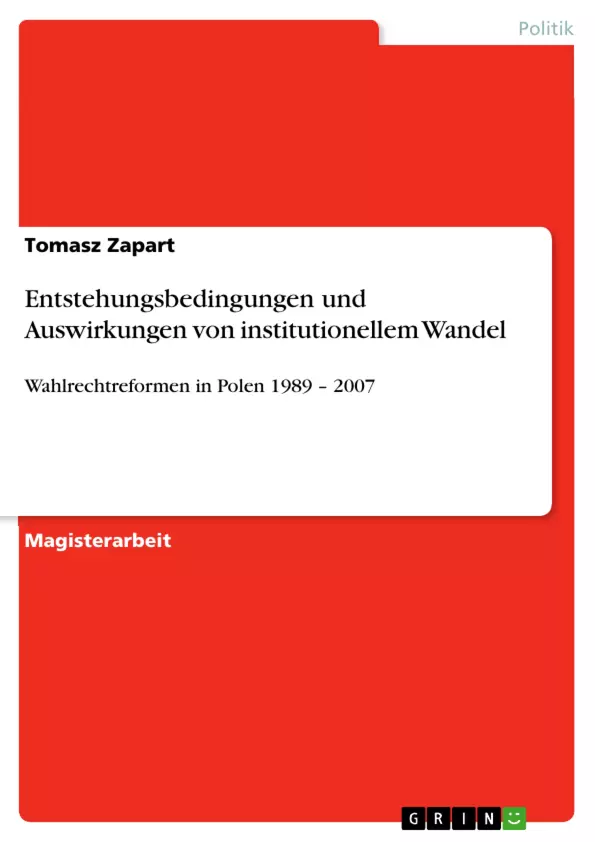Die Einführung kompetitiver Wahlen in Ostmitteleuropa (OME) brachte ein grundlegendes Problem ans Tageslicht. Welches der zur Verfügung stehenden Wahlrechtsysteme sollte in den jeweiligen OME-Staaten in den Gründungswahlen verwendet werden? Recht bald zeigte sich, dass in den meisten Fällen bereits kurz nach den ersten freien Wahlen ein erneutes Reformbedürfnis entstand. Gründe dafür waren breit verstreut und verdeutlichten den Anfang vom institutionellen Wandel, der noch einige Jahre die meisten OME-Staaten begleiten sollte. Die Dritte polnische Republik zeigte eine enorm hohe Reformintensität, die kaum mit westlich demokratischen Standards zu vergleichen war, und erweckte damit das Interesse von politikwissenschaftlichen Wahlforschern. Bis in die neunziger Jahre hinein konzentrierte sich die Wahlsystemforschung auf die Untersuchung der Auswirkungen von Wahlrechtsystemen auf Parteiensysteme. Ausgehend von stabilen und nur sehr selten reformierten Systemen in den westlichen Demokratien und einem dem entsprechend geringem empirischem Untersuchungsfeld erschien dies nicht überraschend. Doch die Konstellation in den OME-Staaten nach 1989 ermöglichte es den neuen politischen Kräften, Einfluss auf die Übersetzungsmethode der Wählerstimmen in Parlamentssitze zu nehmen. Die Dynamik, die diesen Prozess des institutionellen Wandels begleitete, brachte eine enorme Fülle an empirischem Analysematerial. Das Beispiel Polens steht exemplarisch für die wahlrechtlichen Prozesse in den OME-Staaten. Die polnischen electoral engineers konnten in den Jahren 1989 bis 2005 das Wahlrecht fünf Mal erfolgreich reformieren. Rechnet man die semikompetitiven Vorgründungswahlen von 1989 mit und geht damit von sieben abgehaltenen Wahlen bis 2007 aus, so ergibt sich daraus der Schluss, dass nur zwei Mal in aufeinanderfolgenden Wahlen identisches Wahlrecht angewendet wurde. Die enorm häufige Reform des Wahlrechts und die damit verbundenen Akteurskonstellationen politischer Entscheidungsträger, während der jeweiligen Gesetzesänderungen, sind ein deutliches Indiz für sitzmaximierende Handlungsmotivationen der Parteien. Dabei zeigt vor allem die Untersuchung über das Abstimmungsverhalten Reformkoalitionen, die keinerlei ideologische Kongruenz aufweisen, und untermauert so den Befund über nutzenmaximierend handelnde parteipolitische Akteure.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wahlsystemforschung und Theorien des institutionellen Designs
- Wahlsysteme und ihre Auswirkungen
- Typen von Wahlsystemen
- Technische Elemente in Wahlsystemen
- Auswirkungen von Wahlsystemen auf Parteiensysteme
- Design Entscheidung als politische Entscheidung
- Constitutional Design und electoral engineering
- Erklärungsansätze der Wahlsystemreformen in OME
- Theoretische Ansätze zur Erklärung von institutionellem Wandel
- Neoinstitutionalismus: Veto-Spieler-Theorem nach Tsebelis
- Akteurszentrierter Institutionalismus nach Scharpf/Mayntz
- Untersuchungsdesign und Hypothese
- Wahlsysteme und ihre Auswirkungen
- Wahlrechtreformen in Polen: Institutionenpolitische Entstehungsbedingungen und Motivationen der Akteure in den Jahren 1989-2007
- Transitionsphase und semi-kompetitive Wahlen 1989
- Polen im Sinne des Tranceplacement Modells
- Vogründungswahlen und die Majorzregel
- Akteurskonstellation direkt nach den Wahlen
- Simulation einer alternativen Konstellation
- Kompetitive Gründungswahlen 1991
- Parteienlandschaft im Sejm kontraktowy
- Akteurskonstellation und Vetospieler
- Entstehung des Wahlrechts 1991
- Das Prinzip der Proportionalität und die Wahl von 1991
- Neues Wahlgesetz 1993
- Kleine Verfassung 1992 und Parteienlandschaft
- Fragmentierung im Sejm und die Akteurskonstellation
- Entstehung des neuen Wahlrechts
- Modifizierte Proportionalität und die Wahl 1993
- Gescheiterte Reform 1997
- Parteienlandschaft und die neue Verfassung von 1997
- Konzentration und überraschende Akteurskonstelletion
- Elemente der Modifikation und das Scheitern der Reform
- Wahlen 1997
- Erfolgreiche Wahlrechtreform 2001
- Modifikation der Parteienlandschaft im zweidimensionalen Raum
- Neupositionierung der Akteure
- Reformpunkte
- Wahlen 2001
- Anzeichen institutioneller Stabilität zwischen 2001 und 2007
- Parteienlandschaft und Akteurskonstellation nach der Wahl
- Reform 2002 und Reformversuch 2005
- Wahlen 2005
- Wahlen 2007
- Transitionsphase und semi-kompetitive Wahlen 1989
- Diskussion
- Auswirkungen des Wahlrechts auf das Parteiensystem
- Chronologischer Überblick über angewandte wahlsystematische Faktoren und ihre direkten Auswirkungen
- Auswertung vorgefundener Faktoren im Hinblick auf die Kondition des Parteiensystems
- Wahlrechtreformen: Genese und Motivation der Akteure
- Chronologischer Überblick über Reformen und Reformversuche des Wahlrechts
- Zusammenfassende Auswertung und Bestätigung der Hypothese
- Beurteilung der bisherigen Entwicklungen und Ausblick auf mögliche Zukunftsszenarien
- Auswirkungen des Wahlrechts auf das Parteiensystem
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis der Parteien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit befasst sich mit der Entstehung und den Auswirkungen von Wahlrechtreformen in Polen zwischen 1989 und 2007. Ziel ist es, die Genese der Reformen zu analysieren, die Motivationen der beteiligten Akteure zu verstehen und die Auswirkungen auf das polnische Parteiensystem zu untersuchen. Die Arbeit greift dabei auf Theorien des Neoinstitutionalismus zurück, um die Entstehung von Institutionen und den Einfluss von Akteuren auf den institutionellen Wandel zu erklären.
- Genese von Wahlrechtreformen in Polen
- Motivationen der politischen Akteure bei Wahlrechtreformen
- Auswirkungen von Wahlrechtreformen auf das polnische Parteiensystem
- Anwendung des Neoinstitutionalismus zur Erklärung von institutionellem Wandel
- Analyse der Rolle von Vetospielern und Akteurskonstellationen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Relevanz der Wahlsystemforschung im Kontext des institutionellen Wandels in Ostmitteleuropa. Sie hebt die Besonderheiten des polnischen Falls hervor und skizziert die Forschungsfrage und die methodischen Ansätze der Arbeit.
Kapitel 2 befasst sich mit der Wahlsystemforschung und den Theorien des institutionellen Designs. Es werden verschiedene Typen von Wahlsystemen, ihre technischen Elemente und ihre Auswirkungen auf Parteiensysteme vorgestellt. Zudem werden verschiedene Erklärungsansätze für Wahlsystemreformen in Ostmitteleuropa diskutiert, insbesondere der Neoinstitutionalismus und der akteurszentrierte Institutionalismus.
Kapitel 3 analysiert die Wahlrechtreformen in Polen von 1989 bis 2007. Es werden die jeweiligen politischen und institutionellen Rahmenbedingungen, die Akteurskonstellationen und die Motivationen der beteiligten Akteure untersucht. Die Kapitel beleuchten die einzelnen Reformschritte und ihre Auswirkungen auf das Parteiensystem.
Kapitel 4 diskutiert die Ergebnisse der Analyse und zieht Schlussfolgerungen. Es werden die Auswirkungen der Wahlrechtreformen auf das polnische Parteiensystem bewertet und die Rolle von Vetospielern und Akteurskonstellationen im Prozess des institutionellen Wandels beleuchtet. Die Arbeit schließt mit einem Ausblick auf mögliche Zukunftsszenarien.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Wahlrechtreformen, institutioneller Wandel, Parteiensystem, Neoinstitutionalismus, Vetospieler, Akteurskonstellationen, Polen, Ostmitteleuropa, electoral engineering, constitutional design.
- Quote paper
- M.A. Tomasz Zapart (Author), 2008, Entstehungsbedingungen und Auswirkungen von institutionellem Wandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112357