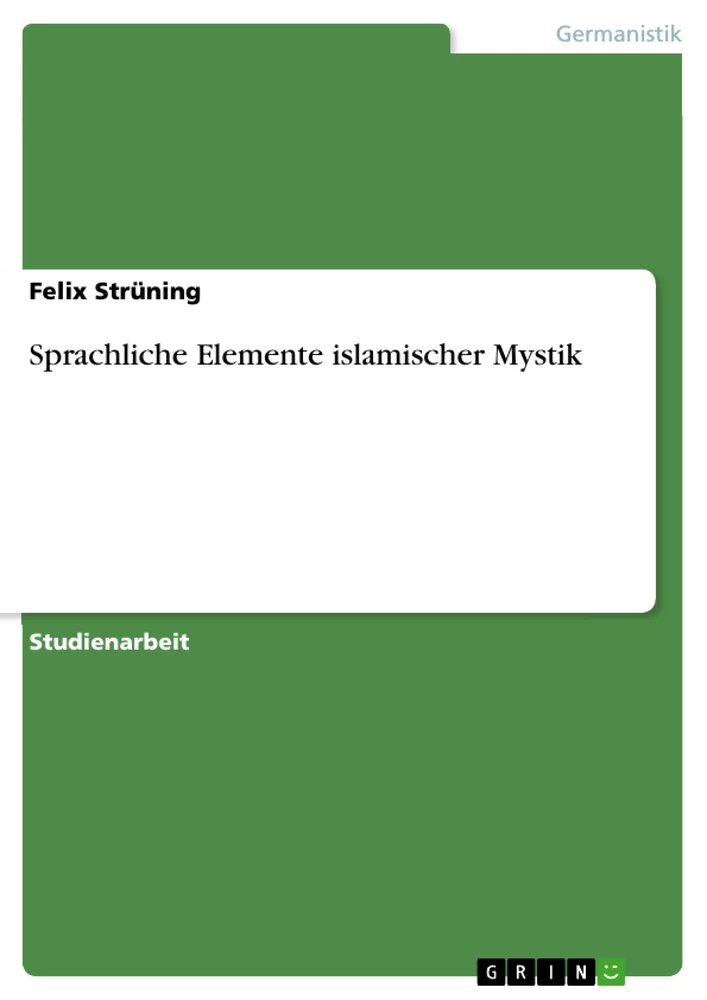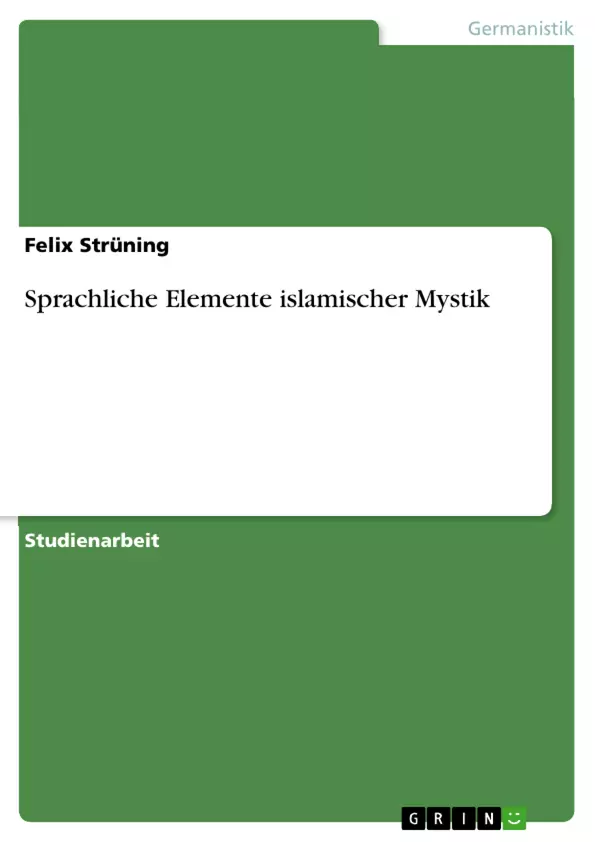Die mittelalterliche Mystik hat in Europa und insbesondere im Deutschen den Sprachgebrauch nachhaltig geprägt. Vor allem die philosophische Sprache bediente sich mystischer Begrifflichkeiten und erreichte darin während des deutschen Idealismus einen Höhepunkt. Aber auch der Islam hat seit seiner Entstehung eine mystische Strömung, die die Philosophie des arabischen Raumes, aber auch des lange muslimisch besetzten Spaniens prägte. Da durch die islamische Philosophie große Teile des griechischen Gedankengutes tradiert wurden, spielen auch Mystik und Philosophie der Hellenen eine Rolle im Spektrum mystischer Strömungen.
In dieser Arbeit will ich nun untersuchen, ob sich vergleichbare Sprachbilder, bzw. allgemeiner, gemeinsame sprachliche Elemente in der islamischen und der christlichen Mystik finden, teilweise greife ich auch auf griechische Elemente zurück.
Es ist natürlich immer schwer, Aussagen über die Sprache übersetzter Werke zu machen, zumal ich des Arabischen nicht mächtig bin. Im Vertrauen auf ausreichend gute und sinngemäße Übertragungen ins Deutsche, denke ich aber, einige Sprachmuster herausarbeiten zu können.
Dazu werde ich sehr kurz in die christliche und griechische Mystik einführen und ihre sprachlichen Tendenzen aufzeigen. Es folgt eine kleine Erörterung der islamischen Mystik und des dortigen Sprachgebrauchs. Anschließend untersuche ich einzelne Sprachelemente und die verwendete Metaphorik. In diesem Bereich will ich die Themen Wille, Wissen, Sein (und Werden), Entwerden und den Gottesbegriff entschlüsseln. Dafür werde ich jeweils Textbeispiele aus griechischer und christlicher Mystik mit jenen aus der islamischen vergleichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Betrachtete Werke islamischer Mystik
- Al-Ghazali: „Die Nische der Lichter“
- Ibn Tufail: „Der Philosoph als Autodidakt“
- Christliche und griechische Mystik
- Sprachliche Tendenzen christlicher und griechischer, insbesondere deutschsprachiger Mystik
- Islamische Mystik
- Vergleich einiger Sprachbilder und Metaphern in christlicher und islamischer Mystik
- Wille
- Wissen
- Sein (und Werden)
- Entwerden
- Gottesbegriff
- Fazit
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, ob sich vergleichbare Sprachbilder und sprachliche Elemente in der islamischen und christlichen Mystik finden. Dabei werden auch griechische Elemente berücksichtigt. Die Arbeit zielt darauf ab, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der sprachlichen Gestaltung mystischer Erfahrungen aufzuzeigen.
- Sprachliche Elemente islamischer und christlicher Mystik
- Vergleich von Sprachbildern und Metaphern
- Analyse von Schlüsselbegriffen wie Wille, Wissen, Sein, Entwerden und Gottesbegriff
- Untersuchung der Rolle der Mystik in der Philosophie und Religion
- Bedeutung der Mystik für die Entwicklung der Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert die Bedeutung der Mystik für die Entwicklung der Sprache. Es werden die betrachteten Werke islamischer Mystik, „Die Nische der Lichter“ von al-Ghazali und „Der Philosoph als Autodidakt“ von Ibn Tufail, vorgestellt. Die Kapitel 2 und 3 behandeln die sprachlichen Tendenzen der christlichen und griechischen Mystik sowie die islamische Mystik. Kapitel 4 vergleicht Sprachbilder und Metaphern in den verschiedenen mystischen Traditionen, wobei die Themen Wille, Wissen, Sein, Entwerden und Gottesbegriff im Fokus stehen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen islamische Mystik, christliche Mystik, griechische Mystik, Sprachbilder, Metaphern, Wille, Wissen, Sein, Entwerden, Gottesbegriff, al-Ghazali, Ibn Tufail, „Die Nische der Lichter“, „Der Philosoph als Autodidakt“, Vergleichende Sprachwissenschaft, Mystik und Philosophie.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen islamischer und christlicher Mystik?
Ja, die Arbeit zeigt, dass beide Traditionen vergleichbare Sprachbilder und Metaphern verwenden, um spirituelle Erfahrungen wie das „Entwerden“ oder die Gottesnähe zu beschreiben.
Welche Werke der islamischen Mystik werden untersucht?
Im Fokus stehen al-Ghazalis „Die Nische der Lichter“ und Ibn Tufails „Der Philosoph als Autodidakt“.
Was bedeutet der Begriff „Entwerden“ in der Mystik?
„Entwerden“ (oder Fana im Islam) beschreibt den Prozess des Ablegens des eigenen Egos, um eins mit dem göttlichen Sein zu werden.
Welche Rolle spielt die griechische Philosophie in diesem Kontext?
Die islamische Philosophie tradierte große Teile des griechischen Gedankengutes, wodurch griechische Konzepte von Wissen und Sein auch die mystischen Strömungen beider Weltreligionen beeinflussten.
Wie prägt die Mystik die Sprache?
Die Mystik hat den philosophischen Sprachgebrauch nachhaltig geprägt, insbesondere durch die Schaffung neuer Begrifflichkeiten für abstrakte Zustände wie Wille, Wissen und Sein.
- Citation du texte
- Felix Strüning (Auteur), 2007, Sprachliche Elemente islamischer Mystik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112406