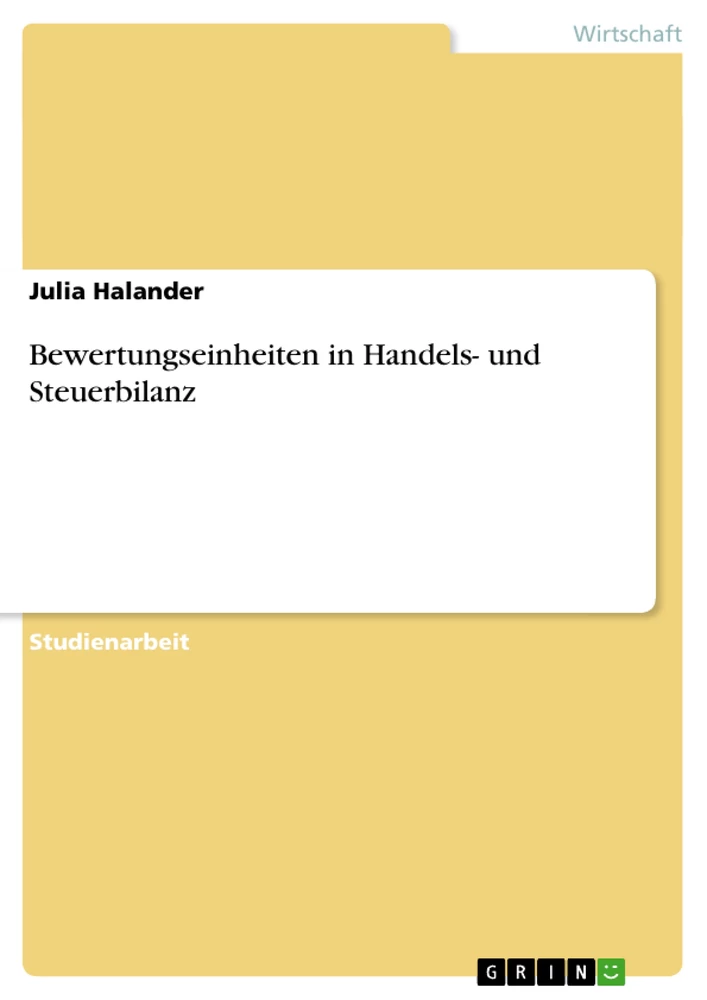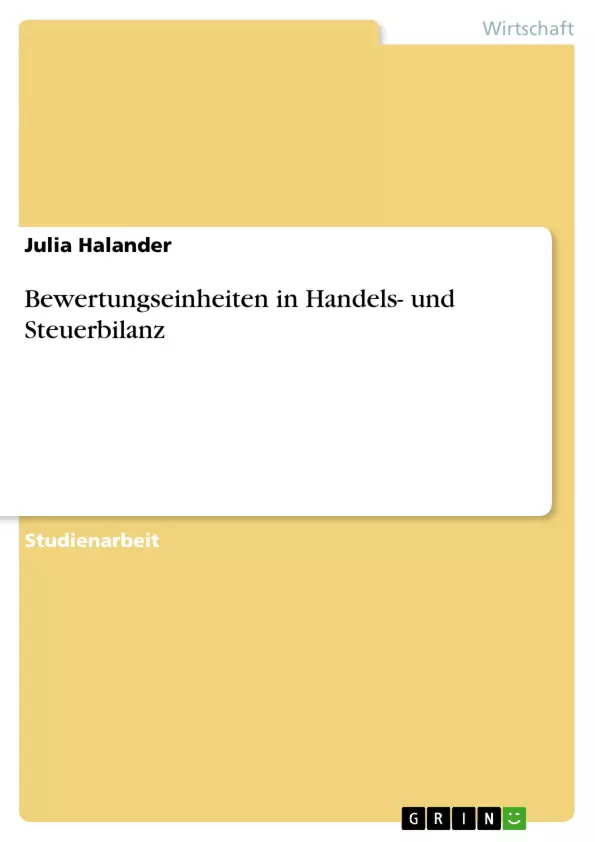Die Bildung von Bewertungseinheiten gehört zu den am meisten diskutierten Fragestellungen
im Handelsrecht. Dabei geht es um die Frage, ob und inwieweit in begründeten
Ausnahmefällen von allgemeinen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung abgewichen
werden kann, um die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Ergebnisse
zu erhalten. Die Zulässigkeit und konkrete Voraussetzungen für die Bildung von Bewertungseinheiten
zur Abbildung von Risikoabsicherungsgeschäften sind im Handelsrecht
nicht definiert und deswegen höchst umstritten. Das kürzlich verabschiedete Gesetz
zur Eindämmung missbräuchlicher Steuergestaltungen soll eine Klarstellung bei
der steuerbilanziellen Behandlung von Risikoabsicherungsgeschäften bewirken und die
bestehenden Unklarheiten beseitigen. Diese Unklarheiten können derzeit nach Auffassung
des Gesetzgebers für einen Verlustausweis in Milliarden Höhe genutzt werden.
Im Folgenden soll die Bewertungseinheit, ihre Zulässigkeit und die Voraussetzungen
für die Bildung von Bewertungseinheiten mithilfe der Rechtsprechung und aktuellen
Fachschrifttumsmeinungen definiert werden. Anschließend soll die Frage beantwortet
werden, ob die gesetzliche Neuregelung eine sinnvolle Lösung bestehender Probleme
darstellt oder mit der direkten Übernahme der Ergebnisse handelsrechtlicher Bewertungseinheiten
vorhandene Unsicherheiten in die Steuerbilanz exportiert werden. Der Begriff der Bewertungseinheit ist im Handelsrecht nicht geregelt, vielmehr ist er
durch die Rechtsprechung und Schrifttum entwickelt worden. Es handelt sich also um
einen unbestimmten Rechtsbegriff, bei dem erheblicher Interpretationsbedarf besteht.
Grundsätzlich muss zwischen zwei verschiedenen Problemkreisen unterschieden werden,
die zwar beide vom Grundsatz der Einzelbewertung ausgehen, aber ganz unterschiedliche
Probleme umfassen.
Zum einen gibt es die sog. „Bilanzierungsobjekteinheit“ bzw. „Bewertungseinheit im
engeren Sinne“. Sie bestimmt was als einzelner Vermögensgegenstand oder einzelne
Schuld anzusehen ist und folglich einheitlichen Bewertungsmaßstäben unterliegt.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einführung
2 Begriff der Bewertungseinheit
3 Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
4 Kompensatorische Bewertung
4.1 Problematik der Bewertung von Hedging-Geschäften
4.2 Konzept der Bildung von Bewertungseinheiten
4.3 Voraussetzungen einer kompensatorischen Bewertung
4.3.1 Währungsidentität
4.3.2 Betragsidentität
4.3.3 Fälligkeitsidentität
4.3.4 Dokumentation des Sicherungszusammenhangs
5 Bildung von Bewertungseinheiten in der Steuerbilanz
5.1 Inhalt der Neuregelung
5.2 Kritische Beurteilung der Neuregelung
6 Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einführung
Die Bildung von Bewertungseinheiten gehört zu den am meisten diskutierten Fragestellungen im Handelsrecht. Dabei geht es um die Frage, ob und inwieweit in begründeten Ausnahmefällen von allgemeinen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung abgewichen werden kann, um die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Ergebnisse zu erhalten. Die Zulässigkeit und konkrete Voraussetzungen für die Bildung von Bewertungseinheiten zur Abbildung von Risikoabsicherungsgeschäften sind im Handelsrecht nicht definiert und deswegen höchst umstritten.[1] Das kürzlich verabschiedete Gesetz zur Eindämmung missbräuchlicher Steuergestaltungen soll eine Klarstellung bei der steuerbilanziellen Behandlung von Risikoabsicherungsgeschäften bewirken und die bestehenden Unklarheiten beseitigen. Diese Unklarheiten können derzeit nach Auffassung des Gesetzgebers für einen Verlustausweis in Milliarden Höhe genutzt werden.[2] Im Folgenden soll die Bewertungseinheit, ihre Zulässigkeit und die Voraussetzungen für die Bildung von Bewertungseinheiten mithilfe der Rechtsprechung und aktuellen Fachschrifttumsmeinungen definiert werden. Anschließend soll die Frage beantwortet werden, ob die gesetzliche Neuregelung eine sinnvolle Lösung bestehender Probleme darstellt oder mit der direkten Übernahme der Ergebnisse handelsrechtlicher Bewertungseinheiten vorhandene Unsicherheiten in die Steuerbilanz exportiert werden.[3]
2 Begriff der Bewertungseinheit
Der Begriff der Bewertungseinheit ist im Handelsrecht nicht geregelt, vielmehr ist er durch die Rechtsprechung und Schrifttum entwickelt worden. Es handelt sich also um einen unbestimmten Rechtsbegriff, bei dem erheblicher Interpretationsbedarf besteht. Grundsätzlich muss zwischen zwei verschiedenen Problemkreisen unterschieden werden, die zwar beide vom Grundsatz der Einzelbewertung ausgehen, aber ganz unterschiedliche Probleme umfassen.[4]
Zum einen gibt es die sog. „Bilanzierungsobjekteinheit“ bzw. „Bewertungseinheit im engeren Sinne“. Sie bestimmt was als einzelner Vermögensgegenstand oder einzelne Schuld anzusehen ist und folglich einheitlichen Bewertungsmaßstäben unterliegt. Eine einzelne Schuld kann i. d. R. ohne Schwierigkeiten bestimmt werden. Dagegen ist die Abgrenzung zwischen einem einzelnen Vermögensgegenstand und einer Mehrzahl von Vermögensgegenständen nicht selten zweifelhaft.[5] Im Wirtschaftsleben bilden oft mehrere Vermögensgegenstände eine Bewertungseinheit, weil sie zu einem bestimmten Zweck zusammengefasst sind, z. B. Teile einer Fertigungsanlage bilden eine Sachgesamtheit.[6] Dieser Problemkreis soll auch bestimmen, wann ein Teil eines Gebäudes diesem bilanzrechtlich zugehört und wann dieser als eigenständiger Vermögensgegenstand zu bewerten ist. Steuerrechtlich hängt eine solche Abgrenzung von der Nutzung der Ge-bäudeteile ab. Wenn die Gebäudeteile der Benutzung des Gebäudes selbst dienen, z. B. Heizungsanlagen, dann gehören sie aufgrund des Nutzungs- und Funktionszusammenhangs zum Gebäude. Gebäudeteile wie Transportanlagen oder Schaufenster können als Betriebsvorrichtungen bezeichnet und gesondert bewertet werden, weil sie einem von der Nutzung des Gebäudes abweichenden Zweck dienen.[7]
Diese Art der Bewertungseinheit ist zulässig und unumstritten.[8]
Zum anderen gibt es die „Bewertungseinheit im weiteren Sinne“, die auch als kompensatorische Bewertung bezeichnet wird. Sie umfasst Sachverhalte, in denen verschiedene selbstständige Vermögensgegenstände und Schulden zunächst einzeln bewertet werden und nachfolgend fiktiv zu einer Bewertungseinheit zusammengefasst und bilanziert werden, z. B. Bildung von Drohverlustrückstellungen und Bilanzierung von Risikokompensierender Geschäftsvorfälle (sog. Hedging-Geschäfte).[9]
Bei der Bewertung der im Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden sind sowohl die allgemeinen Bewertungsgrundsätze als auch die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung zu beachten.[10]
[...]
[1] Vgl. Hahne, K. (2003), S. 1943.
[2] Vgl. Herzig, N. (2006), S. 1451.
[3] Vgl. Hahne, K. (2006), S. 2291.
[4] Vgl. Herzig, N. (2006), S. 1453.
[5] Vgl. Wiedemann, H. (1998), S. 96.
[6] Vgl. Falterbaum, H. (1995), S. 42.
[7] Vgl. Wiedemann, H. (1998), S. 96.
[8] Vgl. Herzig, N. (2006), S. 1453.
[9] Vgl. Wiedemann, H. (1998), S. 97.
[10] Vgl. Hahne, K. (2006), S. 2291.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Bewertungseinheit im Handelsrecht?
Eine Bewertungseinheit ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, bei dem mehrere Vermögensgegenstände oder Schulden für die Bilanzierung zusammengefasst werden, um wirtschaftliche Zusammenhänge (wie Hedging) abzubilden.
Was unterscheidet die Bewertungseinheit im engeren vom weiteren Sinne?
Im engeren Sinne geht es um physische Einheiten (z.B. eine Fertigungsanlage), im weiteren Sinne um die kompensatorische Bewertung rechtlich selbstständiger Posten (z.B. Absicherungsgeschäfte).
Was sind die Voraussetzungen für die Bildung einer Bewertungseinheit bei Hedging-Geschäften?
Wichtige Kriterien sind Währungsidentität, Betragsidentität, Fälligkeitsidentität und die lückenlose Dokumentation des Sicherungszusammenhangs.
Warum wurde das Gesetz zur Eindämmung missbräuchlicher Steuergestaltungen eingeführt?
Es sollte Klarheit bei der steuerbilanziellen Behandlung von Risikoabsicherungsgeschäften schaffen und verhindern, dass Unklarheiten für Milliardenverluste genutzt werden.
Welche Kritik gibt es an der Übernahme handelsrechtlicher Bewertungseinheiten in die Steuerbilanz?
Kritiker befürchten, dass dadurch bestehende Unsicherheiten und Interpretationsspielräume des Handelsrechts direkt in die Steuerbilanz exportiert werden.
- Quote paper
- Julia Halander (Author), 2007, Bewertungseinheiten in Handels- und Steuerbilanz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112423