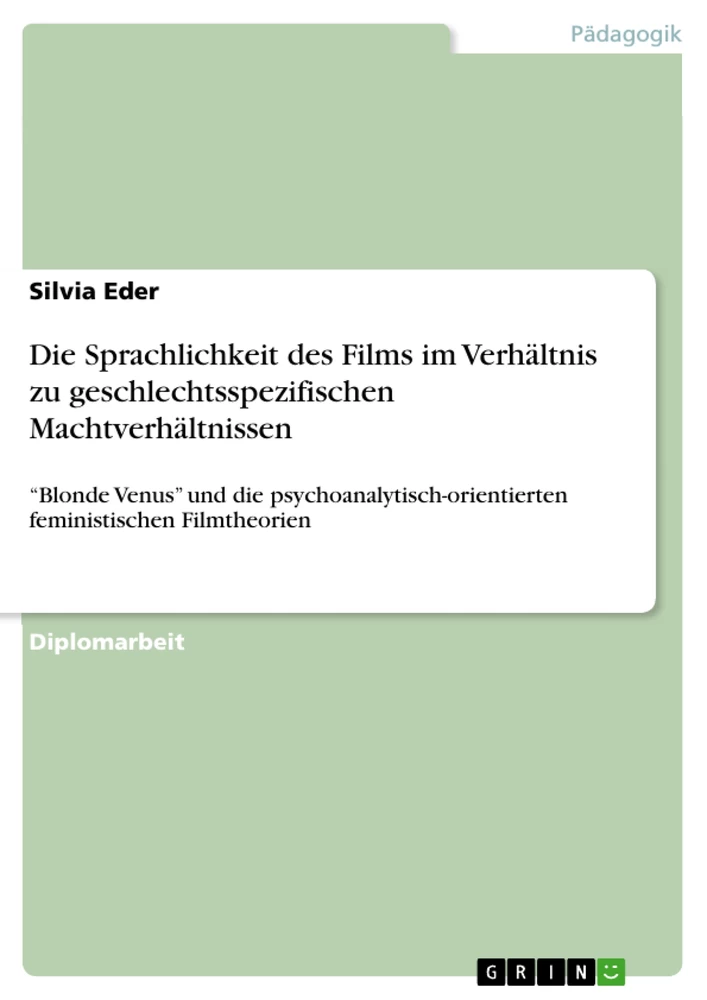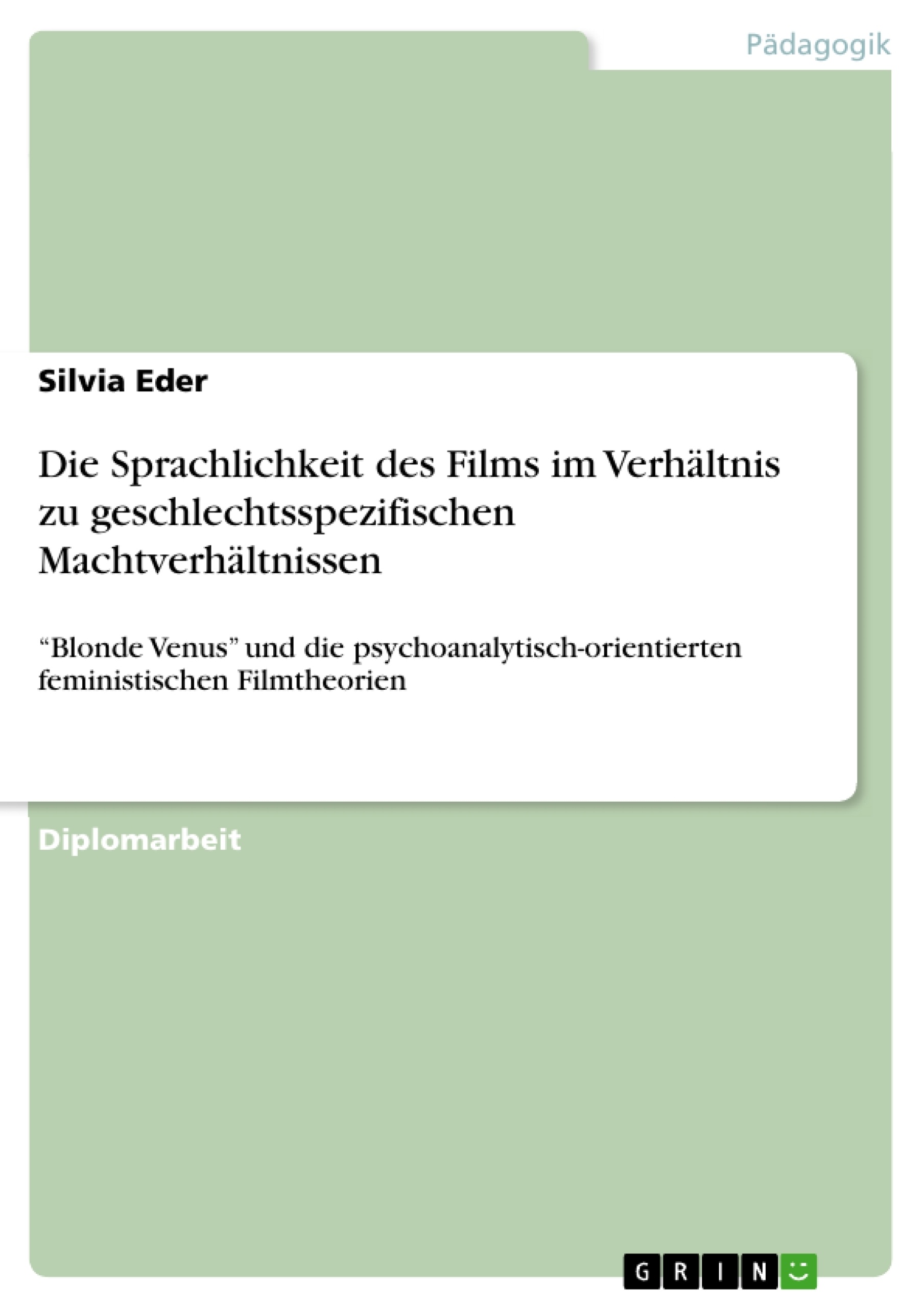Bei der kritischen Rezeption des Films die „Blonde Venus“ (Josef von Sternberg, 1932) stellt sich die Frage, wie sich die Sprachlichkeit des Films zu den geschlechtsspezifischen gesellschaftlichen Machtverhältnissen verhält. Aus diesem Grund wurde nach einer geeigneten Methode gesucht, um zu erforschen wie sich dieses Verhältnis theoretisch darstellen lässt. Die Entscheidung fiel auf die psychoanalytisch-orientierte-feministische Filmtheorie der feministischen Filmwissenschaften, da sich diese textorientierte Methode möglicherweise als Interpretationsmethode von Filmen für den Unterricht eignen würde.
Die Auswahl des Referenzfilms ergibt sich durch die differenzierte Darstellung der Frau in der Rolle Helens (Marlene Dietrich) in „Blonde Venus“ (1932), im Gegensatz zu dem sonst zu dieser Zeit üblichen, durch eine patriarchale Perspektive entworfenen, stereotypisierten Frauenbild im Erzählkino.
Der Fragestellung liegt die These der feministischen Filmwissenschaften zugrunde, dass Medien immer im Kontext von geschlechtsspezifischen gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnissen zu denken sind. Sie sind an der Weitergabe und Konstruktion gültiger Wahrheiten und Wirklichkeitskonstruktionen beteiligt. Sie produzieren und vermitteln jenes gesellschaftliche Wissen, das für eine bestimmte Zeit als allgemeingültige „Wahrheit“ gilt (vgl. Dorer, 2002). Wahrheit wird nach Foucault als „Ensemble von Regeln, nach denen das Wahre vom Falschen geschieden und das Wahre mit spezifischen Machtwirkungen ausgestattet wird“ gesehen (Foucault 1978, 53). Im Anschluss an Foucault, bezeichnet Dorer (2002) Medien als „Institutionen der Wahrheitsproduktion“ (Dorer 2002, 54) und des „populären Wissens“ (ebd.), das in einer Gesellschaft zirkuliert. Kulturelle Konzeptionen von Männlichkeit und Weiblichkeit werden von den Medien verdichtet, stereotypisiert und als gesellschaftliche Normen dargestellt (vgl. ebd.).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Medienpädagogische Ambitionen zum Medium Film
- Phasen der medienpädagogischen Theoriebildung
- Bewahrpädagogik - Kinoreformpädagogik – Schulfilmbewegung
- Die präventiv- normative Medienpädagogik
- Die kritisch-rezeptive und emanzipatorisch-politische Medienpädagogik
- Die bildungstechnologisch-funktionale Medienpädagogik
- Die reflexiv-praktische Medienpädagogik
- Mit Medienkompetenz zur Medienbildung
- Medienpädagogik heute: wofür eine Filmanalyse verwendet werden kann (Interpretationsmethode für den Unterricht)
- Medienerziehung als Unterrichtsprinzip
- Filmerziehung als Bestandteil der Medienerziehung
- Theoretische Kontexte in ihrer historischen Entwicklung
- Filmtheorien im Wandel - Phasen der Theoriebildung
- Polypol (1895 – 1909)
- Oligopol (1909 – 1929)
- Monopol (1930 - 1946)
- Internationales Monopol (1947 - 1970)
- Tendenzen eines weiteren Polypols (ab 1970)
- Queer Studies
- New Queer Cinema
- Cultural Studies
- Reading Television
- Zusammenfassung
- Einbettung feministischer Filmtheorie in den historischen und kulturellen Kontext
- Frauenbewegungen und feministische Forschung
- Theoretische Ansätze und Entwicklungen in der feministischen Filmtheorie
- Semiotische Ansätze
- Psychoanalytische Ansätze
- Gender und Genre
- Queer Film Theory
- Kontext der Rezeptionssituation
- Kulturalistische Filmhistoriographie
- Positionierung der AutorInnen, in der Geschichte der psychoanalytisch orientierten feministischen Filmtheorie
- Die Sprachlichkeit des Films im Hinblick auf geschlechtsspezifische gesellschaftliche Machtverhältnisse
- Zur psychoanalytischen Subjektkonstitution
- Ödipuskonflikt
- Spiegelstadium
- Visual Pleasure and Narrative Cinema
- Skopophilie
- Skopophilie narzisstischer Ausprägung
- Die Frau als Bild, der Mann als Träger des Blickes
- Voyeuristische Schaulust und fetischistische Skopophilie
- Mulveys Schlussbetrachtungen
- Kritik und Ausblick
- Schaulust und masochistische Ästhetik
- Kritik und Ausblick
- Referenzfilm: Blonde Venus (von Sternberg, 1932)
- Inhaltsangabe
- Inhaltsanalyse
- Schlussbetrachtung und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Filmverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse des Films „Blonde Venus“ (Josef von Sternberg, 1932) im Kontext der feministischen Filmtheorie. Ziel ist es, die Sprachlichkeit des Films im Hinblick auf geschlechtsspezifische gesellschaftliche Machtverhältnisse zu untersuchen und die Eignung der psychoanalytisch-orientierten-feministischen Filmtheorie als Interpretationsmethode für den Unterricht zu beleuchten.
- Die Rolle der Frau in der Filmgeschichte und die Konstruktion von Weiblichkeit im Film
- Die Analyse von Filmsprache und ihre Bedeutung für die Darstellung von Machtverhältnissen
- Die Anwendung der feministischen Filmtheorie als Interpretationsmethode für den Unterricht
- Die Bedeutung von Psychoanalyse und Semiotik für die Analyse von Filmen
- Die Rezeption von Filmen und die Konstruktion von Subjektpositionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die Fragestellung sowie die Relevanz der feministischen Filmtheorie für die Analyse des Films „Blonde Venus“ dar. Sie beleuchtet die Bedeutung von Medien als Institutionen der Wahrheitsproduktion und die Rolle von Filmsprache bei der Konstruktion von Wirklichkeit.
Kapitel 2 befasst sich mit den medienpädagogischen Ambitionen zum Medium Film und beleuchtet die verschiedenen Phasen der medienpädagogischen Theoriebildung. Es wird die Bedeutung von Filmanalyse als Interpretationsmethode für den Unterricht hervorgehoben.
Kapitel 3 gibt einen Überblick über die historische Entwicklung der Filmtheorie und stellt verschiedene theoretische Ansätze vor, die für die Analyse von Filmen relevant sind. Es werden die Phasen der Theoriebildung, die Entstehung von Queer Studies und Cultural Studies sowie die Bedeutung von „Reading Television“ beleuchtet.
Kapitel 4 widmet sich der Einbettung der feministischen Filmtheorie in den historischen und kulturellen Kontext. Es werden die Frauenbewegungen und die Entwicklungen in der feministischen Forschung sowie verschiedene theoretische Ansätze der feministischen Filmtheorie, wie semiotische, psychoanalytische und kulturalistische Ansätze, vorgestellt.
Kapitel 5 untersucht die Sprachlichkeit des Films im Hinblick auf geschlechtsspezifische gesellschaftliche Machtverhältnisse. Es werden die psychoanalytischen Konzepte des Ödipuskonflikts und des Spiegelstadiums sowie Mulveys Theorie des „Visual Pleasure and Narrative Cinema“ vorgestellt. Die Bedeutung von Skopophilie, Voyeurismus und Fetischismus für die Konstruktion von Weiblichkeit im Film wird beleuchtet.
Kapitel 6 analysiert den Referenzfilm „Blonde Venus“ (Josef von Sternberg, 1932) und untersucht die Darstellung der Frau in der Rolle Helens (Marlene Dietrich) im Kontext der feministischen Filmtheorie.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die feministische Filmtheorie, die Analyse von Filmsprache, die Konstruktion von Weiblichkeit im Film, die Darstellung von Machtverhältnissen, die Bedeutung von Psychoanalyse und Semiotik für die Filmanalyse, die Rezeption von Filmen und die Konstruktion von Subjektpositionen, sowie die Eignung der feministischen Filmtheorie als Interpretationsmethode für den Unterricht.
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht die feministische Filmtheorie?
Sie analysiert, wie Filme Geschlechterrollen konstruieren, Machtverhältnisse zwischen Mann und Frau darstellen und wie der „männliche Blick“ die Bildsprache dominiert.
Was bedeutet „Visual Pleasure and Narrative Cinema“?
Dies ist ein zentraler Text von Laura Mulvey, der beschreibt, wie das klassische Kino die Frau zum passiven Objekt der Schaulust (Skopophilie) für den männlichen Zuschauer macht.
Welche Rolle spielt Marlene Dietrich in „Blonde Venus“?
Marlene Dietrichs Rolle Helen zeigt ein differenzierteres Frauenbild, das teilweise mit patriarchalen Stereotypen bricht, aber dennoch im Kontext der damaligen Machtverhältnisse steht.
Was sind „Institutionen der Wahrheitsproduktion“?
Nach Foucault und Dorer sind Medien Institutionen, die festlegen, was in einer Gesellschaft als „Wahrheit“ über Geschlechter und Normen gilt.
Können Filmanalysen im Unterricht helfen?
Ja, sie fördern die Medienkompetenz, indem sie Schülern helfen, versteckte Machtstrukturen und Geschlechterklischees in modernen und klassischen Filmen zu erkennen.
- Quote paper
- Magister Silvia Eder (Author), 2007, Die Sprachlichkeit des Films im Verhältnis zu geschlechtsspezifischen Machtverhältnissen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112593